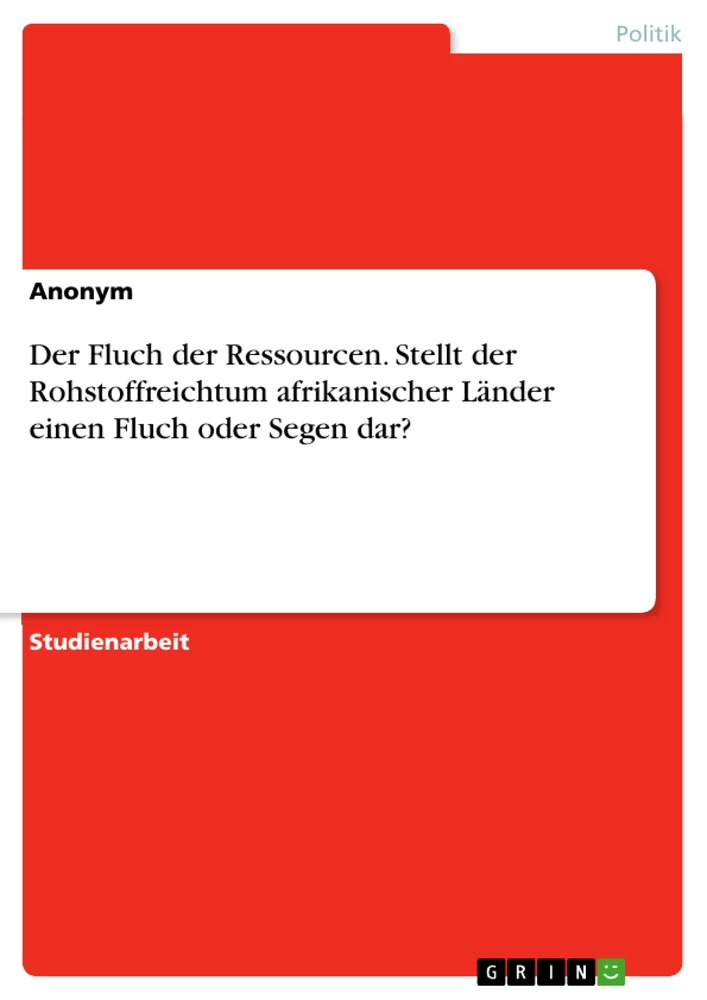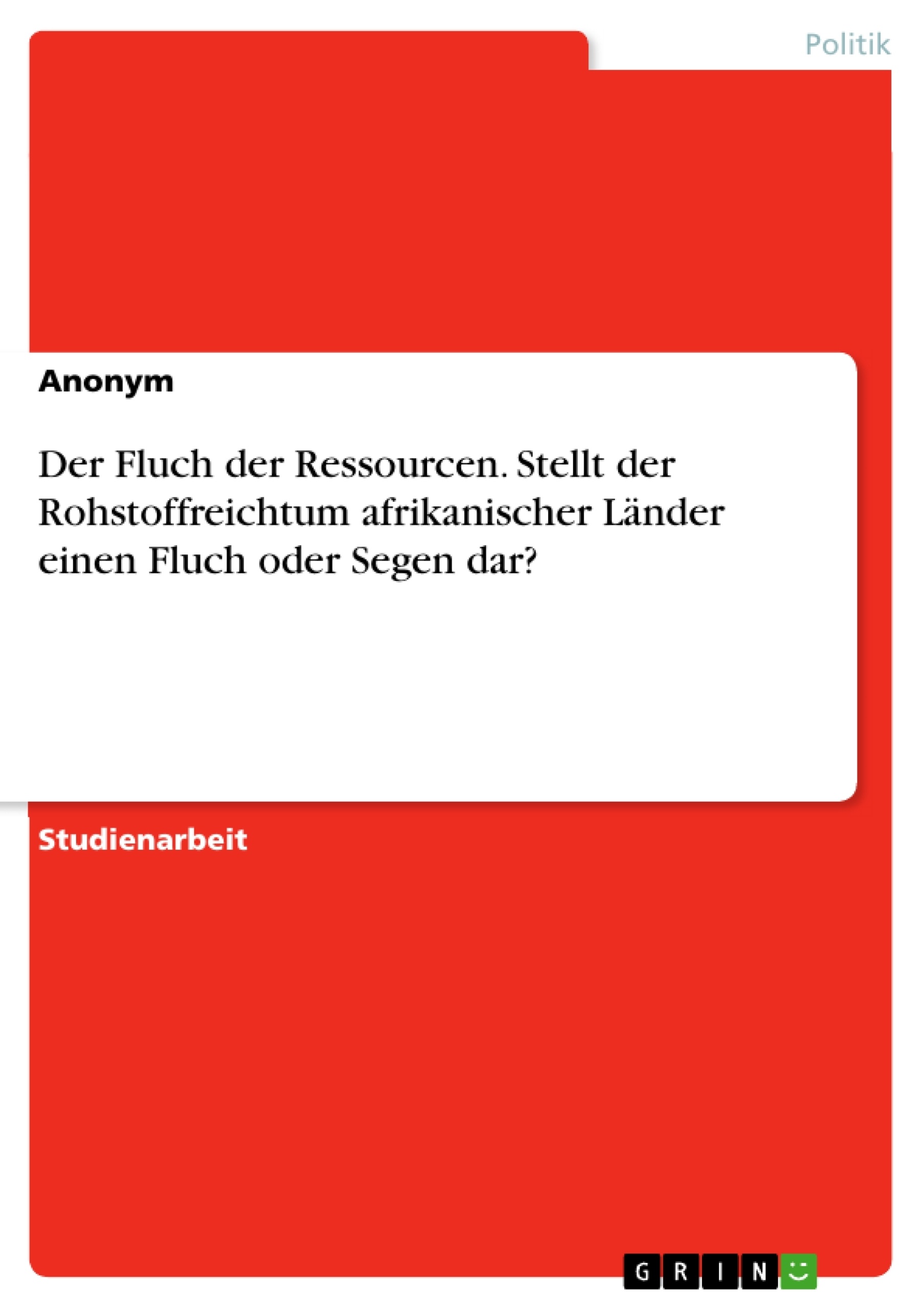In der Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Rohstoffreichheit in Botsuana und Simbabwe einen Fluch oder einen Segen darstellt.
Um die Frage zu beantworten, erfolgt zunächst eine theoretische Einbettung der Fallbeispiele in die Forschungslage. Konkret heißt das, dass einige Aspekte des Ressourcenfluchs beleuchtet, empirische Erkenntnisse der Forschung herausgestellt und Erklärungsversuche beschrieben werden. Dazu zählt zunächst die sogenannte Holländische Krankheit, die in der Literatur vielfach als eine Variante des Ressourcenfluchs aufgeführt wird. Um einen differenzierten Blick auf die Auswirkungen des Ressourcenfluchs zu erhalten, werden im Anschluss separat die politische und die wirtschaftliche Dimension des Ressourcenfluchs betrachtet. Darauf folgt die eigentliche Analyse der beiden Länder Botsuana und Simbabwe. Für beide Länder erfolgt ausgehend von den vorhandenen Rohstoffen eine Analyse der politischen und ökonomischen Lage. Dabei wird auf die im vorherigen Kapitel herausgearbeiteten theoretischen und empirischen Erkenntnisse aufgebaut.
"Afrika ist reich an Rohstoffen, aber vielerorts geht der Rest der Volkswirtschaft zugrunde." Der Satz beschreibt treffend den Zustand vieler afrikanischer Länder, die trotz umfangreicher Rohstoffvorkommen im Vergleich zu rohstoffärmeren Ländern nicht profitieren können und sowohl wirtschaftlich als auch politisch Entwicklungsdefizite aufweisen. Dieses Paradoxon, der sogenannte Fluch der Ressourcen, taucht erstmals Ende des 20. Jahrhunderts in der Literatur auf. Die Auswirkungen eines Ressourcenreichtums scheinen also von verschiedenen Kontextfaktoren abzuhängen, wie zum Beispiel der geographischen Lage oder der Art der Ressourcen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Einbettung der Länderbeispiele
- 2.1 Die Holländische Krankheit
- 2.2 Politische Dimension des Ressourcenfluchs
- 2.2.1 Rohstoffreichtum und Demokratie
- 2.2.2 Rohstoffreichtum und Institutionen
- 2.2.3 Rohstoffreichtum und Bürgerkriege
- 2.3 Ökonomische Dimension des Ressourcenfluchs
- 3. Länderbeispiele
- 3.1 Botsuana
- 3.1.1 Rohstoffvorkommen und Landwirtschaft
- 3.1.2 Politische Lage
- 3.1.3 Ökonomische Lage
- 3.2 Simbabwe
- 3.2.1 Rohstoffvorkommen und Landwirtschaft
- 3.2.2 Politische Lage
- 3.2.3 Ökonomische Lage
- 3.1 Botsuana
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Paradoxon des Ressourcenreichtums in afrikanischen Ländern, den sogenannten Ressourcenfluch. Am Beispiel Botsuanas und Simbabwes wird der Frage nachgegangen, ob Rohstoffreichtum Segen oder Fluch darstellt. Die Arbeit analysiert die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von Rohstoffvorkommen unter Berücksichtigung bestehender Theorien.
- Der Ressourcenfluch und seine verschiedenen Dimensionen
- Die Holländische Krankheit als Variante des Ressourcenfluchs
- Politische Stabilität und institutionelle Rahmenbedingungen im Kontext von Rohstoffreichtum
- Wirtschaftswachstum und Diversifizierung der Wirtschaft in rohstoffreichen Ländern
- Vergleichende Analyse der Fälle Botsuana und Simbabwe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert das Paradoxon des Ressourcenreichtums in Afrika: Viele afrikanische Länder leiden trotz großer Rohstoffvorkommen unter wirtschaftlicher und politischer Unterentwicklung. Die Arbeit wählt Botsuana und Simbabwe als Fallbeispiele, um die komplexen Zusammenhänge zu untersuchen und die These zu überprüfen, ob Rohstoffreichtum Fluch oder Segen sein kann. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit dar, welcher eine theoretische Einbettung der Fallbeispiele in die vorhandene Forschungsliteratur und anschließend eine Länderanalyse umfasst. Der Unterschied in der Forschungslage zu beiden Ländern wird bereits erwähnt.
2. Theoretische Einbettung der Länderbeispiele: Dieses Kapitel bietet den theoretischen Rahmen für die anschließende Länderanalyse. Es beleuchtet verschiedene Aspekte des Ressourcenfluchs, darunter die „Holländische Krankheit“, welche die negativen Auswirkungen eines schnellen Wachstums des Rohstoffsektors auf andere Wirtschaftsbereiche beschreibt (Aufwertung der Währung, Deindustrialisierung). Das Kapitel differenziert zwischen der politischen und der ökonomischen Dimension des Ressourcenfluchs und skizziert relevante empirische Erkenntnisse und Erklärungsansätze. Hierbei werden die Auswirkungen auf Demokratie, Institutionen und die Entstehung von Bürgerkriegen thematisiert.
3. Länderbeispiele: In diesem Kapitel werden Botsuana und Simbabwe im Detail analysiert. Für beide Länder wird, ausgehend von den jeweiligen Rohstoffvorkommen, die politische und ökonomische Lage untersucht. Die Analyse baut auf den im vorherigen Kapitel dargestellten theoretischen und empirischen Erkenntnissen auf. Der Umfang der Analyse ist aufgrund der unterschiedlichen Forschungslage für Botsuana größer als für Simbabwe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Ressourcenfluch in Afrika: Eine vergleichende Analyse von Botsuana und Simbabwe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Paradoxon des Ressourcenreichtums in afrikanischen Ländern, den sogenannten Ressourcenfluch. Sie analysiert die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von Rohstoffvorkommen anhand der Fallbeispiele Botsuana und Simbabwe, um die Frage zu beantworten, ob Rohstoffreichtum Segen oder Fluch darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Dimensionen des Ressourcenfluchs, darunter die "Holländische Krankheit", die politischen Auswirkungen auf Demokratie und Institutionen, die Entstehung von Bürgerkriegen, Wirtschaftswachstum und Diversifizierung der Wirtschaft in rohstoffreichen Ländern. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der Fälle Botsuana und Simbabwe.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende Theorien zum Ressourcenfluch und berücksichtigt sowohl die ökonomische als auch die politische Dimension. Die "Holländische Krankheit" wird als ein spezifischer Aspekt des Ressourcenfluchs erläutert.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt das Thema vor und definiert die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Theoretische Einbettung) liefert den theoretischen Rahmen. Kapitel 3 (Länderbeispiele) analysiert Botsuana und Simbabwe detailliert. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Länder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Botsuana und Simbabwe, um die Auswirkungen von Rohstoffreichtum unter unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen zu untersuchen. Der Umfang der Analyse ist aufgrund der unterschiedlichen Forschungslage für beide Länder unterschiedlich.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Botsuana?
Die Analyse von Botsuana betrachtet die Rohstoffvorkommen, die politische Lage und die ökonomische Lage des Landes. Die Details der Ergebnisse sind im Kapitel 3 zu finden.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Simbabwe?
Ähnlich wie bei Botsuana werden in der Analyse von Simbabwe die Rohstoffvorkommen, die politische Lage und die ökonomische Lage untersucht. Die Ergebnisse sind im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Fazit (Kapitel 4) zusammengefasst. Die Arbeit überprüft die These, ob Rohstoffreichtum Fluch oder Segen sein kann, anhand der beiden Fallstudien.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle gedacht, die sich für die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von Rohstoffreichtum in Afrika interessieren, insbesondere für Wissenschaftler und Studierende im Bereich der Entwicklungsökonomie und Politikwissenschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Der Fluch der Ressourcen. Stellt der Rohstoffreichtum afrikanischer Länder einen Fluch oder Segen dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520796