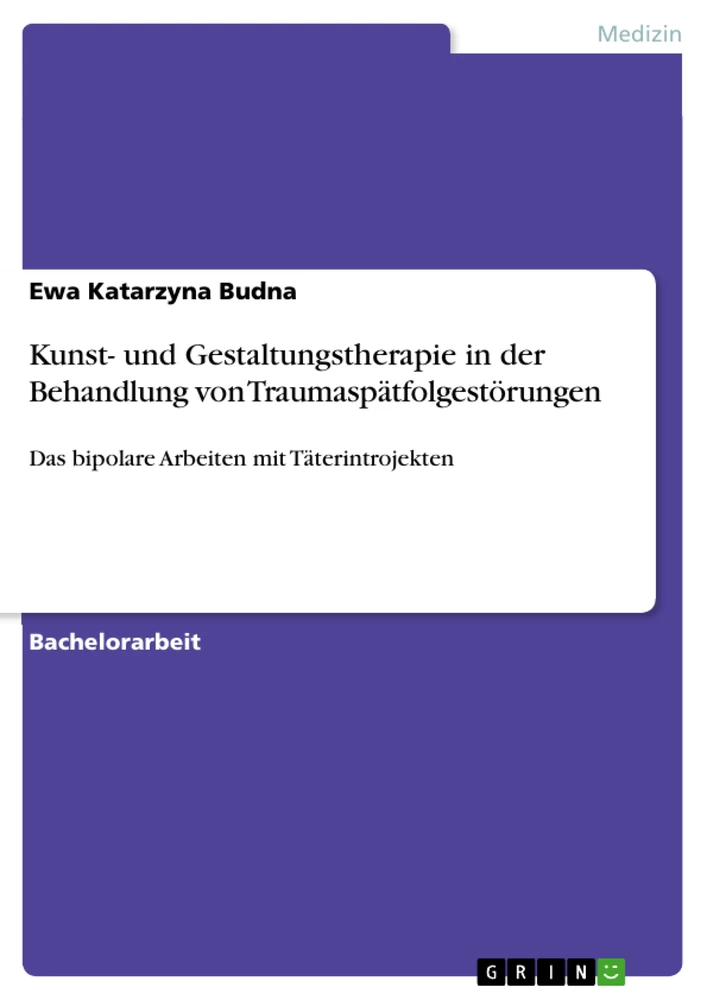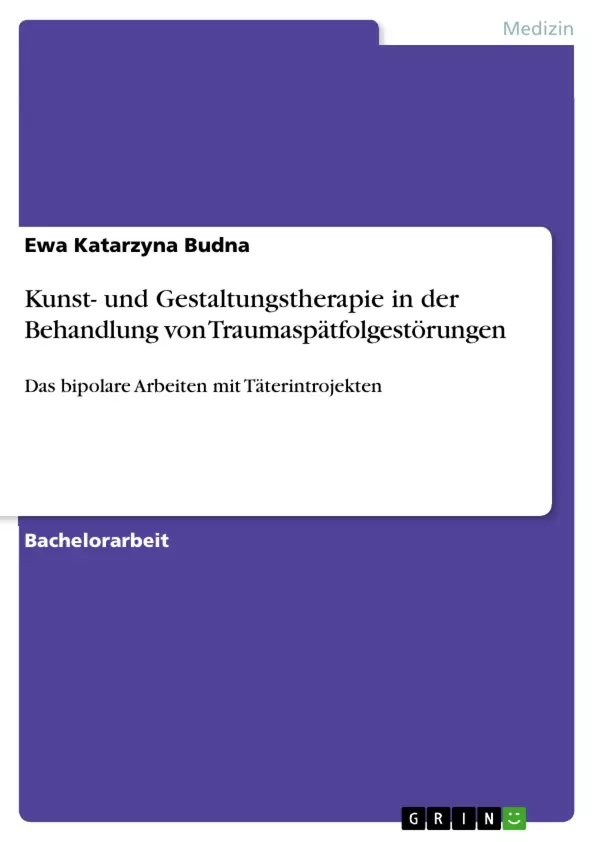In dieser Arbeit sollen zunächst die wichtigsten Behandlungsprinzipien, Entstehung und Wirksamkeit der Kunst- und Gestaltungstherapie sowie deren Einsatzmöglichkeiten in der Behandlung von Traumaspätfolgestörungen vorgestellt werden. Im weiteren Verlauf wird ein Therapieprozess mit für eine traumaspezifische Behandlung typischen Behandlungselementen beschrieben und die Möglichkeiten der Kunst- und Gestaltungstherapie dargestellt. Auch die kreativen, selbstorganisatorischen Prozesse, die in der Gestaltung und in der therapeutischen Begegnung mit KlientInnen entstehen und beobachtet werden, ihre Initiierung, Steuerung und Nutzung sind Gegenstand vorliegender Arbeit.
Traumatisierte geraten in Situationen, die zum Leben nicht mehr geeignet sind – diese Formulierung impliziert folgende verdichtete Trauma-Definition: Mensch und Umwelt bilden keine Einheit mehr. Zum Begriff des psychischen Traumas ist noch eine weitere Bemerkung erforderlich: Trauma wird mittlerweile als emotionales Belastungsmaterial bezeichnet, denn im Kern enthält das krankmachende psychische Material überstarke unverarbeitete negative Emotionen oder Emotionskomplexe, die in ihrer Stärke und ihren Folgen ein Kontinuum bilden. Die moderne Traumatherapie postuliert, dass Heilung ein selbstorganisatorischer biologischer Vorgang ist, der durch Phasenübergänge von dysfunktionalen zu funktionalen Ordnungsmustern erzeugt wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Psychotherapie stellt diese Bedingungen her.
Ein Heilungsvorgang wird in der Traumatherapie oft auch als Transformationsprozess bezeichnet: Das krankmachende Belastungsmaterial wird in gesundes, kreatives Material umgewandelt, transformiert. Dass Bilder therapeutisch wirksam sein können, ist seit Langem bekannt: Innere und äußere Bilder wirken auf die Psyche und beeinflussen das Verhalten. In bildnerischen Therapien geht es von Anfang an um einen Gestaltungsvorgang, der in seiner bildnerischen Dynamik den emotionalen Zustand eines Menschen spiegelt und nicht zuletzt beeinflusst. Die meisten Erwachsenen sind überzeugt, nicht malen bzw. gestalten zu können, dabei gehören Malen, Zeichnen und Gestalten zu den tief verankerten menschlichen Ausdrucksformen, wie auch Sprechen, Bewegen, Tanzen und Singen. Wird doch einmal die Hemmung zu gestalten aufgehoben, beginnt der Prozess, sich dem zu stellen, was man noch nicht weiß: Es entstehen Bilder, die überraschen, berühren, zum Nachdenken bringen und auch Neues in die Wege leiten können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN zu den WirkFAKTOREN DER KLINISCHEN KUNST- UND GESTALTUNGSTHERAPIE
- 1.1 Herkunft der künstlerischen Therapie
- 1.2 Entwicklung der Kunsttherapie in Deutschland
- 1.3 Wirkungsweisen
- 1.4 Kunsttherapeutische Ausrichtungen
- 1.5 Aus der Praxis: Rahmenbedingungen und Setting
- 2 DER SPEZIFISCHE RAHMEN DER GKT IN DER BEHANDLUNG VON TRAUMAFOLGEN
- 2.1 Psychische Traumatisierung
- 2.2 Belastungserfahrung und Stressreaktion: neurobiologische Grundlagen
- 2.3 Traumaspätfogestörung
- 2.4 Der Vorgang der Dissoziation
- 2.5 Täterintrojekte und ihre Funktion
- 2.5.1 Die Dissoziative Identitätsstörung
- 2.5.2 Täterintojekte
- 2.6 Der spezifische Rahmen der GKT bei der Arbeit mit Traumapatienten
- 3 DAS BIPOLARE PRINZIP DER TRAUMATHERAPIE UND DIE GRUNDLAGEN DER DREI-PHASEN-TRAUMATHERAPIE
- 3.1 Das bipolare Prinzip
- 3.2 Das Toleranzfenster
- 3.3 Prozessfokussierung: Vom Was zum Wie
- 4 KUNST- UND GESTALTUNGSTHERAPIE IN DER ARBEIT MIT TÄTERINTROJEKTEN
- 4.1 Täterintojekte in der Kunst und Gestaltungstherapie
- 4.2 Kunst- und Gestaltungsinterventionen in der Stabilisierungsphase
- 4.3 Kunst- und Gestaltungstherapie zur Arbeit in der Expositionsphase
- 4.4 Kunst- und Gestaltungstherapie in der Phase der Neuorientierung
- 5 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einsatz der Kunst- und Gestaltungstherapie in der Behandlung von Traumaspätfolgestörungen. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung des bipolaren Prinzips in der Traumatherapie, insbesondere im Kontext des Arbeitens mit Täterintrojekten.
- Die Entstehung und Wirkungsweise der Kunst- und Gestaltungstherapie
- Die Anwendung kunsttherapeutischer Methoden in der Stabilisierung, Exposition und Neuorientierungsphase der Traumatherapie
- Die Bedeutung des bipolaren Prinzips in der Traumatherapie und dessen Implikationen für die Kunst- und Gestaltungstherapie
- Die Rolle von Täterintrojekten in der Traumatherapie und deren Bearbeitung in der Kunst und Gestaltung
- Die kreativen und selbstorganisatorischen Prozesse, die durch künstlerische Gestaltung und therapeutische Begegnung entstehen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Kunst- und Gestaltungstherapie in der Behandlung von Traumaspätfolgestörungen heraus und verdeutlicht die Rolle von kreativen Prozessen in der Heilung.
- Kapitel 1: Dieses Kapitel erörtert die Entstehung und Entwicklung der Kunst- und Gestaltungstherapie, ihre Wirkungsweisen und verschiedenen Ausrichtungen. Es beleuchtet auch die Rahmenbedingungen und das Setting kunsttherapeutischer Prozesse.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden wichtige Aspekte der Traumatherapie behandelt, darunter die Definition von psychischer Traumatisierung, die neurobiologischen Grundlagen von Stressreaktionen und die Entstehung von Traumaspätfolgestörungen. Es werden auch die Dissoziation und die Rolle von Täterintrojekten in der Entstehung von Traumasymptomen erläutert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel erklärt das bipolare Prinzip der Traumatherapie und beschreibt die Grundlagen der Drei-Phasen-Traumatherapie, die sich auf Stabilisierung, Exposition und Neuorientierung konzentriert.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel wird die Anwendung der Kunst- und Gestaltungstherapie im Kontext von Täterintrojekten genauer betrachtet. Es werden verschiedene Interventionen in den unterschiedlichen Phasen der Traumatherapie vorgestellt, die die kreativen Ressourcen von Klient*innen zur Verarbeitung traumatischer Erfahrungen nutzen.
Schlüsselwörter
Kunst- und Gestaltungstherapie, Traumaspätfolgestörungen, bipolares Prinzip, Täterintrojekte, Dissoziation, Stabilisierung, Exposition, Neuorientierung, Ressourcenaktivierung, kreative Prozesse, Selbstorganisation, Traumatherapie, emotionale Belastung, Heilung.
- Citation du texte
- Ewa Katarzyna Budna (Auteur), 2018, Kunst- und Gestaltungstherapie in der Behandlung von Traumaspätfolgestörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520812