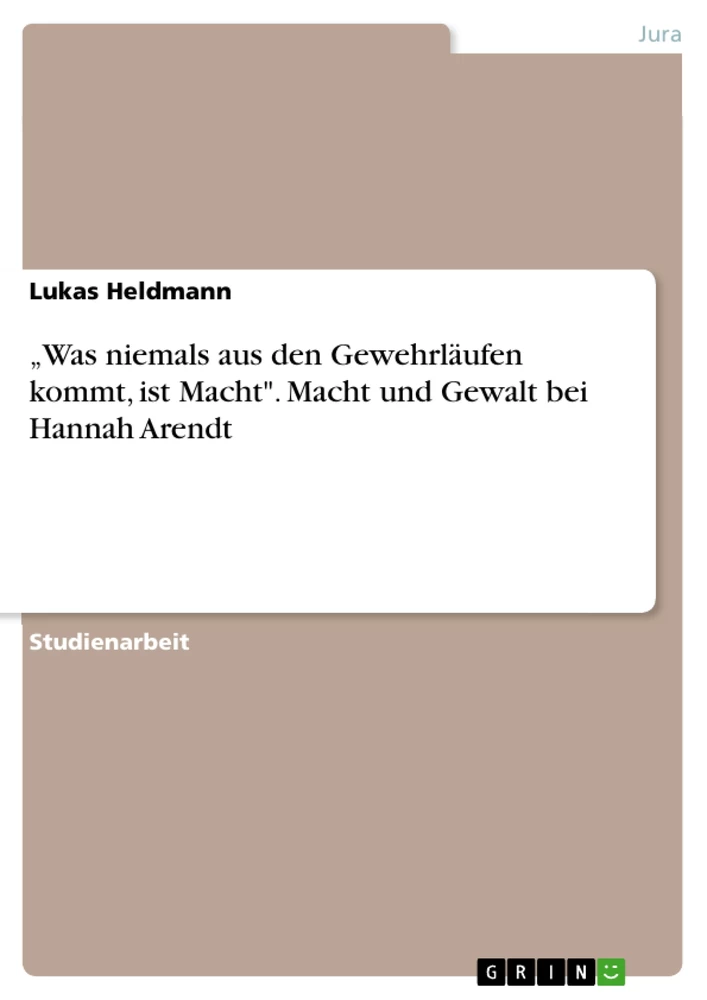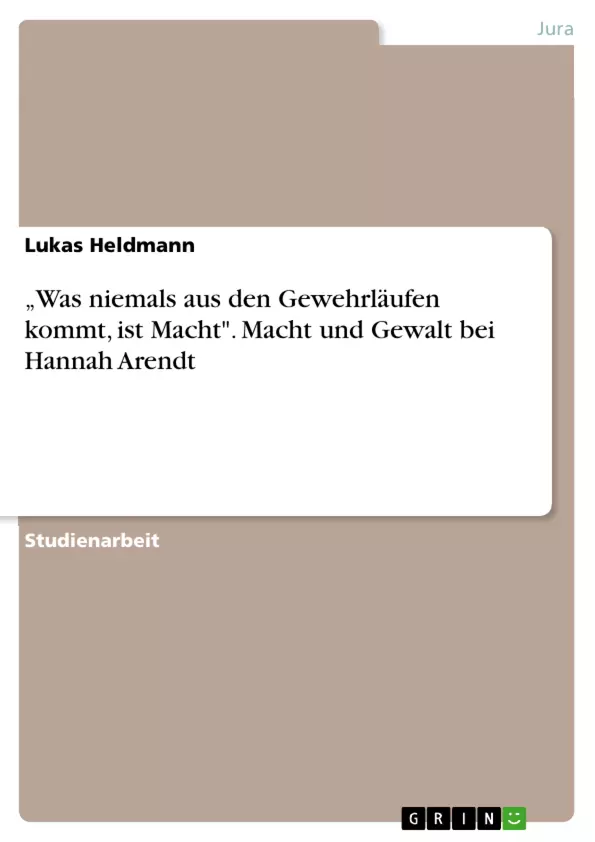Ziel dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung ist die Darstellung und kritische Untersuchung von Hannah Arendts Machtbegriff, der Versuch einer Begriffsbestimmung von Macht sowie eine gleichzeitige Abgrenzung von dem Phänomen der Gewalt.
„Was niemals aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht.“ Diese These spiegelt Hannah Arendts soziologische Anschauung zur Trennung von Macht und Gewalt deutlich wider. Mit ihrem rebellischen Statement, „Macht und Gewalt sind Gegensätze: wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden“, nimmt sie als Befürworterin eines separierenden Macht- und Gewaltbegriffs bis heute eine Sonderstellung in der politischen Philosophie ein.
Arendt distanziert sich radikal von dem traditionell etablierten Modell der Macht, bei dem die Phänomene Macht und Gewalt aufgrund ihrer begriffshistorischen Verknüpfung oft synonym verwendet werden. Sie bricht in ihrem politischen Konzept mit den klassischen Ansichten über die Einheit von Macht und Gewalt, indem sie die Gewalt vollständig von dem Begriff der Macht isoliert und als eine apolitische Erscheinung deklariert. Ihre Ideentheorie findet sich so in kaum einer anderen wissenschaftlichen Studie wieder.
Während im Übrigen fast einstimmig von einem Zusammenhang von Macht und Gewalt ausgegangen wird, definiert doch jeder Philosoph und Denker seinen eigenen Machtbegriff. Hannah Arendts Ansichten zur Macht zeichnen sich dabei vor allem durch ihre provokanten Thesen aus. Sie stellt sich quer zu den verbreiteten Auffassungen. Aus diesem Grund fällt die Zuordnung der politischen Denkerin zu einer philosophischen Strömung schwer, besonders da sie selbst den Begriff der Philosophin ablehnt und die Berufsbezeichnung politische Theorie präferiert.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Macht und Gewalt – Versuch einer Begriffsbestimmung und Begriffsabgrenzung
- I. Die klassische Verknüpfung von Macht und Gewalt
- II. Hannah Arendts moderne Vorstellung über die Trennung von Macht und Gewalt
- 1. Macht als Ergebnis kommunikativen Handelns
- 2. Gewalt als apolitische Erscheinungsform mit instrumentalem Charakter
- 3. Das Zusammenspiel von Macht und Gewalt in der Politik
- C. Bewertung von Arendts Theorie der Macht
- I. Chancen von Arendts Macht- und Gewaltverständnis
- II. Grenzen von Arendts Macht- und Gewaltverständnis
- D. Resümee
- E. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Ausarbeitung setzt sich zum Ziel, Hannah Arendts Machtbegriff darzustellen und kritisch zu untersuchen. Dabei wird versucht, den Begriff der Macht zu bestimmen und gleichzeitig vom Phänomen der Gewalt abzugrenzen. Die Arbeit befasst sich mit Arendts Abgrenzung von Macht und Gewalt sowie den Chancen und Grenzen ihres Machtverständnisses.
- Hannah Arendts Machtbegriff und seine Abgrenzung von Gewalt
- Die klassische Verknüpfung von Macht und Gewalt im Vergleich zu Arendts Theorie
- Das Zusammenspiel von Macht und Gewalt in der Politik nach Arendt
- Chancen und Grenzen von Arendts Machtverständnis
- Aktuelle Relevanz von Arendts Machttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A liefert eine Einführung in die Thematik und stellt die zentrale These von Hannah Arendt vor: Macht und Gewalt sind Gegensätze. Kapitel B analysiert die klassische Verknüpfung von Macht und Gewalt und beleuchtet Arendts moderne Vorstellung von der Trennung dieser beiden Phänomene. Kapitel C bewertet Arendts Theorie der Macht und diskutiert die Chancen und Grenzen ihres Machtverständnisses.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konzepte von Macht und Gewalt nach Hannah Arendt. Weitere zentrale Themen sind die Trennung von Macht und Gewalt, kommunikatives Handeln, politische Philosophie, politische Herrschaft und die Analyse von Arendts Theorie im Kontext der klassischen Macht- und Gewaltansichten.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet Hannah Arendt zwischen Macht und Gewalt?
Für Arendt sind Macht und Gewalt Gegensätze: Macht entsteht durch gemeinsames, kommunikatives Handeln, während Gewalt instrumentell ist und oft dort eingesetzt wird, wo Macht schwindet.
Was bedeutet das Zitat „Was niemals aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht“?
Dieses Statement verdeutlicht, dass wahre politische Macht auf Zustimmung und Kooperation basiert, während Gewehre lediglich Gewalt ausüben können, die keine dauerhafte politische Autorität schafft.
Was ist "kommunikatives Handeln" im Kontext der Macht?
Macht ist bei Arendt das Ergebnis von Menschen, die sich zusammentun und gemeinsam handeln. Sie ist kein Besitz eines Einzelnen, sondern existiert nur im Zwischenraum zwischen Menschen.
Warum bezeichnet Arendt Gewalt als "apolitisch"?
Gewalt benötigt keine Sprache oder Übereinkunft, sondern nur Werkzeuge. Da Politik für Arendt jedoch auf Rede und gemeinsamem Handeln basiert, steht Gewalt außerhalb des eigentlichen politischen Raums.
Welche Kritik gibt es an Arendts Machtbegriff?
Kritiker weisen oft darauf hin, dass die strikte Trennung in der Realität schwer aufrechtzuerhalten ist, da politische Herrschaft oft beide Elemente – Macht und Gewalt – kombiniert.
- Citar trabajo
- Lukas Heldmann (Autor), 2020, „Was niemals aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht". Macht und Gewalt bei Hannah Arendt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520982