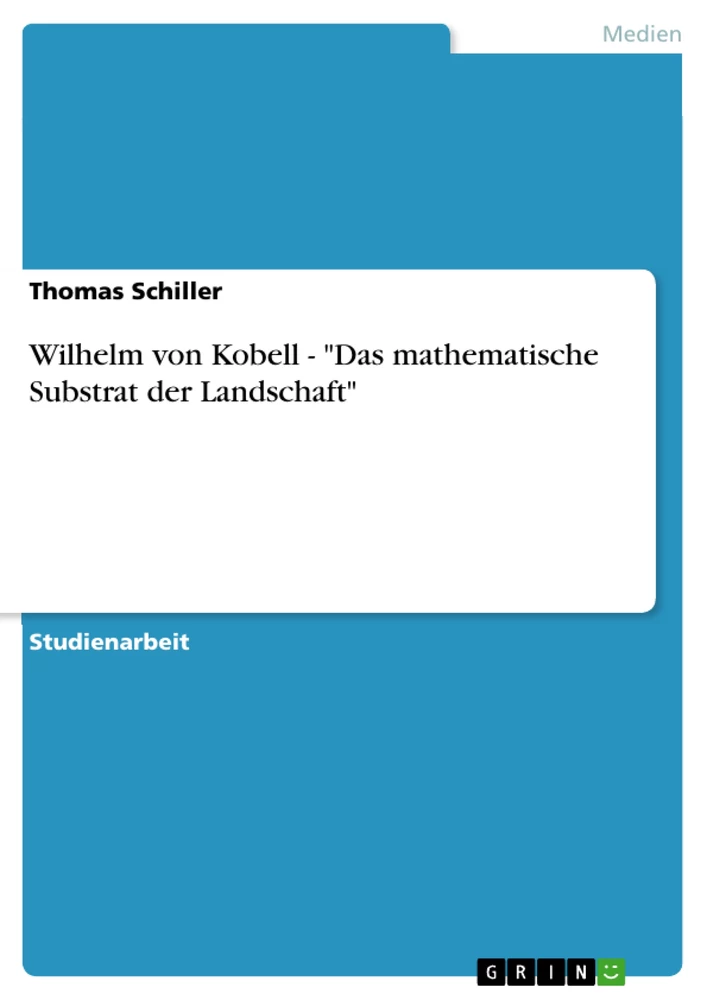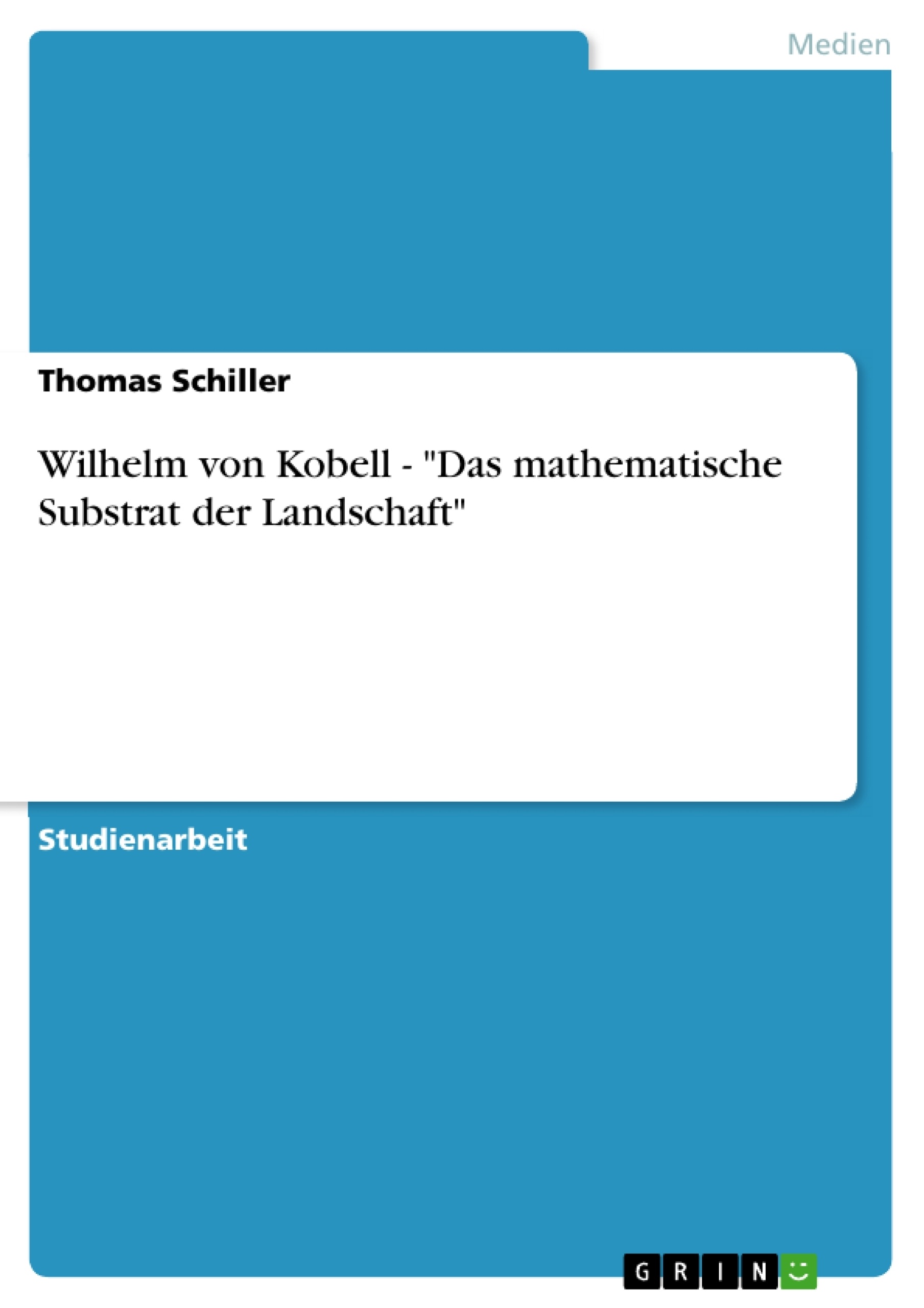„Seit seiner Wiederentdeckung kurz nach der Jahrhundertwende wurde verschiedentlich versucht, seine Kunst, die innerhalb der Münchner Schule eine Sonderstellung einnimmt, zu definieren. Heute [...] ist Wilhelm von Kobell in einem großen Kreis von Museen, Sammlern und Kunstliebhabern hoch geschätzt. So gilt es, die Frage nach dem Wesen und der Bedeutung seiner Malerei, die den Bogen von der Kunst des ausgehenden 18. Jahrhunderts über den Klassizismus unmittelbar in das deutsche Biedermeier spannt, neu zu stellen.“
Diese Aussage Wichmanns, welche die folgende Abhandlung einleitet, bezeugt eine offensichtliche Unsicherheit der Rezipienten bei der Beschäftigung mit dem Werk Wilhelm von Kobells. Dessen eigenwillige Kunstauffassung wird zwar stets betont, doch in der wissenschaftlichen Literatur nur selten intensiv abgehandelt. In vielen Ausstellungskatalogen findet das Kobellsche Schaffen lediglich peripher Erwähnung und im Mangel an Farbbildmaterial setzt sich diese Tendenz fort. Inhaltliche Ausnahmen bilden Waldemar Lessing mit dem ersten monographischen Beitrag, Siegfried Wichmann mit der Erstellung des kritischen Werksverzeichnisses und Sabine Heinens detaillierte Auseinandersetzung mit den späten Kobell – Bildern5. Im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit wird versucht, den Duktus des Malers, das Charakteristische seiner Kunst darzulegen. Nach einem kurzgefassten Überblick über relevante Lebensstationen wird sich seinem Werk genähert. Da Kobell zahlreiche Studien von Landschaft und Milieu in seinen Begegnungsbildern vereint, dient als Betrachtungsbeispiel die Darstellung „Reiter am Tegernsee (I)“, welche beschrieben, analysiert und auf naturwissenschaftliche sowie kulturelle Einflüsse aus der Entstehungszeit untersucht werden soll. Daran schließt ein kursorischer Überblick der Kunstepochen, denen Kobell zu recht oder unrecht zugeordnet wird, wie es das Eingangszitat bereits andeutet. Zusammenfassende Bemerkungen beenden diese Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Lebensbild
- Kobell und die Münchner Schule
- „Der Reiter am Tegernsee“
- Bildbeschreibung
- Bildkomposition
- Lichtregie und Farbe
- Bemerkung zur Arbeitsweise Kobells
- Naturwissenschaftliche und kulturelle Einflüsse
- Philosophische und literarische Einflüsse
- Guckkasten – Diorama – Panorama
- Die Parklandschaft
- Deutungsansätze
- Begegnung unterschiedlicher Stände
- Die Konzentration auf den Blick
- Unsicherheit der Epochenzuordnung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das künstlerische Schaffen Wilhelm von Kobells, insbesondere seine Landschaftsmalerei. Ziel ist es, Kobells eigenwillige Kunstauffassung zu beleuchten und seinen Beitrag zur Münchner Schule zu erörtern. Die Analyse konzentriert sich auf das Gemälde „Reiter am Tegernsee“, um Kobells Arbeitsweise, seine Einflüsse und mögliche Interpretationen zu untersuchen.
- Kobells künstlerischer Werdegang und seine Stellung innerhalb der Münchner Schule
- Analyse von Kobells Landschaftsmalerei anhand des Beispiels „Reiter am Tegernsee“
- Naturwissenschaftliche und kulturelle Einflüsse auf Kobells Werk
- Interpretation und Deutung der Bildmotive
- Die Problematik der Epochenzuordnung von Kobells Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort zitiert Nietzsche und verweist auf die bis dato bestehende Unsicherheit in der Rezeption von Kobells Werk. Es betont die Eigenwilligkeit seiner Kunstauffassung und den Mangel an intensiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung in der Literatur und in Ausstellungskatalogen. Die Hausarbeit möchte Kobells Duktus und die Charakteristika seiner Kunst herausarbeiten.
Lebensbild: Dieses Kapitel skizziert Kobells Leben und künstlerischen Werdegang. Es beginnt mit seiner Herkunft aus einer Künstlerfamilie und seiner Ausbildung. Die Arbeit in Mannheim, die Kopien holländischer Meister, und die spätere Entwicklung hin zu einem eigenständigen Stil in Oberbayern werden beschrieben. Der Abschnitt behandelt auch seine Arbeit an Auftragsarbeiten wie dem Berthier-Zyklus und die anschließende Hinwendung zu den späten Begegnungsbildern, geprägt von den Erfahrungen aus den Schlachtenbildern.
„Der Reiter am Tegernsee“: Dieses Kapitel ist der zentralen Analyse des Bildes "Reiter am Tegernsee" gewidmet. Es umfasst eine detaillierte Bildbeschreibung, die Kompositionsanalyse, die Untersuchung von Lichtregie und Farbe, sowie eine Erörterung von Kobells Arbeitsweise. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der naturwissenschaftlichen und kulturellen Einflüsse, einschließlich philosophischer und literarischer Einflüsse, der Rolle von Guckkasten, Diorama und Panorama, sowie dem Einfluss der Parklandschaft auf seine Kompositionen. Abschließend werden verschiedene Deutungsansätze für das Bild vorgestellt.
Unsicherheit der Epochenzuordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten, Kobells Kunst eindeutig einer bestimmten Epoche zuzuordnen. Es wird auf die Kontroversen und die Uneinigkeit der Forschung eingegangen, die aus der Eigenständigkeit seines Stils resultieren. Die verschiedenen Epochen, denen Kobell zugeschrieben wird, werden kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wilhelm von Kobell, Landschaftsmalerei, Münchner Schule, „Reiter am Tegernsee“, Bildanalyse, Naturwissenschaftliche Einflüsse, Kulturelle Einflüsse, Epochenzuordnung, Biedermeier, Klassizismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Gemäldes "Reiter am Tegernsee" von Wilhelm von Kobell
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das künstlerische Schaffen Wilhelm von Kobells, insbesondere seine Landschaftsmalerei, mit dem Fokus auf dem Gemälde „Reiter am Tegernsee“. Ziel ist die Beleuchtung von Kobells eigenwilliger Kunstauffassung und seinem Beitrag zur Münchner Schule.
Welche Aspekte von Kobells Werk werden untersucht?
Die Analyse umfasst Kobells künstlerischen Werdegang und seine Stellung in der Münchner Schule, eine detaillierte Analyse des Gemäldes „Reiter am Tegernsee“ (Bildbeschreibung, Komposition, Lichtregie, Farbe), die Untersuchung naturwissenschaftlicher und kultureller Einflüsse (Philosophie, Literatur, Guckkasten, Diorama, Panorama, Parklandschaft), sowie verschiedene Deutungsansätze des Bildes und die Problematik der Epochenzuordnung von Kobells Kunst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel zum Lebensbild Kobells, ein zentrales Kapitel zur Analyse des Gemäldes „Reiter am Tegernsee“, ein Kapitel zur Unsicherheit der Epochenzuordnung und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Bildanalyse, um die Komposition, Lichtregie und Farbe des Gemäldes zu untersuchen. Sie berücksichtigt auch kunsthistorische Methoden, um Kobells künstlerischen Werdegang und seine Stellung in der Münchner Schule zu beleuchten und seine Einflüsse zu analysieren. Die Interpretation des Bildes stützt sich auf verschiedene Deutungsansätze.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Analyse des Gemäldes „Reiter am Tegernsee“, beleuchtet die Einflüsse auf Kobells Werk und diskutiert verschiedene Interpretationen des Bildes. Sie thematisiert auch die Schwierigkeiten bei der Epochenzuordnung von Kobells Kunst und hebt seine eigenwillige Kunstauffassung hervor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wilhelm von Kobell, Landschaftsmalerei, Münchner Schule, „Reiter am Tegernsee“, Bildanalyse, Naturwissenschaftliche Einflüsse, Kulturelle Einflüsse, Epochenzuordnung, Biedermeier, Klassizismus.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für die Landschaftsmalerei, die Münchner Schule und das Werk von Wilhelm von Kobell interessieren, insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Kunstwerken.
Welche Bedeutung hat das Vorwort?
Das Vorwort verweist auf die bis dato bestehende Unsicherheit in der Rezeption von Kobells Werk und betont die Eigenwilligkeit seiner Kunstauffassung und den Mangel an intensiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung.
- Citation du texte
- Thomas Schiller (Auteur), 2005, Wilhelm von Kobell - "Das mathematische Substrat der Landschaft", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52104