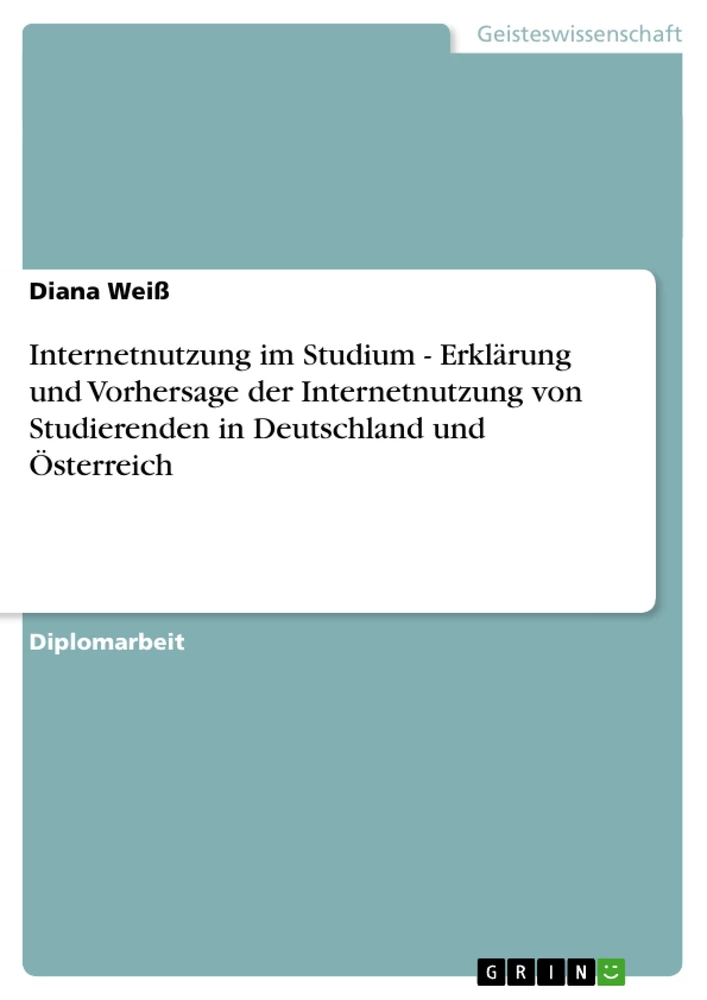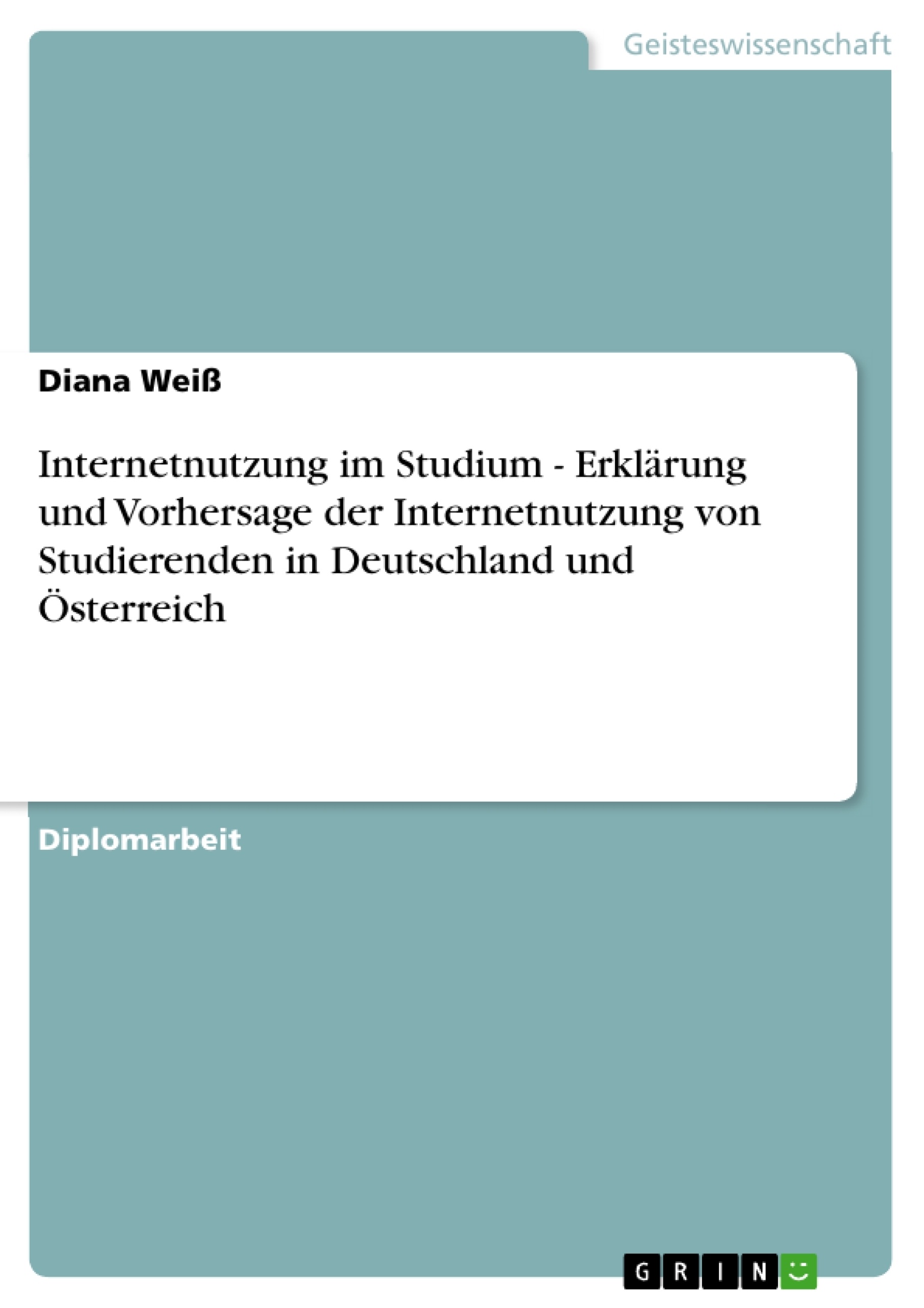Eine bedeutende Anwendergruppe für das Internet sind die Studierenden an den Universitäten. Bereits zu Beginn des Internetzeitalters bildeten die Studierenden einen großen Bereich der Internetnutzer (Batinic, Bosnjak & Breiter, 1997). So ließen sich die Internetnutzer der 90er Jahre als „eine gebildete, vorwiegend akademische Nutzergruppe“ (Batinic et al., 1997) beschreiben. Die Nutzung des Internets für studienrelevante Zwecke, ist mittlerweile aus dem Universitätsalltag nicht mehr wegzudenken. Es hilft, das Studium zu organisieren, erleichtert die Beschaffung von studienrelevanten Informationen und dient zur Kommunikation zwischen Dozenten und Studierenden. Bei der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks im Jahre 2002 belief sich die Nutzungsquote des Internet an den deutsche Hochschulen auf 87 Prozent (Middendorff, 2002). An der Georg-August-Universität in Göttingen gaben 80 Prozent der Studierenden an, das Internet ständig oder oft zu nutzen (Hanekop, 2003).
Das Internet wird auch in Zukunft einen wichtigen Stellenwert in der Universität einnehmen. In Form von internetbasierten Lehr- und Lernplattformen (z.B. Notebook- University) oder Administrations- und Verwaltungsvorgängen (z.B. Rückmeldung, Anmeldung) wird das Internet weiter in den Universitätsalltag hineindrängen (Hanekop, 2003). Um das Internetangebot besser an die Anwender anzupassen, sollten weitere Informationen über ihr Nutzungsverhalten gesammelt werden. Ein Vergleich deutscher Studierender mit ihren österreichischen Nachbarn soll Informationen darüber liefern, wie das weltweite Netz nicht nur im eigenen Land genutzt wird. Fragen, die sich diesbezüglich auftun, sind: Wie häufig setzen die Studierenden das Internet für studienrelevante Zwecke ein? Wie nützlich ist das Internet für das Studium? Wie bewerten Studierende einzelne Onlineanwendungen? Und wie ist die Internetnutzung deutscher Studierender im Vergleich zu ihren österreichischen Nachbarn zu bewerten?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Zielsetzung
- 2. Theoretischer und Empirischer Hintergrund
- 2.1 Medienkompetenz und das Internet als Medium
- 2.2 Internetnutzung
- 2.2.1 Internetnutzung in Deutschland
- 2.2.2 Internetnutzung in Österreich
- 2.2.3 Internetnutzung im europäischen Vergleich
- 2.2.4 Internetnutzung von Studierenden
- 2.2.5 Ein kultureller Vergleich zwischen Deutschland und Österreich
- 2.3 Der theoretische Bezugsrahmen
- 2.3.1 Die Theorie des geplanten Verhaltens nach Aizen
- 2.3.2 Das Technologie-Akzeptanz-Modell nach Davis
- 2.3.3 Die Theorie des geplanten Verhaltens (Aizen) und das Technologie-Akzeptanz-Modell (Davis) im Vergleich
- 2.4 Fragestellung und Ableitung der psychologischen Hypothesen
- 3. Methoden
- 3.1 Der Fragebogen zur Untersuchung „Internetnutzung im Studium“
- 3.1.1 Operationalisierung der Internetnutzung
- 3.1.2 Operationalisierung der theoretischen Variablen
- 3.1.3 Indexbildung
- 3.2 Der Onlinefragebogen zur Untersuchung der „Internetnutzung im Studium-Teil 2“
- 3.2.1 Die tatsächliche Verhaltensausführung
- 3.2.2 Überprüfung der theoretischen Konstrukte auf ihre zeitliche Stabilität
- 3.3 Eine prospektive Erhebung
- 3.3.1 Ablauf der Untersuchung
- 3.4 Zur Güte des Fragebogens
- 3.4.1 Der Pretest
- 3.4.2 Zur internen Konsistenz des Fragebogens
- 4. Darstellung der Ergebnisse
- 4.1 Beschreibung der Stichprobe
- 4.2 Die Internetnutzung deutscher und österreichischer Studierender im Vergleich
- 4.2.1 Bewegungsmuster im Internet
- 4.2.2 Onlineanwendungen
- 4.3 Voraussetzungen der Regressionsanalyse
- 4.3.1 Normalverteilungsannahme
- 4.3.2 Multikollinearität
- 4.3.3 Autokorrelation der Residuen
- 4.4 Korrelationsbildung zwischen den Variablen
- 4.4.1 Die TPB
- 4.4.2 Das TAM
- 4.4.3 Die empirischen Variablen
- 4.5 Einschränkungen bei der Erhebung der Intention
- 4.6 Ergebnisse der Theorie des geplanten Verhaltens nach Aizen zur Vorhersage des Internetverhaltens
- 4.6.1 Intentionsvorhersage
- 4.6.2 Vorhersage des tatsächlichen Verhaltens
- 4.6.3 Die TPB zur Vorhersage des Internetverhaltens
- 4.7 Ergebnisse der Moderatoranalyse zur subjektiven Norm
- 4.8 Ergebnisse des Technologie-Akzeptanz-Modells nach Davis zur Vorhersage des Internetverhaltens
- 4.8.1 Determinanten der Einstellung
- 4.8.2 Intentionsvorhersage
- 4.8.3 Vorhersage des tatsächlichen Verhaltens
- 4.8.4 Das TAM zur Vorhersage des Internetverhaltens
- 4.9 Ergebnisse der Theorie des geplanten Verhaltens nach Aizen und das Technologie-Akzeptanz-Modell nach Davis im Vergleich
- 4.9.1 Intentionsvorhersage
- 4.9.2 Vorhersage des tatsächlichen Verhaltens
- 4.10 Überprüfung der zeitlichen Stabilität der theoretischen Konstrukte
- 5. Diskussion
- 5.1 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
- 5.1.1 Die Internetnutzung deutscher und österreichischer Studierender
- 5.1.2 Die Theorie des geplanten Verhaltens und das Technologie-Akzeptanz-Modell im Vergleich
- 5.1.3 Die Rolle des sozialen Einflusses beim Internetverhalten
- 5.2 Praktische Ableitungen
- 5.3 Limitation der Untersuchung und Ausblick für zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Internetnutzung von Studierenden in Deutschland und Österreich. Ziel ist es, die Internetnutzung zu erklären und vorherzusagen, indem etablierte psychologische Modelle angewendet werden. Die Arbeit analysiert sowohl die Nutzungshäufigkeit und -art als auch die zugrundeliegenden Motive und Einflussfaktoren.
- Vergleichende Analyse der Internetnutzung von Studierenden in Deutschland und Österreich
- Anwendung und Vergleich der Theorie des geplanten Verhaltens und des Technologie-Akzeptanz-Modells
- Identifikation von Determinanten der Internetnutzung im Studium
- Untersuchung des Einflusses sozialer Faktoren auf das Internetverhalten
- Bewertung der Eignung der untersuchten Modelle zur Vorhersage des Internetverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Zielsetzung: Diese Einleitung beschreibt den rasanten Aufstieg des Internets und dessen Bedeutung für Studierende. Sie betont die zunehmende Relevanz des Internets im Studium und führt in die Forschungsfrage ein, die sich mit der Erklärung und Vorhersage der Internetnutzung von Studierenden in Deutschland und Österreich befasst. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Einflussfaktoren und der Anwendung psychologischer Modelle zur Erklärung des Nutzungsverhaltens.
2. Theoretischer und Empirischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die relevante Literatur zur Internetnutzung, Medienkompetenz, und den ausgewählten theoretischen Modellen: die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) nach Ajzen und das Technologie-Akzeptanz-Modell (TAM) nach Davis. Es werden empirische Befunde zur Internetnutzung in Deutschland, Österreich und im europäischen Vergleich präsentiert, mit besonderem Augenmerk auf die Nutzung durch Studierende und einen Vergleich der beiden untersuchten Länder. Die Kapitel legt die Grundlage für die Ableitung der Forschungsfragen und Hypothesen.
3. Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie. Es präsentiert die Konstruktion und Validierung des Fragebogens, der sowohl die Internetnutzung als auch die relevanten Variablen der TPB und TAM erfasst. Die Durchführung der Untersuchung, einschließlich der Stichprobenbeschreibung und der Datenanalysemethoden, wird erläutert. Die Güte des Fragebogens wird durch einen Pretest und die Überprüfung der internen Konsistenz abgesichert. Der methodische Ansatz der prospektiven Erhebung wird ebenfalls detailliert erklärt.
4. Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beginnt mit der Beschreibung der Stichprobe und einem Vergleich der Internetnutzung deutscher und österreichischer Studierender. Anschließend werden die Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Prüfung der TPB und TAM vorgestellt. Die Ergebnisse werden detailliert diskutiert, einschließlich der Prüfung von Moderatorvariablen und der Überprüfung der zeitlichen Stabilität der Konstrukte. Die Kapitel zeigt den Grad der Vorhersagekraft beider Modelle hinsichtlich der Internetnutzung auf.
5. Diskussion: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Implikationen. Es wird ein Vergleich der beiden theoretischen Modelle gezogen und die Rolle sozialer Einflüsse auf das Internetverhalten der Studierenden beleuchtet. Schlussendlich werden Limitationen der Studie benannt und Ausblicke für zukünftige Forschung gegeben.
Schlüsselwörter
Internetnutzung, Studierende, Deutschland, Österreich, Theorie des geplanten Verhaltens, Technologie-Akzeptanz-Modell, Medienkompetenz, soziale Einflüsse, empirische Untersuchung, Regressionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Internetnutzung von Studierenden in Deutschland und Österreich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Internetnutzung von Studierenden in Deutschland und Österreich. Sie analysiert die Nutzungshäufigkeit und -art, die zugrundeliegenden Motive und Einflussfaktoren und vergleicht die Internetnutzung zwischen deutschen und österreichischen Studierenden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Internetnutzung von Studierenden zu erklären und vorherzusagen. Dafür werden etablierte psychologische Modelle, die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) und das Technologie-Akzeptanz-Modell (TAM), angewendet und miteinander verglichen. Die Arbeit identifiziert Determinanten der Internetnutzung im Studium und untersucht den Einfluss sozialer Faktoren.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) nach Ajzen und dem Technologie-Akzeptanz-Modell (TAM) nach Davis. Diese Modelle werden verwendet, um die Internetnutzung vorherzusagen und die zugrundeliegenden psychologischen Prozesse zu verstehen.
Wie wurde die Studie durchgeführt?
Die Studie verwendet einen Fragebogen, der online an Studierende in Deutschland und Österreich verteilt wurde. Der Fragebogen erfasst die Internetnutzung, die relevanten Variablen der TPB und TAM sowie soziodemografische Daten. Die Datenanalyse beinhaltet deskriptive Statistiken und Regressionsanalysen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert einen Vergleich der Internetnutzung zwischen deutschen und österreichischen Studierenden. Die Regressionsanalysen zeigen den Vorhersagewert der TPB und TAM für das Internetverhalten. Es wird untersucht, wie gut die Modelle die Intention und das tatsächliche Verhalten vorhersagen können. Die Rolle der subjektiven Norm als Moderatorvariable wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Implikationen für die Praxis und die zukünftige Forschung. Sie vergleicht die Vorhersagekraft der TPB und TAM und beleuchtet die Rolle sozialer Einflüsse. Limitationen der Studie und Ausblicke für zukünftige Forschungsarbeiten werden ebenfalls dargestellt.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst fünf Kapitel: Einleitung und Zielsetzung, Theoretischer und Empirischer Hintergrund, Methoden, Darstellung der Ergebnisse und Diskussion. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschung, von der Einleitung der Forschungsfrage bis zur Diskussion der Ergebnisse und deren Implikationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Internetnutzung, Studierende, Deutschland, Österreich, Theorie des geplanten Verhaltens, Technologie-Akzeptanz-Modell, Medienkompetenz, soziale Einflüsse, empirische Untersuchung, Regressionsanalyse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Internetnutzung, Medienkompetenz, und der Anwendung psychologischer Modelle auf das Verhalten beschäftigen. Sie ist auch relevant für Praktiker, die an der Förderung einer sinnvollen Internetnutzung interessiert sind.
- Citar trabajo
- Diana Weiß (Autor), 2005, Internetnutzung im Studium - Erklärung und Vorhersage der Internetnutzung von Studierenden in Deutschland und Österreich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52199