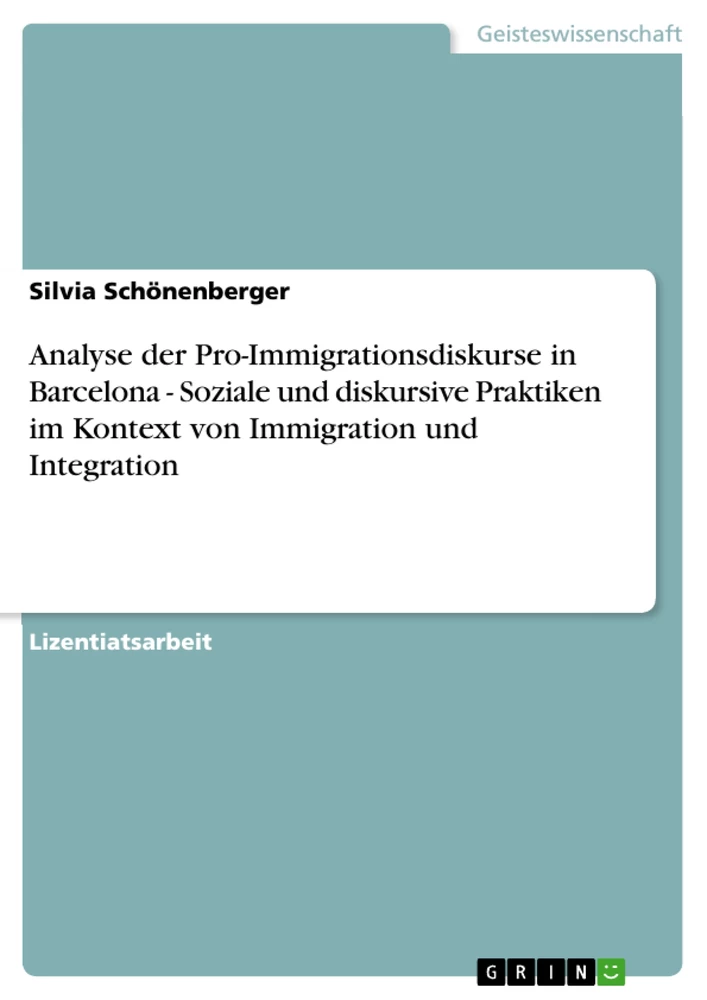Definieren des Forschungsziels
Diese Forschungsarbeit soll einen Beitrag für einen verständnisvolleren Umgang mit dem Immigrationsphänomen leisten. Es geht um die Erfassung der Sichtweisen und Problemwahrnehmungen der ansässigen spanischen Bevölkerung auf das noch relativ neuartige Einwanderungsphänomen. Der Fokus wird dabei auf den Teil der Bevölkerung gelegt, der sich durch seine „offene“ Haltung gegenüber den ImmigrantInnen charakterisiert. Über die Erforschung der sozialen Praktiken und diskursiven Handlungen im Feld der Immigrations- und Integrationsdebatte soll dieser Beitrag die vorhandenen Potentiale der engagierten Akteure erfassen.
Der Zugang zu diesem Forschungsgegenstand kann am besten über qualitative Forschungsmethoden erlangt werden, da es sich um eine mehr oder weniger klar abgegrenzte Akteursgruppe handelt. Konkret soll hier der Pro-Immigrationsdiskurs1 erfasst und analysiert werden. Räumlich schränkt sich diese Forschung auf eine Stadt (Barcelona), und zeitlich auf eine Periode von mehr oder weniger einem Jahr ein.
Die Annahme, dass Diskurse sowohl sozial konstituiert, aber gleichzeitig auch sozial konstitutiv sind, bedeutet, dass die Beteiligung an einem Diskurs einer sozialen Handlung gleichkommt (Fairclaugh/ Wodak 1997). Indem Menschen diskursiv handeln, formen sie ihren Kontext mit. Dieses Verständnis von diskursivem Handeln ist zentral, um die Macht oder den Einfluss des Diskurses zu verstehen, die er auf die Umgebung ausüben kann. Für diese Untersuchung ist dies insofern von Bedeutung, als dass im Pro-Immigrationsdiskurs ein Potential für eine alternative, positivere Umgangsweise mit dem Thema Immigration gesehen wird. So lassen sich aus den Diskursen Handlungsbedarf und Forderungen der Akteure nach einem sozialen Wandel ableiten.
Neben der Erfassung der sozialen Handlungen, der Aktionen und Programme der engagierten Akteure und Institutionen, erlaubt die Ergänzung durch eine Analyse des Diskurses rund um diese Praktiken, hinter die blossen Taten zu sehen und zu erfahren, welche ideologischen Denkmuster vorhanden sind, und wie die Akteure über ihre soziale Umwelt denken. Wie sich dieser hier fokussierte Subdiskurs in die diskursive Ordnung eingliedert, unter welchen Machtverhältnissen er steht und welches Potential von ihm ausgeht, sind Fragen, die diese Studie ebenfalls zu beantworten versucht (siehe dazu Fairclough 1992, Bourdieu 1984; 1991).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Definieren des Forschungsziels
- 1.2. Relevanz des Forschungsbeitrages
- 1.3. Forschungsstand und Einbettung des Forschungsbeitrages
- 1.4. Eingrenzung des Forschungsfeldes
- 1.5. Zentrale Forschungsfragen
- 1.6. Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Theoretische Hintergründe der Diskursanalyse
- 2.1.1. Soziale Konstruktion von Wirklichkeit
- 2.1.2. Soziale Handlung und speech act
- 2.1.3. Diskurs als soziale Handlung
- 2.1.4. Verschiedene Ansätze der Diskursforschung
- 2.2. Kritische Diskursanalyse
- 2.2.1. Kritik an und im Diskurs
- 2.2.2. Macht und Diskurs
- 2.2.3. Ideologie und Diskurs
- 2.3. Neue Soziale Bewegung, Ideologie und Diskurs
- 2.3.1. Neue Soziale Bewegung und Unterstützung der ImmigrantInnen
- 2.3.2. Solidarisierung, Neue Soziale Bewegung und Partizipation
- 2.4. Diskursive Ebene des Immigrationsphänomens
- 2.4.1. Der Diskurs der ImmigrantInnen
- 2.4.2. Der rassistische Diskurs
- 2.4.3. Öffentliche Meinung zum Thema Immigration
- 2.4.4. Diskursive Logiken des „engagierten Diskurses“
- 2.4.5. Autorität in der Diskursgemeinschaft
- 2.4.6. Neue Technologien als Mittel der diskursiven Praktiken
- 3. Methodisches Vorgehen
- 3.1. Wahl der methodischen Vorgehensweise
- 3.1.1. Qualitative Forschung
- 3.1.2. Ansatz der Grounded Theory
- 3.1.3. Das Prozessmodell der Grounded Theory
- 3.1.4. Methodische Vorgehensweise der Kritischen Diskursanalyse
- 3.2. Konkrete Forschungsfragen
- 3.3. Sondierung des Forschungsfeldes und der Diskursebene
- 3.4. Datenerhebung
- 3.4.1. Diskursgemeinschaft und Sampleauswahl
- 3.4.2. Datenauswahl und Korpusbildung
- 3.4.3. Teilnehmende Beobachtung, Feldnotitzen und Feldtagebuch
- 3.4.4. Textliche Daten
- 3.4.5. Interviews
- 3.4.6. Datenanalyse
- 3.5. Geltungsbegründung
- 4. Annäherung ans Forschungsfeld
- 4.1. Sozialhistorischer Kontext der Immigration
- 4.2. Besonderheiten der Immigration in Barcelona
- 4.3. Kontext der Immigrationspolitik in Spanien
- 4.4. Kontext der Integrationspolitik
- 4.5. Netzwerke und Rolle der Zivilgesellschaft in Barcelona
- 5. Empirischer Teil
- 5.1. Soziale Praktiken im Bereich Immigration
- 5.1.1. Das Netzwerk der Institutionen im Immigrationsbereich
- 5.1.2. Soziale Bewegung der Unterstützung?
- 5.1.3. Struktur und Organisation der sozialen Bewegung
- 5.2. Der Pro-Immigrationsdiskurs
- 5.2.1. Konjunktur und Dynamik des Diskurses
- 5.3. Schlüsselereignisse und deren diskursive Reproduktion
- 5.3.1. Der ausserordentliche Regularisierungsprozess
- 5.3.2. Grenzüberschreitungen in Ceuta und Melilla
- 5.4. Diskursinhalt
- 5.4.1. Wahrnehmungen des Migrationsphänomens
- 5.4.2. Diskursvarianten und Problemwahrnehmung von Limiten und Grenzkontrollen
- 5.4.3. Problemwahrnehmung des Ausländergesetzes
- 5.4.4. Problemwahrnehmung des interkulturellen Zusammenlebens
- 5.5. Diskursstrategien
- 5.5.1. Argumentationsstrategien
- 5.5.2. Bilder, Bezeichnungen und Rollen für „ImmigrantInnen“
- 5.5.3. Rhetorisch-stilistische Merkmale
- 5.6. Ideologische Merkmale der Diskursvarianten
- 5.7. Einbettung der Diskursvarianten in den Gesamtdiskurs
- 5.7.1. Intradiskursive Differenzen nach Akteuren und Standpunkten
- 5.7.2. Verhältnis zum dominanten Immigrationsdiskurs
- 5.7.3. Diskursive Wirkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Pro-Immigrationsdiskurse in Barcelona, analysiert soziale und diskursive Praktiken im Kontext von Immigration und Integration und zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der verschiedenen Akteure, Strategien und ideologischen Hintergründe dieser Diskurse zu entwickeln.
- Analyse von Pro-Immigrationsdiskursen in Barcelona
- Untersuchung sozialer Praktiken im Kontext von Immigration und Integration
- Identifizierung von Akteuren und deren Strategien innerhalb der Diskurse
- Analyse der ideologischen Grundlagen der Pro-Immigrationsdiskurse
- Beziehung zwischen Diskursen und sozialer Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein, definiert das Forschungsziel, erläutert die Relevanz der Forschung, beschreibt den Forschungsstand und die Einbettung des Forschungsbeitrags, grenzt das Forschungsfeld ein, formuliert zentrale Forschungsfragen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es legt die Grundlage für die anschließende, detaillierte Untersuchung der Pro-Immigrationsdiskurse in Barcelona.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel etabliert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es behandelt verschiedene Ansätze der Diskursanalyse, insbesondere die kritische Diskursanalyse, und analysiert den Zusammenhang zwischen neuen sozialen Bewegungen, Ideologie und Diskurs im Kontext von Immigration. Die verschiedenen theoretischen Konzepte werden systematisch dargelegt und bilden das analytische Werkzeug für die Untersuchung des empirischen Materials.
3. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die gewählte methodische Vorgehensweise, die sich auf qualitative Forschung, Grounded Theory und die kritische Diskursanalyse stützt. Es erläutert die konkreten Forschungsfragen, die Sondierung des Forschungsfeldes, die Datenerhebungsmethoden (teilnehmende Beobachtung, Interviews, Textanalyse) und die Datenanalyse. Der methodische Ansatz wird transparent dargelegt und seine Eignung zur Beantwortung der Forschungsfragen begründet.
4. Annäherung ans Forschungsfeld: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den sozialhistorischen Kontext der Immigration in Barcelona, die Besonderheiten der Immigration in dieser Stadt, sowie den Kontext der spanischen Immigrations- und Integrationspolitik. Die Rolle der Zivilgesellschaft und die bestehenden Netzwerke werden ebenfalls beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis des sozialen Umfelds zu schaffen.
5. Empirischer Teil: Der Kern der Arbeit, dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse. Es analysiert soziale Praktiken im Bereich Immigration, den Pro-Immigrationsdiskurs, Schlüsselereignisse und deren diskursive Reproduktion, den Diskursinhalt, Diskursstrategien, und die ideologischen Merkmale der Diskursvarianten. Es setzt die theoretischen Konzepte aus Kapitel 2 auf das empirische Material an und analysiert die Beziehungen zwischen verschiedenen Akteuren und Standpunkten innerhalb des Gesamtdiskurses.
Schlüsselwörter
Pro-Immigrationsdiskurse, Barcelona, Immigration, Integration, Diskursanalyse, Kritische Diskursanalyse, Qualitative Forschung, Grounded Theory, Soziale Bewegungen, Ideologie, Macht, Diskursstrategien, soziale Praktiken, Spanien, Immigrationspolitik, Integrationspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Pro-Immigrationsdiskursen in Barcelona
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Pro-Immigrationsdiskurse in Barcelona. Sie untersucht die sozialen und diskursiven Praktiken im Kontext von Immigration und Integration und zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der verschiedenen Akteure, Strategien und ideologischen Hintergründe dieser Diskurse zu entwickeln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse von Pro-Immigrationsdiskursen in Barcelona, die Untersuchung sozialer Praktiken im Kontext von Immigration und Integration, die Identifizierung von Akteuren und deren Strategien innerhalb der Diskurse, die Analyse der ideologischen Grundlagen der Pro-Immigrationsdiskurse und die Beziehung zwischen Diskursen und sozialer Wirklichkeit.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, insbesondere Grounded Theory und die Kritische Diskursanalyse. Die Datenerhebung umfasst teilnehmende Beobachtung, Interviews und Textanalysen. Die Datenanalyse folgt dem Prozessmodell der Grounded Theory.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf verschiedenen Ansätzen der Diskursanalyse, insbesondere der Kritischen Diskursanalyse. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen neuen sozialen Bewegungen, Ideologie und Diskurs im Kontext von Immigration. Konzepte wie soziale Konstruktion von Wirklichkeit, soziale Handlung und Speech Act werden behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (Forschungsziel, Relevanz, Forschungsstand, Forschungsfragen), Theoretischer Rahmen (Diskursanalyse, Kritische Diskursanalyse, Neue Soziale Bewegungen), Methodisches Vorgehen (qualitative Forschung, Grounded Theory, Datenerhebung und -analyse), Annäherung ans Forschungsfeld (sozialhistorischer Kontext, Immigrations- und Integrationspolitik in Spanien, Rolle der Zivilgesellschaft) und Empirischer Teil (Analyse sozialer Praktiken, Pro-Immigrationsdiskurs, Schlüsselereignisse, Diskursinhalt, Diskursstrategien, Ideologie).
Welche Schlüsselereignisse werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den ausserordentlichen Regularisierungsprozess und Grenzüberschreitungen in Ceuta und Melilla und deren diskursive Reproduktion.
Welche Akteure werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Akteure innerhalb der Pro-Immigrationsdiskurse, ohne diese explizit zu benennen. Die Analyse konzentriert sich auf deren Strategien und Standpunkte im Diskurs.
Welche ideologischen Merkmale werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die ideologischen Merkmale der verschiedenen Diskursvarianten und deren Einbettung in den Gesamtdiskurs, einschließlich der intradiskursiven Differenzen nach Akteuren und Standpunkten und des Verhältnisses zum dominanten Immigrationsdiskurs.
Welchen Kontext bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Kontext, der den sozialhistorischen Kontext der Immigration in Barcelona, die Besonderheiten der Immigration in dieser Stadt, den Kontext der spanischen Immigrations- und Integrationspolitik sowie die Rolle der Zivilgesellschaft und bestehender Netzwerke beinhaltet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die verschiedenen Akteure, Strategien und ideologischen Hintergründe der Pro-Immigrationsdiskurse in Barcelona, und ihre Beziehung zur sozialen Wirklichkeit. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text der Arbeit detailliert dargestellt.
- Quote paper
- Silvia Schönenberger (Author), 2006, Analyse der Pro-Immigrationsdiskurse in Barcelona - Soziale und diskursive Praktiken im Kontext von Immigration und Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52217