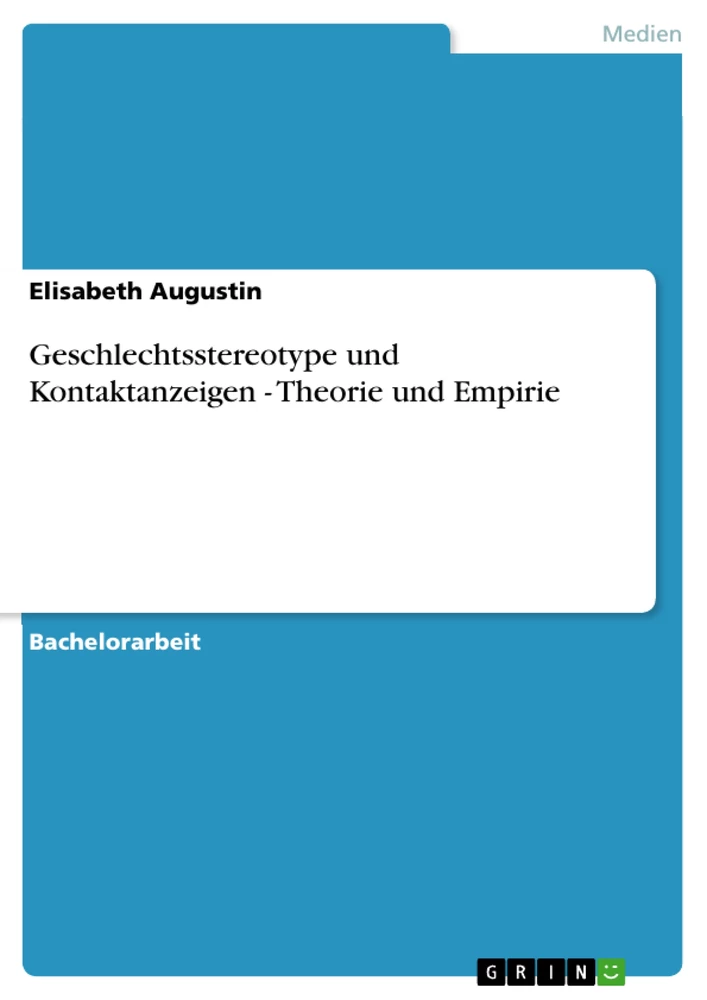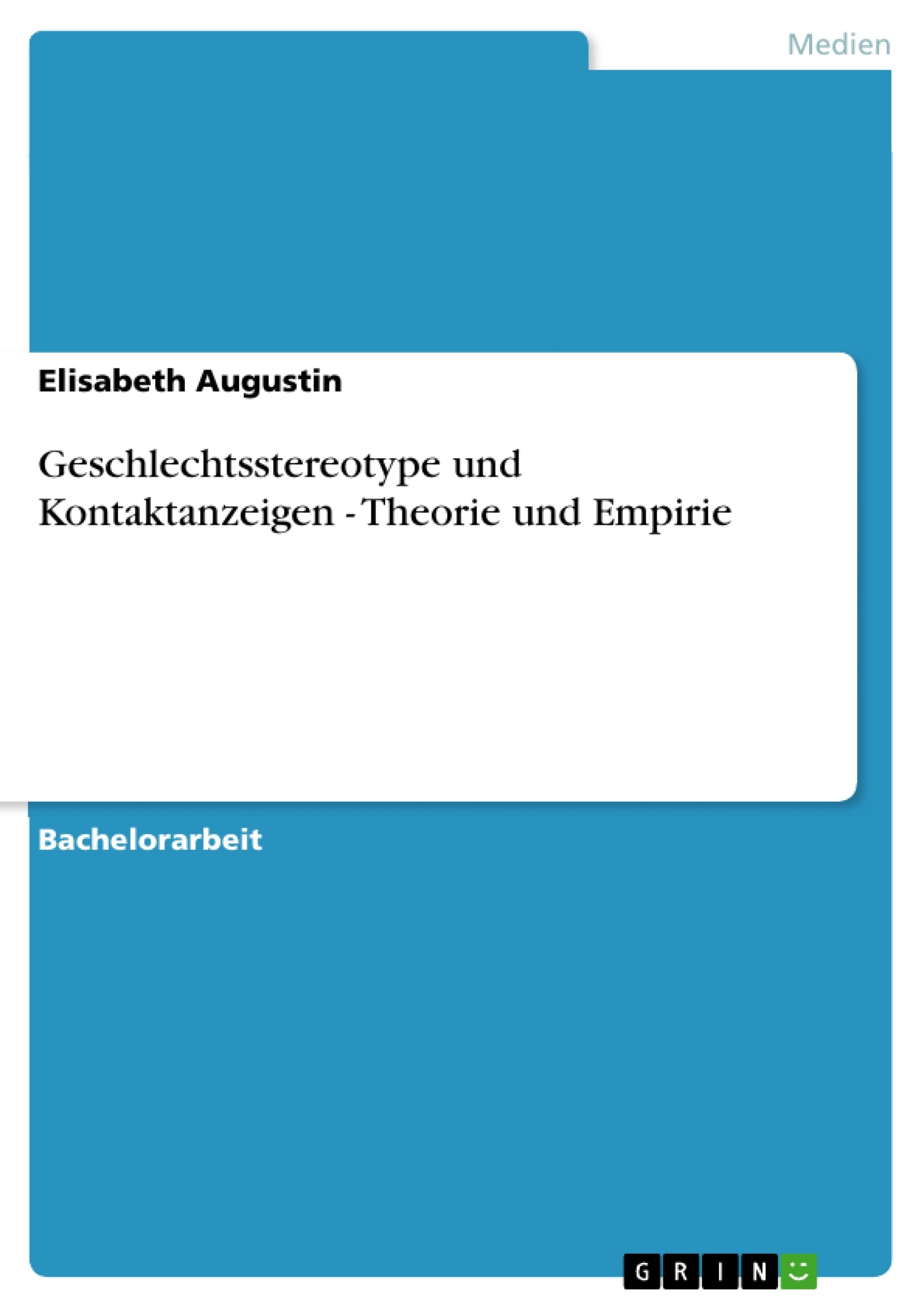Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine, zunächst theoretische, Annäherung an das Thema Geschlechtsstereotype. Der Komplex Kontaktanzeigen soll kommunikations-wissenschaftlich und in Bezug auf Geschlechtsstereotype abgehandelt werden. In einem empirischen Teil werden eigene Forschungsergebnisse zu Detailfragen vorgestellt. Die empirische Untersuchung beschäftigt sich exemplarisch mit den beiden österreichischen Tageszeitungen Der Standard und die Neue Kronen Zeitung. Die Daten stammen aus dem Herbst 2004.
In der Kommunikationsforschung gibt es, vor allem seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, eine lange Tradition der Erforschung von Kontaktanzeigen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass über Kontaktanzeigen gesellschaftliche Konstellationen und Bedingungen beschrieben werden können. Inserate zur Partnersuche wurden häufig stark kritisiert und sind auch aus einer feministischen Perspektive heraus ins Interesse von Studien gerückt. Ob positiv oder negativ bewertet, Kontaktanzeigen begegnen uns permanent in Tageszeitungen und anderen Medien. Sie stellen für Zeitungen eine Einnahmequelle dar (in der Kronen Zeitung zum Beispiel erscheinen täglich Kontaktanzeigen), und für Partnersuchende eine Möglichkeit, in einer zunehmend anonymen und unübersichtlichen Gesellschaft einen Partner/eine Partnerin zu finden. Auf die gesellschaftliche Relevanz des Themas weisen auch eine steigende Zahl von Dating-Shows im Fernsehen und zunehmende Möglichkeiten zur Partnersuche im Internet hin. Kontaktanzeigen eigenen sich für eine Studie besonders gut, da bei der Schaltung nicht mit einer wissenschaftlichen Untersuchung gerechnet wird. Das Material ist leicht zugänglich und von vornherein anonymisiert. Eine sehr große Zahl von Fragestellung ist möglich.
Den Beginn der Arbeit bildet ein Einblick in die Geschlechterforschung, die Gender Studies. Fragestellungen und Theorien der Geschlechterforschung stellen die Basis der vorliegenden Arbeit dar und sind für das Verständnis der Arbeit, wie für das Entstehen der Forschungsfrage grundlegend.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das soziale Geschlecht – eine Einführung in die Gender Studies
- Geschlechterstereotype und Geschlechterrollen
- Der Erwerb von Geschlechtsstereotypen
- Geschlechterrollen
- Kontaktanzeigen
- Begriffsbestimmungen und kommunikationswissenschaftliche Beschreibung
- Geschichtlicher Abriss
- Ergebnisse bisheriger Studien zu Kontaktanzeigen – eine Auswahl
- Empirische Analyse: Kontaktanzeigen in österreichischen Tageszeitungen
- Forschungsfragen und Ergebnisse
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Geschlechtsstereotype aus einer theoretischen Perspektive zu betrachten und den Bereich der Kontaktanzeigen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf Geschlechtsstereotype. Die Arbeit präsentiert eigene Forschungsergebnisse zu Detailfragen und untersucht anhand zweier österreichischer Tageszeitungen, Der Standard und die Neue Kronen Zeitung, die Thematik empirisch. Die Daten stammen aus dem Herbst 2004.
- Die Rolle von Geschlechtsstereotypen in der Kommunikation
- Die Darstellung von Geschlechtsrollen in Kontaktanzeigen
- Die Analyse von Kontaktanzeigen als Spiegelbild gesellschaftlicher Normen und Werte
- Die empirische Untersuchung von Geschlechtsstereotypen in österreichischen Tageszeitungen
- Die Relevanz von Kontaktanzeigen für die Partnersuche in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel bietet eine Einführung in die Gender Studies, beleuchtet die Entstehung des Begriffs "Gender" und erklärt die Unterscheidung zwischen "sex" und "gender". Das dritte Kapitel widmet sich den Geschlechterstereotypen und Geschlechterrollen, wobei der Fokus auf dem Erwerb von Geschlechtsstereotypen und den verschiedenen Ausprägungen von Geschlechterrollen liegt. Das vierte Kapitel behandelt Kontaktanzeigen, untersucht deren Begriffsbestimmung und kommunikationswissenschaftliche Beschreibung, geht auf die historische Entwicklung ein und stellt Ergebnisse bisheriger Studien vor. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse von Kontaktanzeigen in österreichischen Tageszeitungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Geschlechtsstereotype, Gender Studies, Kontaktanzeigen, Kommunikationswissenschaft, empirische Forschung, österreichische Tageszeitungen, gesellschaftliche Normen, Partnersuche, und Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen
Wie spiegeln Kontaktanzeigen Geschlechtsstereotype wider?
Kontaktanzeigen dienen als Spiegel gesellschaftlicher Normen, in denen Männer und Frauen oft stereotype Rollenerwartungen an Partner und sich selbst formulieren.
Was ist der Unterschied zwischen „Sex“ und „Gender“?
In den Gender Studies bezeichnet „Sex“ das biologische Geschlecht, während „Gender“ das sozial konstruierte Geschlecht und die damit verbundenen Rollen meint.
Welche Zeitungen wurden in der empirischen Studie untersucht?
Die Untersuchung analysierte Kontaktanzeigen aus den österreichischen Tageszeitungen „Der Standard“ und „Neue Kronen Zeitung“ aus dem Jahr 2004.
Warum eignen sich Kontaktanzeigen gut für die Forschung?
Sie sind leicht zugänglich, anonymisiert und die Verfasser agieren natürlich, da sie nicht mit einer wissenschaftlichen Untersuchung rechnen.
Welche gesellschaftliche Relevanz hat die Partnersuche in Medien?
In einer zunehmend anonymen Gesellschaft bieten Medien (Zeitungen, Dating-Shows, Internet) wichtige Plattformen zur Partnerfindung.
- Citar trabajo
- Elisabeth Augustin (Autor), 2005, Geschlechtsstereotype und Kontaktanzeigen - Theorie und Empirie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52486