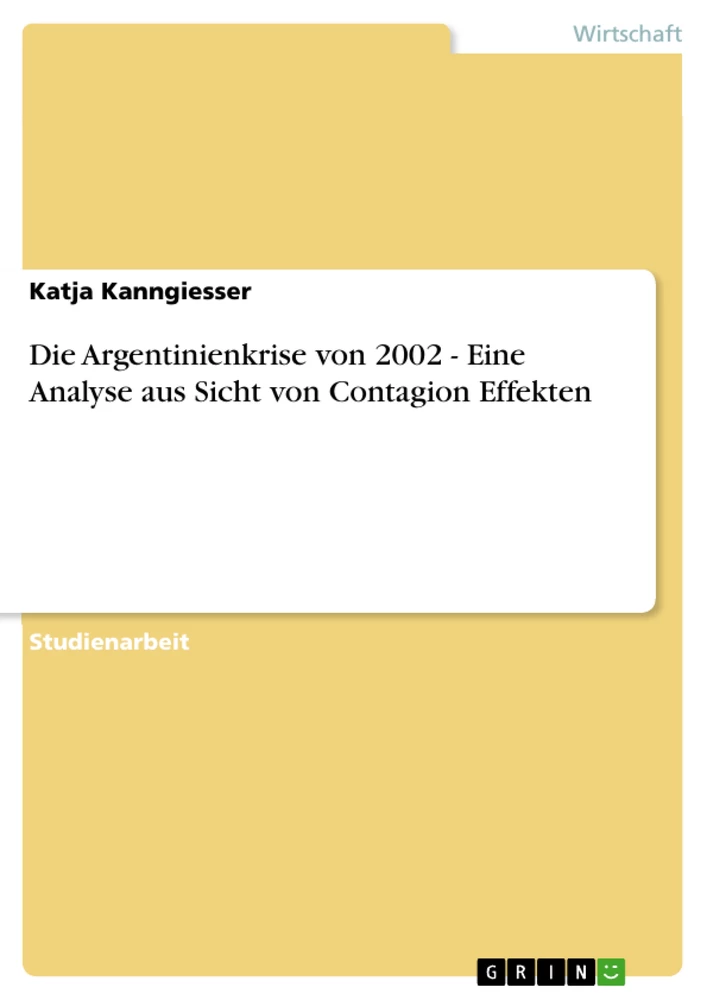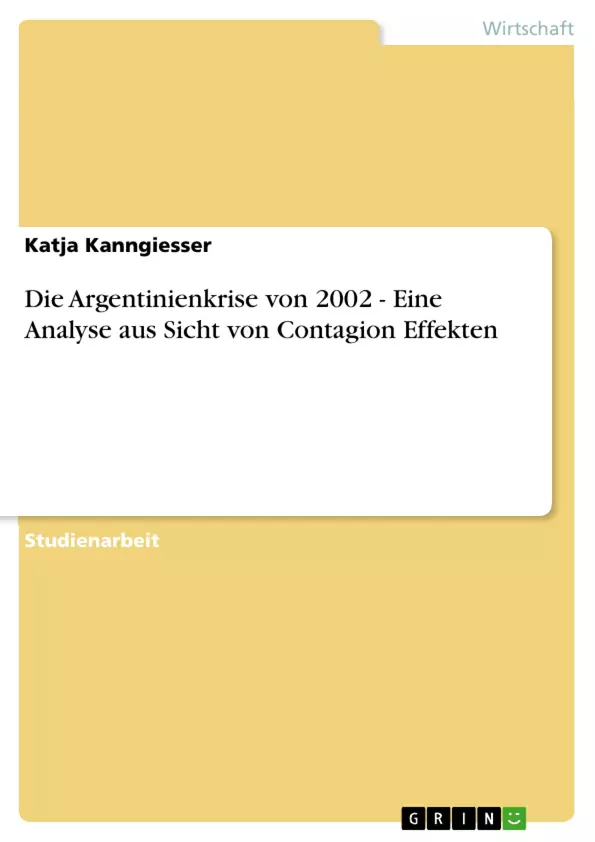Zu Beginn des Jahres 2002 gab Argentinien sein Currency Board (CB) mit einer festen Wechselkursbindung an den US-Dollar auf und ging zu einem flexiblen Wechselkurssystem über. Die argentinische Währung verlor fast 75 Prozent an Wert und das Land stürzte in die schwerste Krise, die es in seiner Geschichte erlebt hat. Diese Krise betraf nicht nur die Ökonomie, sie belastete auch die sozialen Verhältnisse, die politische Ebene und die internationalen Beziehungen zu anderen Nationen. Die Instabilität der globalen Finanzmärkte war und ist aus ökonomischer Sicht eines der zentralsten Probleme des letzten Jahrzehnts. Obwohl bereits Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre Währungs-, Banken- und Finanzkrisen, vorwiegend in Südamerika auftraten, sind die Krisen in den neunziger Jahren ungleich heftiger ausgefallen und in ihrer Erscheinungsform sehr verschieden. Neu an den Krisen der neunziger Jahre ist, dass kaum eine Krise vorhergesehen wurde und dass sich die Turbulenzen nicht auf ein nationales Finanzsystem beschränkten, sondern zumindest regionale oder sogar globale Implikationen hatten. Krisen wie die EWS-Krise mit sechzehn betroffenen Ländern, die Tequila-Krise mit neun, die Asienkrise mit zehn, die Russland-Krise mit dreizehn und schließlich die Argentinienkrise mit acht betroffenen Ländern haben zu der Überzeugung geführt, dass nationale Krisen andere Länder, die „gesund“ sind, anstecken können. In der englischsprachigen Literatur ist dieser Effekt als „Contagion“ bekannt. Ziel dieser Arbeit ist es, eine theoretische Einführung in das Konzept Contagion zu liefern und mögliche Ursachen und Übertragungsmechanismen von Contagion-Effekten am Beispiel Argentiniens zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Erklärungsmodelle für die Übertragung von Währungskrisen
- Der Begriff Contagion
- Formen der Übertragung von Währungskrisen
- Fundamentale Verflechtungen
- Herdenverhalten
- Institutionelles Contagion
- Die Argentinienkrise und Contagion-Effekte
- Ursachen, Merkmale und Ablauf der Argentinienkrise
- Contagion-Effekte in Lateinamerika
- Zusammenfassende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die argentinische Währungskrise im Jahr 2002 unter dem Aspekt von Contagion-Effekten. Zielsetzung ist es, das Konzept Contagion einzuführen und die möglichen Ursachen sowie Übertragungsmechanismen dieser Effekte im Kontext der Argentinienkrise zu untersuchen.
- Der Begriff Contagion und seine Bedeutung in der Finanzwirtschaft
- Verschiedene Formen und Mechanismen der Übertragung von Währungskrisen
- Analyse der Argentinienkrise und ihre möglichen Contagion-Effekte in Lateinamerika
- Bedeutung des Herdenverhaltens und institutioneller Faktoren für die Ausbreitung von Krisen
- Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Zielsetzung der Analyse der Argentinienkrise im Kontext von Contagion-Effekten erläutert. Im zweiten Kapitel wird das Konzept Contagion näher betrachtet und verschiedene Formen der Übertragung von Währungskrisen vorgestellt. Hier werden die verschiedenen Mechanismen wie fundamentale Verflechtungen, Herdenverhalten und institutionelles Contagion behandelt.
Das dritte Kapitel fokussiert sich auf die Argentinienkrise selbst und untersucht die Ursachen, Merkmale und den Ablauf der Krise. Dabei wird die Frage gestellt, ob und welche Contagion-Effekte in Lateinamerika aufgrund der Argentinienkrise auftraten.
Schlüsselwörter
Contagion, Währungskrisen, Argentinienkrise, Lateinamerika, Übertragungsmechanismen, Herdenverhalten, institutionelles Contagion, fundamentale Verflechtungen, Spillover-Effekte, Currency Board.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Contagion-Effekt" in der Wirtschaft?
Contagion (Ansteckung) beschreibt das Phänomen, bei dem eine nationale Finanz- oder Währungskrise auf andere, eigentlich "gesunde" Länder übergreift, sei es regional oder global.
Was war die Ursache der Argentinienkrise im Jahr 2002?
Auslöser war die Aufgabe des Currency Boards (feste Bindung an den US-Dollar). Die Währung verlor 75% an Wert, was zu einer schweren ökonomischen, sozialen und politischen Krise führte.
Welche Übertragungsmechanismen für Krisen gibt es?
Zu den Mechanismen gehören fundamentale wirtschaftliche Verflechtungen, das Herdenverhalten von Investoren sowie institutionelles Contagion.
Welche anderen Länder waren historisch von Contagion betroffen?
Beispiele sind die EWS-Krise (16 Länder), die Tequila-Krise (9 Länder), die Asienkrise (10 Länder) und die Russland-Krise (13 Länder).
Wie wirkte sich die Argentinienkrise auf Lateinamerika aus?
Die Arbeit analysiert im dritten Kapitel spezifisch, welche regionalen Auswirkungen und Ansteckungseffekte die Krise innerhalb Lateinamerikas nach sich zog.
- Quote paper
- Katja Kanngiesser (Author), 2005, Die Argentinienkrise von 2002 - Eine Analyse aus Sicht von Contagion Effekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52668