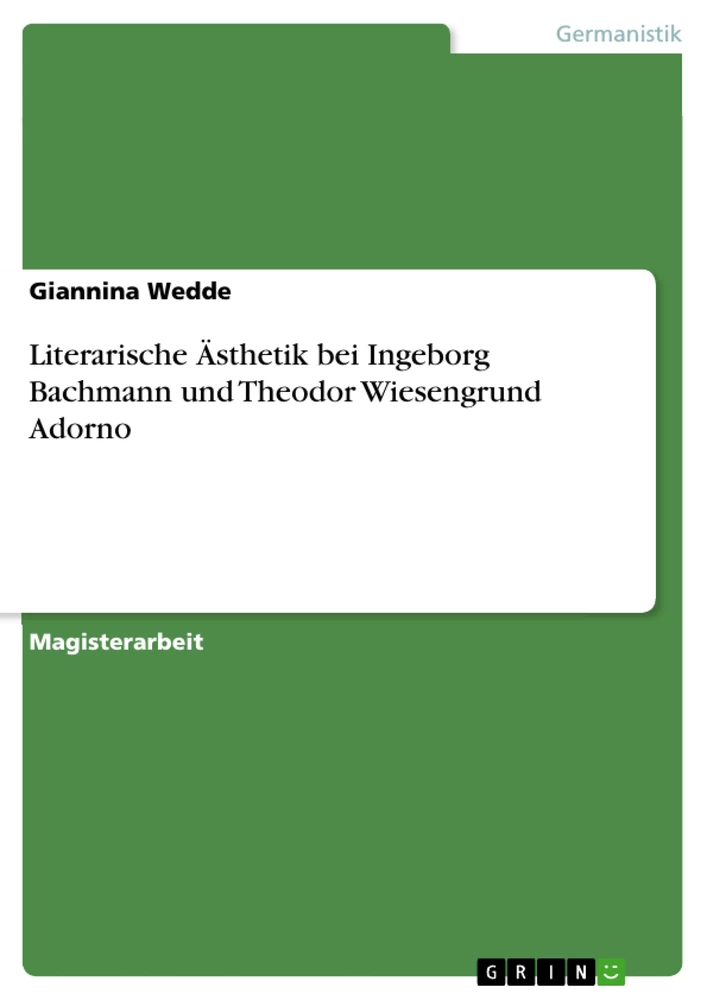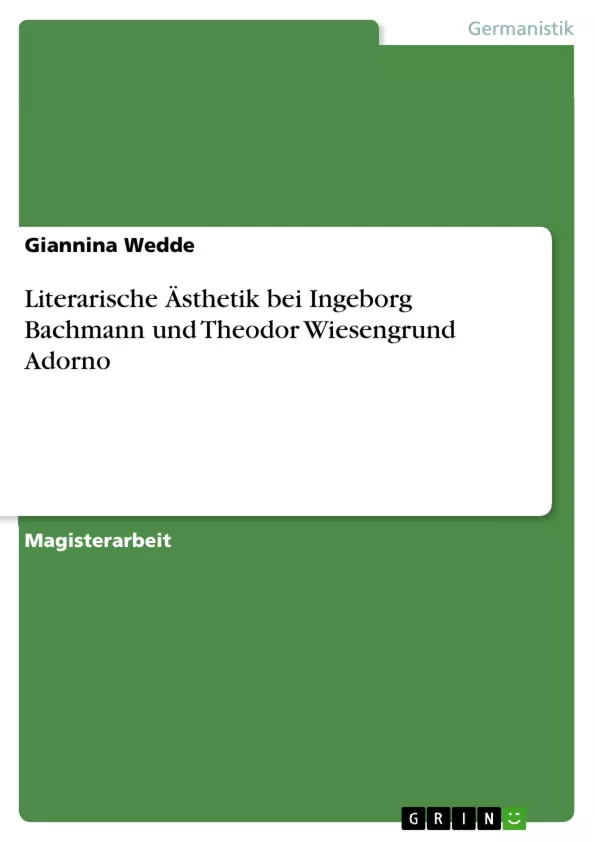Die vorliegende Arbeit möchte einen Einblick in die literarischen Ästhetiken Theo-dor W. Adornos und Ingeborg Bachmanns gewähren. Der vergleichende Blick auf das Oeuvre beider Autoren bietet sich insofern an, als eine theoretische Nähe beider in der Sekundärliteratur nicht selten unterstellt wird. Auffallend ist, daß sich in der Sekundärliteratur zu Adorno kaum Hinweise auf seine Bekanntschaft mit Ingeborg Bachmann finden (wohl unausgesprochen der Annahme folgend, daß seine Philosophie auf sie Einfluß ausgeübt haben könnte, ihre Arbeit als Theoretikerin aber sicher keinerlei Einfluß auf ihn), umgekehrt aber in den zahlreichen Texten zu Bachmanns literarischem Schaffen die Hinweise auf Adornos Einfluß sich häufen. Berechtigt scheint dieser einseitige Verweis auf Adornos Einfluß insofern, als dieser den philosophischen, gesellschaftskritischen und literaturwissenschaftlichen Diskurs der Nachkriegszeit wesentlich geprägt hat. Das philosophische Werk Adornos ist nicht nur quantitativ sehr umfangreich und inhaltlich von großer Komplexität, sondern darüber hinaus auch von einer rhetorischen Dichte, die immer wieder massive Kritik provozierte. Nicht selten erging an Adorno der Vorwurf, mit seinem hermetischen Duktus bewußt Unverständnis herauszufordern, über Schwächen in der Theorie hinwegtäuschen zu wollen, oder gar Erkenntnis mit dieser Form des Schreibens und Denkens völlig obsolet zu machen. Ingeborg Bachmann muß man attestieren, nicht wirklich eine Theoretikerin gewesen zu sein, und dies auch mehrmals selbst betont zu haben. Nicht zuletzt deshalb ist sie auch in diversen Interviews und Gesprächen als verschlossene, wortkarge, sogar kommunikationsverweigernde Person in Erscheinung getreten, die lieber der Dichtung als der Theorie das Wort überließ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Adornos Ästhetik
- Grundlagen der 'Dialektik der Aufklärung' - Aufklärung und Mythos
- Mimesis
- Der Odysseus-Mythos
- Identitätszwang
- Dialektik der Aufklärung
- Natur und Individuum
- Der universale "Verblendungszusammenhang"
- Kunst
- Der Doppelcharakter der Kunst
- Kunst als Wahrheitsinstanz
- Das Naturschöne - Rekurs auf Kant, Schiller und Hegel
- Das Formgesetz
- Bachmanns Ästhetik zwischen Autonomie und Litterature Engagée
- Historische Bedingungen
- Die Frankfurter Vorlesungen - Die Frage nach der Legitimation der Kunst
- Die "Höllenmaschine" Geschichte: Kunst nach Auschwitz
- Adorno
- Der Tod des Individuums
- Verlust von Erfahrung
- Erinnerung als ästhetische Kategorie
- Bachmann
- Der Mangel an Erfahrung
- "Jugend in einer österreichischen Stadt"
- "Scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht": Erweckende Kunst
- Adorno
- Eine Theorie der Gesellschaft
- Die Möglichkeit von Erkenntnis
- Exkurs - Musikphilosophie
- Diskursive oder ästhetische Erkenntnis?
- Die Kategorie des Scheins
- Versus Einfühlungsästhetik und Nominalismus
- Bachmann
- "Der Schweißer"
- Das Idolatrieverbot in der Kunst: Die negative Utopie
- Adorno
- Bachmann
- "Undine geht"
- Theologische Aspekte
- Adorno
- Die Leidensästhetik Adornos
- Der Antisemitismus des Christentums
- Die strukturelle Negativität jüdischen Glaubens
- Der Begriff der Versöhnung
- Der "Standpunkt der Erlösung"
- Bachmann
- "Alles"
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die literarischen Ästhetiken Theodor W. Adornos und Ingeborg Bachmanns zu beleuchten. Sie untersucht die Parallelen in den Werken beider Autoren und befasst sich mit der Frage, inwiefern ein theoretischer Zusammenhang zwischen Adornos Philosophie und Bachmanns literarischem Schaffen besteht.
- Die Frage nach der Legitimation der Kunst nach Auschwitz
- Die Rolle der Kunst als erweckende Erkenntnisinstanz
- Die Bedeutung der Utopie in der Ästhetik von Adorno und Bachmann
- Theologische Aspekte in der Kunsttheorie beider Autoren
- Der Vergleich zwischen Adornos philosophischer Theorie und Bachmanns literarischem Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die methodische Vorgehensweise. Sie stellt die zentrale Frage nach der Verbindung zwischen Adornos philosophischer Ästhetik und Bachmanns literarischem Schaffen in den Mittelpunkt.
- Adornos Ästhetik: Dieses Kapitel widmet sich den Grundlagen von Adornos Ästhetik, insbesondere den zentralen Begriffen aus der 'Dialektik der Aufklärung'. Es beleuchtet die Rolle von Mythos und Mimesis sowie die Bedeutung der Kunst als Wahrheitsinstanz.
- Bachmanns Ästhetik zwischen Autonomie und Litterature Engagée: Dieses Kapitel untersucht Bachmanns literarische Ästhetik und betrachtet sie im Kontext der historischen Bedingungen. Es beleuchtet ihre Auseinandersetzung mit der Frage nach der Legitimation der Kunst, insbesondere im Kontext der Frankfurter Vorlesungen.
- Die "Höllenmaschine" Geschichte: Kunst nach Auschwitz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Legitimation der Kunst im Kontext der Shoah. Es untersucht Adornos und Bachmanns unterschiedliche Positionen und analysiert deren Gedanken zur Kunst nach Auschwitz.
- "Scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht": Erweckende Kunst: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Kunst als erweckende Erkenntnisinstanz. Es analysiert Adornos und Bachmanns Konzeptionen der Kunst im Kontext von Gesellschaft und Erkenntnis sowie deren Verhältnis zu Musikphilosophie, Einfühlungsästhetik und Nominalismus.
- Das Idolatrieverbot in der Kunst: Die negative Utopie: Dieses Kapitel untersucht das Idolatrieverbot in der Kunst und analysiert Adornos und Bachmanns Positionen zu diesem Thema. Es beleuchtet die Frage, ob die Kunst eine utopische Funktion erfüllen kann und wie diese Funktion in den Werken beider Autoren dargestellt wird.
- Theologische Aspekte: Dieses Kapitel widmet sich den theologischen Aspekten in der Kunsttheorie von Adorno und Bachmann. Es analysiert Adornos Leidensästhetik, die Kritik am Antisemitismus des Christentums und die Rolle des jüdischen Glaubens in seiner Philosophie. Außerdem werden Bachmanns theologische Anklänge und die Frage nach der Versöhnung in ihren Werken betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den literarischen Ästhetiken von Theodor W. Adorno und Ingeborg Bachmann, und fokussiert auf die Themen Kunst nach Auschwitz, Erweckung durch Kunst, Utopie und Theologie. Wichtige Konzepte sind die 'Dialektik der Aufklärung', Mimesis, Mythos, Identitätszwang, Wahrheitsinstanz, das Formgesetz, historische Bedingungen, die Frankfurter Vorlesungen, der Mangel an Erfahrung, die Kategorie des Scheins und das Idolatrieverbot.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Adorno Ingeborg Bachmann?
Die Sekundärliteratur weist häufig auf Adornos Einfluss auf Bachmanns literarisches Schaffen hin, insbesondere im Hinblick auf Gesellschaftskritik und die Frage nach der Kunst nach Auschwitz.
Was bedeutet "Kunst nach Auschwitz" bei Adorno?
Adorno thematisiert die radikale Krise der Kultur und Kunst nach der Shoah. Er hinterfragt, wie ästhetische Darstellung angesichts des massenhaften Todes noch legitimiert werden kann.
Was sind die "Frankfurter Vorlesungen" von Bachmann?
In diesen Vorlesungen setzt sich Bachmann theoretisch mit der Rolle des Dichters und der Legitimation der Literatur in der Nachkriegszeit auseinander.
Was versteht Adorno unter "Mimesis"?
In seiner Ästhetik beschreibt Mimesis das Anschmiegen an das Objekt, einen Gegenpol zum rationalen Identitätszwang der Aufklärung.
Welche Rolle spielt die Utopie in den Werken beider Autoren?
Beide arbeiten oft mit einer "negativen Utopie" oder dem "Idolatrieverbot" – die Vorstellung eines besseren Zustands darf nicht direkt abgebildet werden, sondern erscheint nur ex negativo durch die Kritik am Bestehenden.
- Citation du texte
- M.A.phil. Giannina Wedde (Auteur), 2002, Literarische Ästhetik bei Ingeborg Bachmann und Theodor Wiesengrund Adorno, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52787