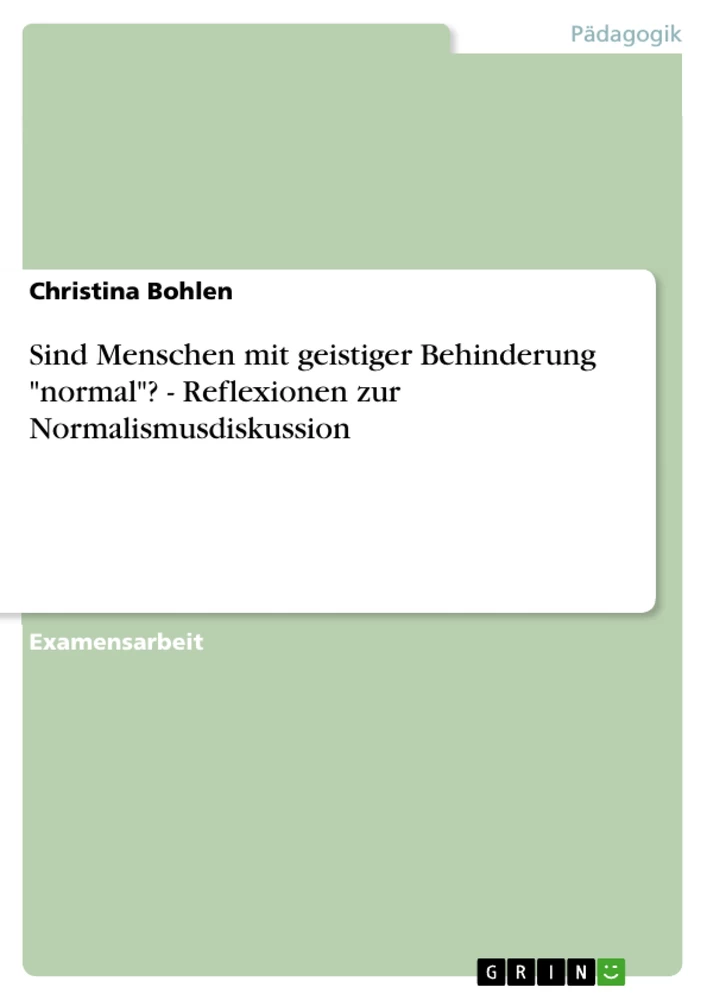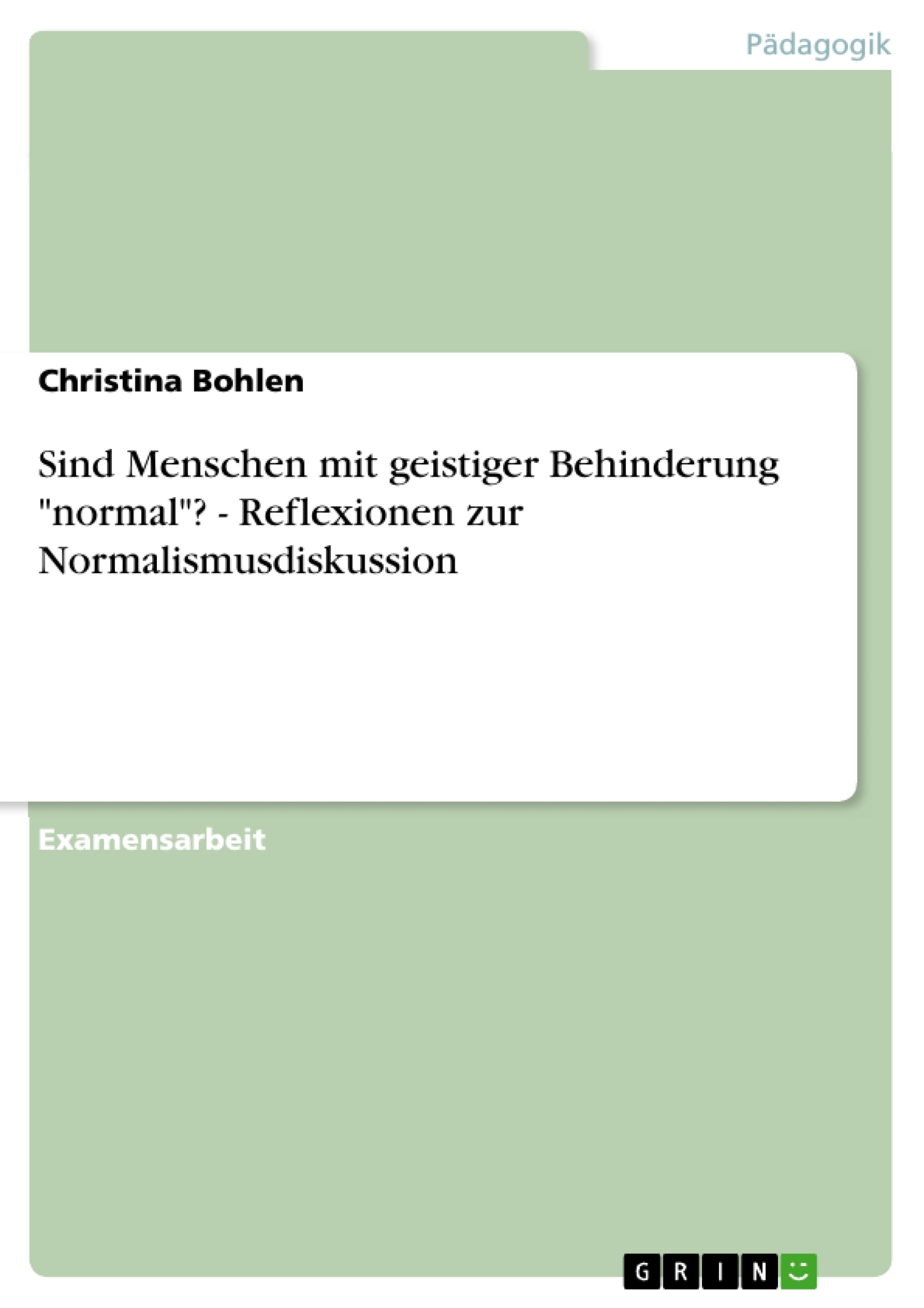In meiner Arbeit gilt es herauszufinden, ob Menschen mit geistiger Behinderung‘normal’sind. Der Begriff des ‘Normalen’, der ‘Normalität’ scheint eindeutig zu sein - im Alltag wird er ganz selbstverständlich benutzt. Doch es gibt kaum einen Begriff wie den der ‘Normalität’, der so verworren und so vieldeutig ist. Auf die Frage, ob Menschen mit geistiger Behinderungnormalsind, können verschiedene Menschen unterschiedlich antworten. So können zwei Personen der Ansicht sein, dass sie Menschen mit Behinderung nicht normal finden und doch etwas Unterschiedliches damit meinen, den Begriff des Normalen unterschiedlich deuten. Der Erste könnte meinen, dass es nicht normal ist, behindert zu sein, weil er ‘normal’ mit der biologischen Norm gleichsetzt, welcher Menschen mit Behinderung nicht entsprechen; der Zweite könnte ‘normal’ mit seinem Alltag vergleichen, in dem Menschen mit Behinderung nicht (oder nur in unterdurchschnittlicher Anzahl) vorkommen. Zwei weitere Personen, die die Ansicht vertreten, dass Menschen mit Behinderung normal sind, übersetzen diesen Begriff für sich wieder anders. Der Erste findet Behinderung normal, da Behinderung für ihn eine natürliche Daseinsform darstellt und der Zweite, weil er in einer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung arbeitet und jeden Tag mit dieser Personengruppe im Kontakt kommt und es so für ihn zu seiner persönlichen Normalität geworden ist. An diesen Beispielen wird deutlich, dass es eben nichtdie eine, richtigeDefinition von ‘Normalität’ gibt und sich die verschiedensten Bedeutungen hinter ihr verbergen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. EINLEITUNG
- 0.1 Aufbau der Arbeit
- 1. NORMALITÄT
- 1.1 Etymologie
- 1.1.1 Normal, Normalität
- 1.2 Normativität
- 1.3 Normenkonzepte
- 1.3.1 Die Statistische Norm
- 1.3.2 Technische Normen
- 1.3.3 Biologische/funktionelle Normen
- 1.3.4 Idealnorm
- 1.3.5 Soziale Norm
- 1.3.5.1 Bestandteile der sozialen Norm
- 1.3.5.3 Normverbindlichkeiten
- 1.4 Normalismus
- 1.4.1 Protonormalismus
- 1.4.2 Der Flexible Normalismus
- 1.5 Zusammenfassung - 1.Kapitel
- 2. NORMALITÄT und GEISTIGE BEHINDERUNG
- 2.1 Behinderung
- 2.1.1 WHO-Klassifikationen
- 2.1.2 Sozialpolitische Definition
- 2.1.3 Soziologische Definition
- 2.1.4 Definition: geistige Behinderung (behindertenpädagogisch)
- 2.1.4.1 Medizinische Sichtweise
- 2.1.4.2 Psychologische Sichtweise
- 2.1.4.3 Soziologische Sichtweise
- 2.1.5 Statistische Häufigkeit
- 2.2 Behinderungen als Abweichung
- 2.3 Zusammenfassung - 2.Kapitel
- 3. BEHINDERUNG als NORMALITÄT
- 3.1 Behinderung auf dem Weg zur Normalität
- 3.2 Verschiedenheit als neue Normalität
- 3.3 Integration als Aussonderungsabsage
- 3.4 Zusammenfassung – 3.Kapitel
- 4.FAZIT/STELLUNGNAHME zur FRAGESTELLUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob Menschen mit geistiger Behinderung als "normal" betrachtet werden können. Sie beleuchtet den vielschichtigen und oft unreflektiert verwendeten Begriff der "Normalität" aus verschiedenen Perspektiven. Die Arbeit analysiert verschiedene Normenkonzepte und deren Anwendung auf Menschen mit geistiger Behinderung. Sie hinterfragt die Dichotomie zwischen Behinderung und Normalität und diskutiert unterschiedliche Definitionen von Behinderung.
- Der vielschichtige Begriff der Normalität und seine verschiedenen Interpretationen.
- Die Definition von Behinderung aus medizinischer, psychologischer und soziologischer Sicht.
- Die Anwendung verschiedener Normenkonzepte (statistisch, technisch, biologisch, ideal, sozial) auf Menschen mit geistiger Behinderung.
- Die Darstellung der "Normalismus"-Debatte und deren Relevanz für die Inklusion.
- Die kritische Auseinandersetzung mit der Dichotomie zwischen Behinderung und Normalität.
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Normalität von Menschen mit geistiger Behinderung vor und erläutert die Vieldeutigkeit des Begriffs "Normalität". Sie hebt die mangelnde theoretische Fundierung des Normalitätsbegriffs in der Sonderpädagogik hervor und verweist auf die Bedeutung der Auseinandersetzung mit diesem Begriff für das Fachgebiet. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die verschiedenen Perspektiven, aus denen die Forschungsfrage behandelt wird.
1. Normalität: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Normalität umfassend. Es beginnt mit einer etymologischen Betrachtung, differenziert zwischen Normalität und Normativität und untersucht verschiedene Normenkonzepte: die statistische Norm, technische Normen, biologische/funktionelle Normen, die Idealnorm und die soziale Norm mit ihren Bestandteilen und Normverbindlichkeiten. Schließlich wird der "Normalismus" mit seinen verschiedenen Ausprägungen (Protonormalismus, flexibler Normalismus) diskutiert. Das Kapitel legt ein breites Fundament für die spätere Auseinandersetzung mit der Frage der Normalität von Menschen mit geistiger Behinderung.
2. Normalität und Geistige Behinderung: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von Behinderung aus verschiedenen Blickwinkeln. Es beschreibt die WHO-Klassifikationen, sozialpolitische und soziologische Definitionen von Behinderung. Besonders eingehend wird die Definition von geistiger Behinderung aus behindertenpädagogischer Perspektive betrachtet, unterteilt in medizinische, psychologische und soziologische Sichtweisen. Schließlich wird der Aspekt von Behinderung als Abweichung von der Norm thematisiert. Das Kapitel liefert ein differenziertes Verständnis des Begriffs "geistige Behinderung" und bereitet den Boden für die Synthese mit dem Normalitätsbegriff.
3. Behinderung als Normalität: Dieses Kapitel fokussiert auf die Perspektive, Behinderung als Normalität zu verstehen. Es beleuchtet den Prozess der Integration und Inklusion und wie dieser die traditionelle Dichotomie von Normalität und Behinderung in Frage stellt. Die Kapitel untersuchen die Idee der "Verschiedenheit als neue Normalität" und kritisieren die Vorstellung von Integration als bloße Aussonderungsabsage. Das Kapitel präsentiert einen alternativen Blickwinkel auf Behinderung und strebt nach einer Überwindung der traditionellen Gegenüberstellung.
Schlüsselwörter
Normalität, Normativität, Normenkonzepte, geistige Behinderung, Behinderung, Inklusion, Integration, Normalismus, Abweichung, WHO-Klassifikation, sozialpolitische Definition, soziologische Definition, behindertenpädagogische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Normalität und Geistige Behinderung"
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Menschen mit geistiger Behinderung als "normal" betrachtet werden können. Sie analysiert den komplexen Begriff der "Normalität" und seine Anwendung auf Menschen mit geistiger Behinderung aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Aspekte der Normalität werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Begriff der Normalität aus etymologischer, normativer und konzeptioneller Sicht. Es werden verschiedene Normenkonzepte untersucht, darunter statistische, technische, biologische, ideale und soziale Normen. Der "Normalismus" und seine verschiedenen Ausprägungen (Protonormalismus, flexibler Normalismus) werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird Behinderung definiert?
Behinderung wird aus medizinischer, psychologischer und soziologischer Perspektive betrachtet. Die Arbeit bezieht sich auf WHO-Klassifikationen und sozialpolitische sowie soziologische Definitionen von Behinderung. Die Definition von geistiger Behinderung aus behindertenpädagogischer Sicht wird besonders detailliert behandelt.
Welche Rolle spielt die Inklusion in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Prozess der Integration und Inklusion und wie dieser die traditionelle Dichotomie von Normalität und Behinderung in Frage stellt. Die Idee der "Verschiedenheit als neue Normalität" wird diskutiert und die Vorstellung von Integration als bloße Aussonderungsabsage kritisch hinterfragt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Normalität, ein Kapitel zu Normalität und geistiger Behinderung und ein Kapitel zu Behinderung als Normalität. Schließlich folgt ein Fazit/Stellungnahme zur Fragestellung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Normalität, Normativität, Normenkonzepte, geistige Behinderung, Behinderung, Inklusion, Integration, Normalismus, Abweichung, WHO-Klassifikation, sozialpolitische Definition, soziologische Definition, behindertenpädagogische Perspektive.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die vielschichtige und oft unreflektiert verwendete Bedeutung von "Normalität" zu analysieren und deren Anwendung auf Menschen mit geistiger Behinderung zu hinterfragen. Sie möchte die Dichotomie zwischen Behinderung und Normalität kritisch diskutieren.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt detailliert die Inhalte jedes Kapitels, beginnend mit der Einführung der Forschungsfrage und der Vieldeutigkeit des Begriffs „Normalität“ bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit der traditionellen Gegenüberstellung von Behinderung und Normalität und dem Vorschlag einer alternativen Perspektive.
- Citar trabajo
- Christina Bohlen (Autor), 2006, Sind Menschen mit geistiger Behinderung "normal"? - Reflexionen zur Normalismusdiskussion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52889