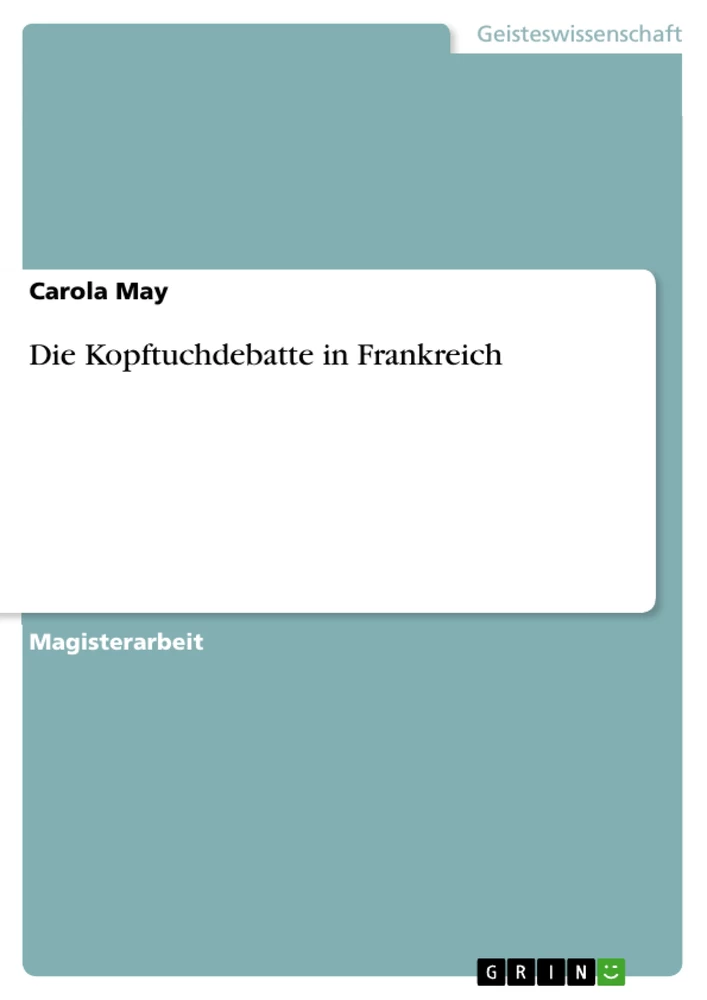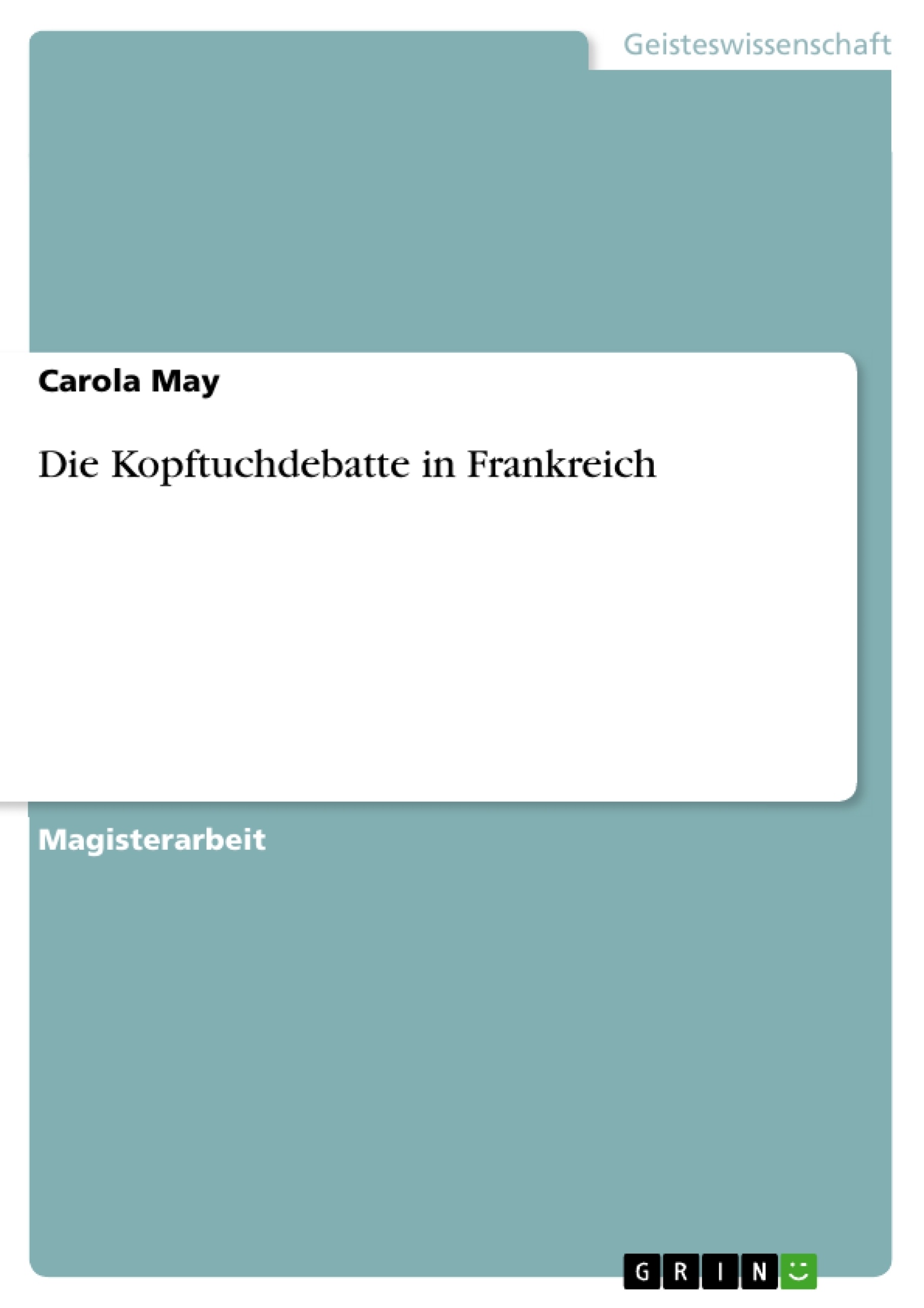Seit über zwanzig Jahren wirft das muslimische Kopftuch regelmäßig öffentliche Debatten über Inhalt und Werte der französischen Republik, ihr Verhältnis zu kultureller Pluralität im Allgemeinen und zur maghrebinischen Bevölkerung aus den ehemaligen Kolonien im Besonderen auf. Diese stellt den Hauptteil der muslimischen Minderheit Frankreichs dar. Das Kopftuch ist zum Symbol der Bedrohung laizistischer Werte und somit der Republik schlechthin geworden und gilt als Vorzeichen eines fundamentalistischen Islams, der mit den demokratisch-liberalen Werten Frankreichs nicht kompatibel erscheint. Anfang 2003 bis Anfang 2004 flammten die Diskussionen um das Kopftuch in Frankreich besonders stark auf und riefen leidenschaftliche innergesellschaftliche Kontroversen hervor, die alle anderen nationalen und internationalen Debatten überragten. Forderungen nach einem gesetzlichen Verbot des Kopftuches wurden immer eindringlicher: Es ginge um Laizismus, den Erhalt der Einheit der französischen Republik, um den Schutz der jungen Muslima vor männlicher Unterdrückung und damit die Wahrung der Menschenrechte, darum, das Vordringen eines politischen, für die Republik gefährlichen Islam aufzuhalten und daraus folgenden „kommunitaristischen Tendenzen“ Einhalt zu gebieten. Die Debatten nahmen ein Ausmaß an, welches die Regierung im Herbst 2003 bewog, eine Expertenkommission mit der Aufgabe zu betrauen, die Einhaltung der laizistischen Grundprinzipien in der Republik und insbesondere an Frankreichs Schulen zu prüfen. Die sogenannte „Stasi-Kommission“ entwarf unter Leitung des Experten für Immigration Bernard Stasi nach mehrmonatigen Untersuchungen einen Gesetzentwurf, der die allgemeinen Forderungen bekräftigte, Mädchen im schulpflichtigen Alter das Tragen des Kopftuches im Schulunterricht zu untersagen. Im März 2004 wurde ein Gesetz zum Verbot des Tragens ostentativer religiöser Zeichen an Schulen und in öffentlichen Institutionen verabschiedet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Forschungsstand
- III. Diskursanalyse
- III.I Schritte der Analyse
- 1. Teil: Hintergründe der Kopftuchdebatte in Frankreich
- 1.1 Laizismus und staatlicher Bildungsauftrag in Frankreich
- 1.2 Die Handhabung religiöser Praxis an Frankreichs Schulen
- 1.3 Sozialer Laizismus und die Angst vor kulturellem Pluralismus
- 1.4 „Islam de France“ versus „Islam en France“ - Charakteristika eines französisch-europäischen Islams
- 2. Teil: Die maghrebinische Gemeinde in Frankreich
- 2.1 Immigration, Einbürgerung und Status der maghrebinisch-stämmigen Bevölkerung
- 2.2 Organisation islamischen Glaubens und die Gründung des CFCM
- 2.3 Glauben und Spiritualität der 2. Generation
- 3. Teil: Das Gesetz zum Verbot des Kopftuches an Schulen
- 3.1 Entwicklung der Kopftuchaffäre seit 1989 bis zum Gesetzentwurf der Stasi-Kommission
- 3.2 Contra und Pro des Gesetzes - Hauptargumente in wissenschaftlichen Debatten
- 3.2.1 Contra
- 3.2.2 Pro
- 3.3 Die Darstellung der Kopftuchdebatte in den Medien am Beispiel dreier populärer Tageszeitungen um die Jahreswende 2003/2004
- 3.3.1 Methodik
- 3.3.2 Analytische Auswertung
- 3.3.3 Fazit
- 4. Teil: Erscheinungsformen des muslimischen Kopftuches unter Berücksichtigung der Aussagen von Protagonistinnen
- 4.1 Aussagen zum Kopftuch im Koran
- 4.2 Die drei Bedeutungen des Kopftuches
- 4.2.1 Das traditionelle Kopftuch
- 4.2.2 Das Kopftuch heranwachsender Mädchen
- 4.2.3 Das „individuelle“ Kopftuch
- 5. Teil: Wir sind muslimisch und französisch! Das Kopftuch französischer Muslima in der Kontroverse
- 5.1 Das Kopftuch als Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen und Möglichkeit der Bildung einer individuellen, französisch-muslimischen Identität
- 5.2 Das Kopftuch als Ausdruck eines Generationskonfliktes
- 5.3 Das „individuelle“ Kopftuch als Zeichen weiblicher Selbstbestimmung und Emanzipation
- 5.4 Der Bezug auf die religiösen Texte: Gefahren und Möglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Kopftuchdebatte in Frankreich und zielt darauf ab, die komplexen und miteinander verwobenen Themen aufzudecken, die diese Debatte prägten. Die Arbeit analysiert die Debatte, indem sie die verschiedenen Perspektiven und Argumente beleuchtet, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Untersuchung geht über eine rein oberflächliche Betrachtung hinaus und hinterfragt die tieferliegenden gesellschaftlichen und politischen Implikationen.
- Der Laizismus in Frankreich und seine Herausforderungen durch den kulturellen Pluralismus.
- Die sozio-kulturelle Situation der maghrebinischen Gemeinde in Frankreich.
- Die verschiedenen Bedeutungen und Interpretationen des Kopftuches.
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion und Verbreitung der Debatte.
- Die Instrumentalisierung des Kopftuches in gesellschaftlichen Diskursen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die kontroverse Debatte um das Kopftuch in Frankreich, die seit über zwanzig Jahren andauert und die französischen Werte und das Verhältnis zur muslimischen Minderheit betrifft. Die Debatte kulminierte im Jahr 2004 in einem gesetzlichen Verbot des Kopftuches an Schulen. Die Arbeit untersucht die komplexen und miteinander verwobenen Faktoren, die zu dieser Debatte führten, und hinterfragt die zugrundeliegenden gesellschaftlichen und politischen Implikationen. Es wird die Frage gestellt, ob das Kopftuch tatsächlich eine Bedrohung für den Laizismus und die Einheit der Republik darstellt oder ob andere gesellschaftliche Probleme projiziert werden.
1. Teil: Hintergründe der Kopftuchdebatte in Frankreich: Dieser Teil untersucht die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Debatte. Er beleuchtet das Konzept des französischen Laizismus und seine Rolle im Bildungssystem, sowie die Herausforderungen, die durch den kulturellen Pluralismus und die Angst vor einem "fundamentalistischen Islam" entstehen. Die verschiedenen Interpretationen von „Islam de France“ und „Islam en France“ werden analysiert und ihre Bedeutung im Kontext der Debatte erörtert. Besonders wird die schwierige Integration der maghrebinischen Gemeinde in Frankreich beleuchtet, welche die Debatte maßgeblich beeinflusst.
2. Teil: Die maghrebinische Gemeinde in Frankreich: Dieser Abschnitt liefert einen sozio-historischen Überblick über die maghrebinische Gemeinde in Frankreich, ihren Integrationsstatus und die Organisation des islamischen Glaubens. Die Arbeit konzentriert sich auf die zweite und dritte Generation der Einwanderer und ihre religiösen Praktiken, um den soziokulturellen Kontext der Kopftuchdebatte zu verstehen und die Erfahrungen der betroffenen Frauen und Mädchen zu beleuchten. Die Gründung des CFCM (Conseil français du culte musulman) und seine Rolle werden ebenfalls diskutiert.
3. Teil: Das Gesetz zum Verbot des Kopftuches an Schulen: Dieser Teil analysiert den Verlauf der Kopftuchdebatte von 1989 bis zur Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2004. Er untersucht die Argumente für und gegen das Verbot, wie sie in wissenschaftlichen Debatten und Medien dargestellt wurden. Die Methodik und die Ergebnisse einer Medienanalyse dreier Tageszeitungen um die Jahreswende 2003/2004 werden präsentiert, um die öffentliche Wahrnehmung und Darstellung der Debatte zu erhellen. Die Analyse verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven und die Komplexität der Argumente.
4. Teil: Erscheinungsformen des muslimischen Kopftuches unter Berücksichtigung der Aussagen von Protagonistinnen: Dieser Abschnitt untersucht die verschiedenen Bedeutungen und Interpretationen des Kopftuches, indem er Aussagen von Frauen berücksichtigt, die es tragen. Er unterscheidet zwischen dem traditionellen Kopftuch, dem Kopftuch heranwachsender Mädchen und dem „individuellen“ Kopftuch. Die religiösen Bezüge und die vielfältigen symbolischen Bedeutungen des Kopftuches werden im Detail analysiert, um das einseitige Verständnis des Symbols in der öffentlichen Debatte zu hinterfragen.
5. Teil: Wir sind muslimisch und französisch! Das Kopftuch französischer Muslima in der Kontroverse: Dieser Teil befasst sich mit den verschiedenen Perspektiven französischer Muslima auf das Kopftuch. Er untersucht die möglichen Interpretationen des Kopftuches als Brücke zwischen Kulturen, als Ausdruck eines Generationskonflikts, als Zeichen weiblicher Selbstbestimmung und als Ausdruck religiöser Identität. Der Abschnitt erörtert kritisch, wie das Kopftuch als Symbol missverstanden und in der öffentlichen Debatte instrumentalisiert werden kann.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Die Kopftuchdebatte in Frankreich
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die komplexe Kopftuchdebatte in Frankreich, die seit über zwanzig Jahren andauert und die französischen Werte sowie das Verhältnis zur muslimischen Minderheit betrifft. Sie analysiert die Debatte aus verschiedenen Perspektiven und hinterfragt die tieferliegenden gesellschaftlichen und politischen Implikationen, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob das Kopftuch tatsächlich eine Bedrohung für den Laizismus darstellt oder ob andere gesellschaftliche Probleme projiziert werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter der französische Laizismus und seine Herausforderungen durch den kulturellen Pluralismus, die sozio-kulturelle Situation der maghrebinischen Gemeinde in Frankreich, die verschiedenen Bedeutungen und Interpretationen des Kopftuches, die Rolle der Medien in der Konstruktion und Verbreitung der Debatte, sowie die Instrumentalisierung des Kopftuches in gesellschaftlichen Diskursen. Die Arbeit beleuchtet auch die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Debatte, die Entwicklung des Gesetzes zum Verbot des Kopftuches an Schulen und die unterschiedlichen Perspektiven französischer Muslima auf das Kopftuch.
Welche Teile umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Teil 1 beleuchtet die Hintergründe der Kopftuchdebatte in Frankreich, einschließlich Laizismus, staatlichem Bildungsauftrag und der Integration der maghrebinischen Gemeinde. Teil 2 konzentriert sich auf die maghrebinische Gemeinde, ihre Immigration, den Integrationsstatus und die Organisation des islamischen Glaubens. Teil 3 analysiert das Gesetz zum Verbot des Kopftuches an Schulen, inklusive der Entwicklung der Debatte und einer Medienanalyse. Teil 4 untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen des Kopftuches und dessen Bedeutung aus der Sicht der Trägerinnen. Teil 5 befasst sich mit den verschiedenen Perspektiven französischer Muslima auf das Kopftuch und dessen Rolle in der Kontroverse.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Diskursanalyse, um die Kopftuchdebatte zu untersuchen. Im dritten Teil wird eine Medienanalyse durchgeführt, die die Darstellung der Debatte in drei populären Tageszeitungen um die Jahreswende 2003/2004 untersucht. Die Arbeit berücksichtigt auch die Aussagen von Protagonistinnen, um verschiedene Interpretationen und Bedeutungen des Kopftuches zu verstehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit vermeidet voreilige Schlussfolgerungen und zielt darauf ab, die Komplexität der Kopftuchdebatte aufzuzeigen. Sie beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Argumente und hinterfragt die Instrumentalisierung des Kopftuches in gesellschaftlichen Diskursen. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text detailliert ausgeführt und basieren auf der Analyse der verschiedenen Teile der Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen und miteinander verwobenen Themen aufzudecken, die die Kopftuchdebatte in Frankreich prägten. Sie beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Argumente, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen, und hinterfragt die tieferliegenden gesellschaftlichen und politischen Implikationen der Debatte.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für alle Personen von Interesse, die sich für die Kopftuchdebatte in Frankreich, den französischen Laizismus, die Integration von Migranten und den kulturellen Pluralismus interessieren. Sie ist insbesondere für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit den gesellschaftlichen und politischen Implikationen dieser Debatte auseinandersetzen möchten, relevant.
- Citar trabajo
- Ethnologin Carola May (Autor), 2005, Die Kopftuchdebatte in Frankreich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52945