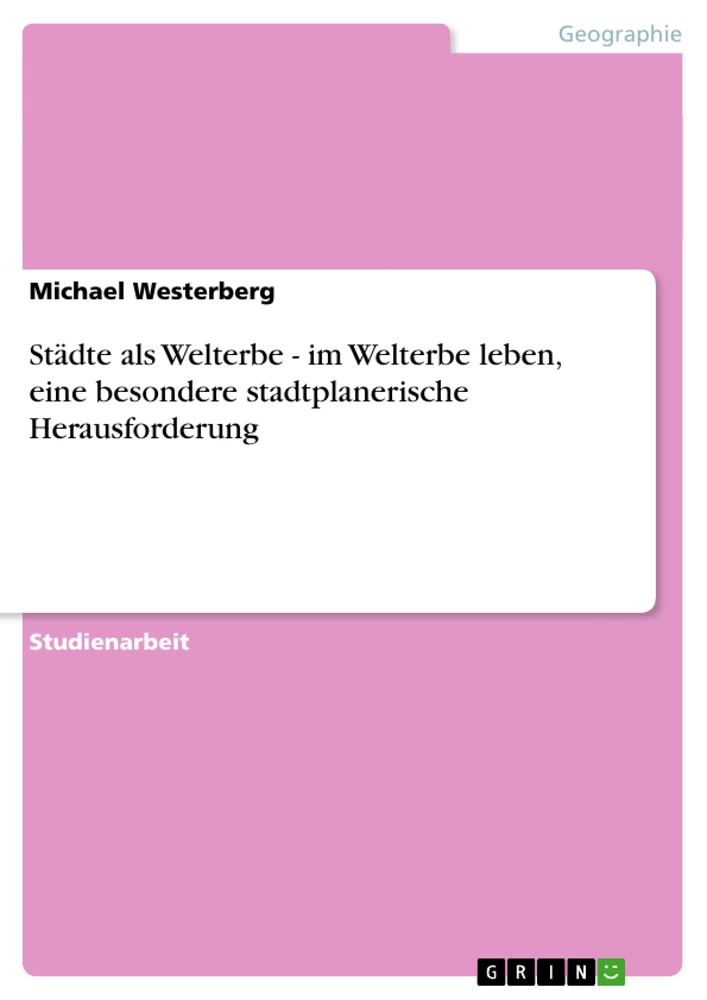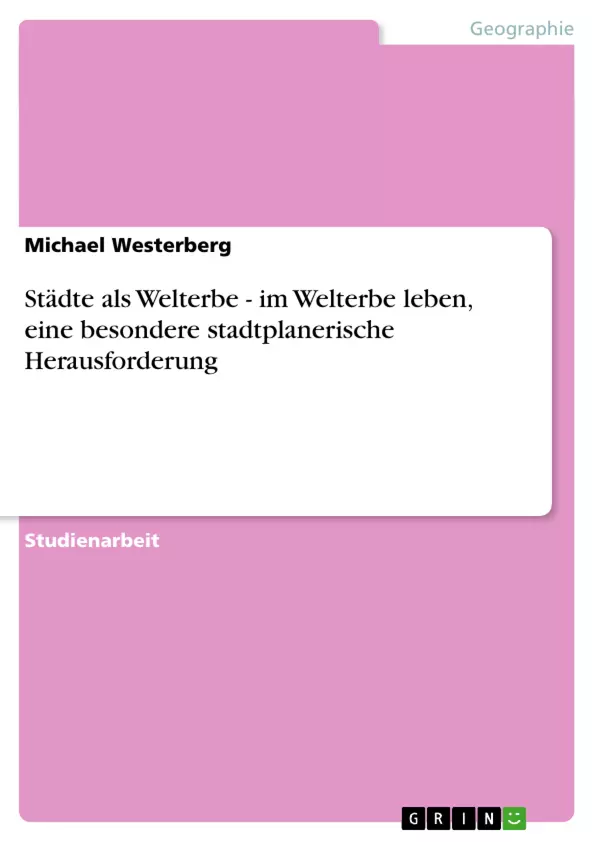Die von der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (dt. Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, und Kultur, kurz UNESCO) geführte Liste des Welterbes umfasst insgesamt 788 Denkmäler in 134 Ländern. 180 Staaten sind Mitglieder der UNESCO und haben seit 1945 das „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ unterzeichnet.
Mit der Unterzeichnung der Konvention sind die Mitglieder eine große Verpflichtung eingegangen. Dass der Schutz der Welterbestätten nicht unproblematisch ist, zeigt allein schon die Existenz der „Roten Liste“ des Welterbes. Die Gründe, warum eine Welterbestätte von der UNESCO auf diese Liste gesetzt wird, sind vielfältig und reichen von Naturkatastrophen (wie beispielsweise einem Tornado in Benin) bis zu vielfältigen Bedrohungen, die in friedlichen Zeiten durch Menschenhand geschaffen wurden (wie z.B. unkontrollierte Bauprojekte in Nepal). Die wenigsten Welterbestätten sind in unbesiedeltem Raum zu finden, und ihre Bedürfnisse stehen oft in Konflikt mit denen der Menschen.
Am deutlichsten zeigt sich dies in dichtbesiedelten Räumen, wie den Städten. Hier müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse eines Welterbes, welches oft große Teile des Stadtgebiets umfasst, und die Bedürfnisse des städtischen Lebens, auf engstem Raum miteinander vereint werden. 211 Städte weltweit sind in der Liste der „Organization of World Heritage Cities“ (OWHC) aufgeführt und versuchen tagtäglich diese Probleme des Denkmalschutzes und insbesondere des Welterbeschutzes zu lösen.
Was aber genau sind die Probleme, die der Status des Welterbes mit sich bringt? Wie gehen sie mit dem Status um, und wie vollzieht sich das Leben in diesen Städten? Dürfen nur Museumswächter in Welterbestädten wohnen? Diesen Fragen soll nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzgebung und Verfügungsgewalt über die Welterbestätten in Deutschland
- Stadtplanerische Hilfestellungen auf internationaler Ebene
- Das Fallbeispiel Potsdam
- Der Konfliktfall Potsdam-Center
- Das Fallbeispiel Quedlinburg
- Die stadtplanerische Herausforderung des Welterbes
- Das Leben im Welterbe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der besonderen Herausforderung, die sich aus der Planung von Städten ergibt, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Sie untersucht die Gesetzgebung in Deutschland, die internationalen Hilfestellungen und die Konflikte, die zwischen dem Schutz des Welterbes und den Bedürfnissen der Stadtentwicklung entstehen können. Die Arbeit analysiert zwei Fallbeispiele, Potsdam und Quedlinburg, um diese Herausforderungen anhand praktischer Beispiele zu beleuchten.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schutz von Welterbestätten in Deutschland
- Die Rolle der UNESCO und anderer internationaler Organisationen in der Stadtplanung
- Die Herausforderungen der Denkmalpflege und die Bedürfnisse der städtischen Entwicklung
- Die Auswirkungen des Welterbe-Status auf das Leben in den Städten
- Beispiele aus Potsdam und Quedlinburg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik des Welterbes vor und zeigt die Bedeutung des Schutzes dieser Stätten für zukünftige Generationen auf. Die Arbeit fokussiert sich auf die Herausforderungen, die sich aus der Integration von Welterbestätten in städtische Lebensräume ergeben.
- Gesetzgebung und Verfügungsgewalt über die Welterbestätten in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schutz von Welterbestätten in Deutschland. Es wird dargestellt, dass die Verantwortung für den Schutz und die Erhaltung der Welterbestätten bei den Bundesländern liegt, die jeweils eigene Denkmalschutzgesetze erlassen haben.
- Stadtplanerische Hilfestellungen auf internationaler Ebene: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der UNESCO und anderer internationaler Organisationen in der Stadtplanung. Es wird gezeigt, wie diese Institutionen Städte bei der Bewältigung der Herausforderungen unterstützen, die sich aus dem Welterbe-Status ergeben.
- Das Fallbeispiel Potsdam: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen der Stadtplanung in Potsdam im Kontext des Welterbe-Status. Es werden Beispiele für die Konflikte zwischen dem Schutz des historischen Stadtbildes und der Notwendigkeit, den Anforderungen der modernen Stadtentwicklung gerecht zu werden, aufgezeigt.
- Der Konfliktfall Potsdam-Center: Dieses Kapitel geht auf einen konkreten Konflikt in Potsdam ein, der zeigt, wie schwierig es sein kann, den Schutz des Welterbes mit den Interessen der privaten Wirtschaft zu vereinbaren. Der Konflikt zwischen dem Bau eines modernen Einkaufszentrums und der Erhaltung der historischen Bausubstanz wird beleuchtet.
- Das Fallbeispiel Quedlinburg: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Stadtplanung in Quedlinburg. Es werden die besonderen Herausforderungen im Kontext der historischen Altstadt dargestellt, die durch den Welterbe-Status entstanden sind. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen des Welterbe-Status auf das Leben der Bewohner und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.
- Die stadtplanerische Herausforderung des Welterbes: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Herausforderungen zusammen, die sich aus der Planung von Städten ergeben, die zum Welterbe gehören. Es werden die vielfältigen Anforderungen an die Stadtentwicklung beleuchtet, die es zu berücksichtigen gilt, um den Schutz des Welterbes und die Bedürfnisse der Bewohner gleichermaßen zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Welterbe, Stadtplanung, Denkmalpflege, Denkmalschutzgesetz, UNESCO, Potsdam, Quedlinburg, Stadtentwicklung, Konflikt, internationale Kooperation, städtisches Leben.
- Citation du texte
- Michael Westerberg (Auteur), 2005, Städte als Welterbe - im Welterbe leben, eine besondere stadtplanerische Herausforderung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52998