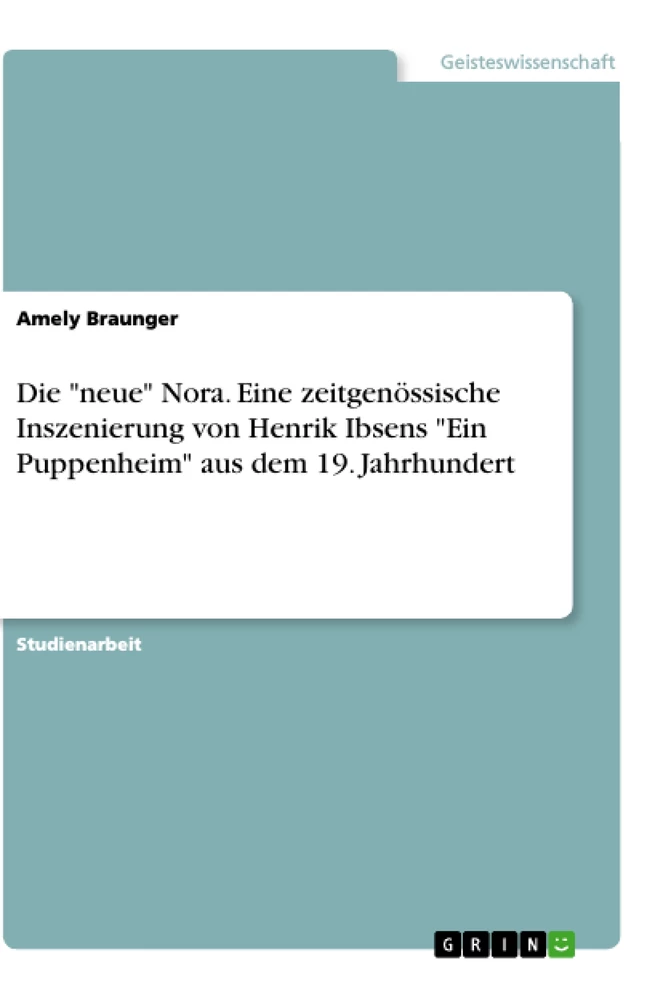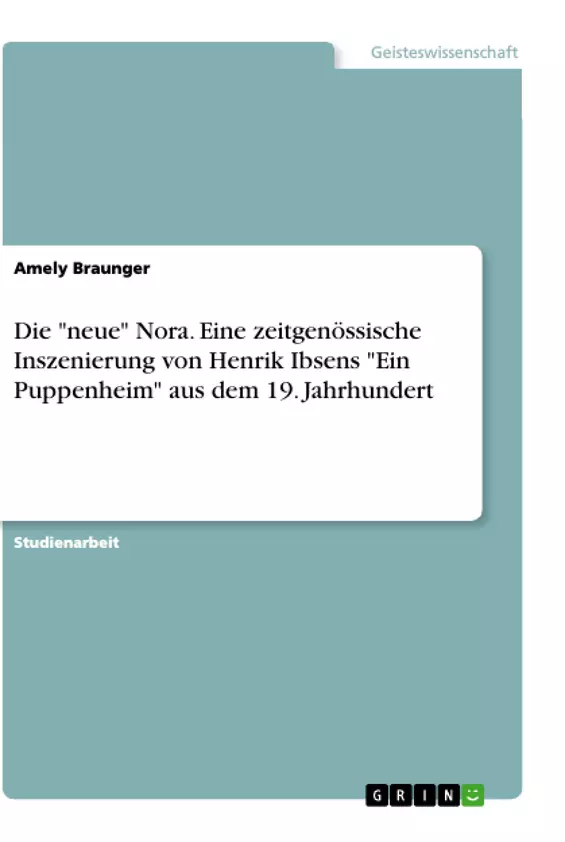Medien- und Kulturwissenschaftler wie Marshall McLuhan, Theodor W. Adorno oder Michael Giesecke haben unlängst festgestellt, dass Medien wie Film, Fernsehen oder Literatur einem stetigen Wandel unterworfen sind, der mit einem kulturellen und gesellschaftlichen Umdenken in engem Zusammenhang steht. Auch das Theater als mediale Ausdrucksform hat sowohl seine Gestalt als auch seinen Inhalt seit der Antike wesentlich verändert. In dieser Arbeit soll es darum gehen, den Prozess der Veränderung anhand eines ausgesuchten Theaterstücks aufzuzeigen und im Detail zu durchleuchten.
Im Zentrum der Untersuchung steht Henrik Ibsens dramatisches Meisterwerk „Ein Puppenheim“ aus dem 19. Jahrhundert. Dieses kritisch-realistische Werk wurde rund 120 Jahre später von dem jungen Intendanten der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, auf zeitgenössische Weise umgesetzt und mit postdramatischen Elementen versehen – ohne dabei jedoch den dramatischen Kern des Theaterstücks außer Acht zu lassen. Mein Anliegen ist es nun, den Originaltext sowie die Bühnengestaltung von Ibsen mit der postmodernen Inszenierung von Thomas Ostermeier zu vergleichen. Dazu werde ich zunächst eine entstehungsgeschichtliche sowie eine dramentheoretisch Grundlage für die Analyse von Ibsens „Ein Puppenheim“ schaffen, um ausgehend davon die Ostermeier-Inszenierung von „Nora“ analytisch zu durchleuchten. Ich möchte aufzeigen, mit welchen Mitteln aus dem postdramatischen Theater es Ostermeier gelingt, trotz enger Bezugnahme zu Henrik Ibsens Dramentext eine glaubwürdige und international von Erfolg gekrönte zeitgenössische Theaterinszenierung zu gestalten. Dabei werde ich mich im Detail an der postdramatischen Dramentheorie von Hans-Thies Lehmann orientieren, um Text und Sprache der Schauspieler, ihre Gesten und Bewegungen, das Bühnenbild sowie die räumliche Beziehung von Theater- und Zuschauerraum, die zeitliche Dimension von Fiktion und Realität des Theatergeschehens sowie die Medienrelevanz von Ostermeiers „Nora“ untersuchen zu können. Eine persönliche Stellungnahme zu Ostermeiers „Nora“-Inszenierung in Hinblick auf die Theatersituation des 21. Jahrhunderts soll die Analyse des Stücks schließlich abrunden.
Inhaltsverzeichnis
- Themenübersicht: Ziele und Absichten dieser Arbeit
- Das Drama um „Nora“
- Henrik Ibsen: Zu seiner Person
- „Ein Puppenheim“ – Entstehungsgeschichte
- Dramentheoretische Grundlage: Aristoteles „Poetik“
- „Nora“ oder „ein Puppenheim“? Ibsens Drama im 21. Jahrhundert
- Ausgangspunkt: Die Dramenhandlung nach Henrik Ibsen
- Thomas Ostermeier und seine „Nora“
- Inszenierung der Schaubühne Berlin – Hintergrundinformation
- Postdramatische Elemente: eine Detailanalyse
- Der sprechende Körper
- Der bewegte Körper
- Das „Bühnenbild“: Die Inszenierung im Raum
- Zeit, Fiktion und Realität im Theatergeschehen
- Neue Medien - Musik - Fotografie
- Fazit: Persönliche Stellungnahme
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Transformation von Henrik Ibsens „Ein Puppenheim“ in Thomas Ostermeiers zeitgenössische Inszenierung. Ziel ist der Vergleich des Originaltextes mit der postmodernen Umsetzung unter Berücksichtigung postdramatischer Elemente. Die Analyse beleuchtet, wie Ostermeier eine erfolgreiche, zeitgenössische Inszenierung schafft, die eng an Ibsens Text anknüpft.
- Die Entwicklung des Theaters als Medienform.
- Der Vergleich zwischen Ibsens „Ein Puppenheim“ und Ostermeiers Inszenierung.
- Die Anwendung postdramatischer Elemente in Ostermeiers Inszenierung.
- Die Analyse von Text, Sprache, Gestik, Bühnenbild und der Raum-Zeit-Beziehung im Theater.
- Die Medienrelevanz der Inszenierung.
Zusammenfassung der Kapitel
Themenübersicht: Ziele und Absichten dieser Arbeit: Dieses Kapitel erläutert die Ziele der Arbeit, die darin bestehen, die Transformation von Ibsens „Ein Puppenheim“ in eine zeitgenössische Inszenierung zu analysieren und den Wandel des Theaters als Medienform zu beleuchten. Es wird der Vergleich zwischen dem Originaltext und der Inszenierung von Thomas Ostermeier angekündigt, wobei die postdramatische Dramentheorie als analytisches Werkzeug dienen soll. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Mittel, die Ostermeier verwendet, um eine glaubwürdige und erfolgreiche Inszenierung zu schaffen.
Das Drama um „Nora“: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Henrik Ibsen, seine Biografie und den Entstehungskontext von „Ein Puppenheim“. Es wird die Entstehungsgeschichte des Stücks detailliert beleuchtet, einschließlich der Inspiration durch eine wahre Begebenheit aus Ibsens Umfeld und der Entwicklung des Stücks, inklusive des ursprünglichen, selbstmörderischen Endes und der späteren alternativen Version. Dramentheoretische Grundlagen, insbesondere Bezug nehmend auf Aristoteles' „Poetik“, werden ebenfalls eingeführt, um den analytischen Rahmen zu etablieren.
„Nora“ oder „ein Puppenheim“? Ibsens Drama im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Inszenierung von Thomas Ostermeier im Kontext der postdramatischen Dramentheorie. Es beginnt mit der Darstellung der Dramenhandlung nach Ibsen und führt dann detailliert in Ostermeiers Inszenierung und deren postdramatische Elemente ein. Es werden Aspekte wie die Rolle des Körpers der Schauspieler (sprechender und bewegter Körper), das Bühnenbild, die Beziehung zwischen Bühnenraum und Zuschauerraum sowie die Einbeziehung neuer Medien wie Musik und Fotografie untersucht. Die Analyse zeigt auf, wie Ostermeier Ibsens Text neu interpretiert und ihn für ein zeitgenössisches Publikum zugänglich macht.
Schlüsselwörter
Henrik Ibsen, Ein Puppenheim, Nora, Thomas Ostermeier, Postdramatisches Theater, Dramenanalyse, Inszenierung, Schauspiel, Körper, Bühnenbild, Raum, Zeit, Medien, Moderne, Zeitgenössisches Theater.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Inszenierung von Thomas Ostermeiers "Nora"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Transformation von Henrik Ibsens "Ein Puppenheim" in Thomas Ostermeiers zeitgenössische Inszenierung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Originaltextes mit der postmodernen Umsetzung unter Berücksichtigung postdramatischer Elemente. Es wird untersucht, wie Ostermeier eine erfolgreiche, zeitgenössische Inszenierung schafft, die eng an Ibsens Text anknüpft und den Wandel des Theaters als Medienform beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entwicklung des Theaters als Medienform, den Vergleich zwischen Ibsens "Ein Puppenheim" und Ostermeiers Inszenierung, die Anwendung postdramatischer Elemente in Ostermeiers Inszenierung, die Analyse von Text, Sprache, Gestik, Bühnenbild und der Raum-Zeit-Beziehung im Theater sowie die Medienrelevanz der Inszenierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Themenübersicht (Ziele und Absichten), Das Drama um „Nora“ (inkl. Ibsens Biografie, Entstehungsgeschichte des Stücks und dramentheoretische Grundlagen), „Nora“ oder „ein Puppenheim“? Ibsens Drama im 21. Jahrhundert (Analyse von Ostermeiers Inszenierung mit Fokus auf postdramatischen Elementen wie Körper, Bühnenbild, Raum, Zeit und Medien), Fazit und Quellen.
Welche Aspekte von Ostermeiers Inszenierung werden analysiert?
Die Analyse von Ostermeiers Inszenierung konzentriert sich auf postdramatische Elemente. Dies beinhaltet die Untersuchung des sprechenden und bewegten Körpers der Schauspieler, des Bühnenbilds, der Beziehung zwischen Bühnenraum und Zuschauerraum sowie die Einbeziehung neuer Medien wie Musik und Fotografie. Es wird gezeigt, wie Ostermeier Ibsens Text neu interpretiert und für ein zeitgenössisches Publikum zugänglich macht.
Welche dramentheoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Aristoteles' „Poetik“, um den analytischen Rahmen für die Untersuchung von Ibsens Drama zu etablieren. Darüber hinaus wird die postdramatische Dramentheorie angewendet, um Ostermeiers Inszenierung zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Henrik Ibsen, Ein Puppenheim, Nora, Thomas Ostermeier, Postdramatisches Theater, Dramenanalyse, Inszenierung, Schauspiel, Körper, Bühnenbild, Raum, Zeit, Medien, Moderne, Zeitgenössisches Theater.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Transformation von Ibsens "Ein Puppenheim" in eine zeitgenössische Inszenierung zu analysieren und den Wandel des Theaters als Medienform zu beleuchten. Es soll ein Vergleich zwischen dem Originaltext und der Inszenierung von Thomas Ostermeier erstellt werden, wobei die postdramatische Dramentheorie als analytisches Werkzeug dient.
- Citation du texte
- Amely Braunger (Auteur), 2005, Die "neue" Nora. Eine zeitgenössische Inszenierung von Henrik Ibsens "Ein Puppenheim" aus dem 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53017