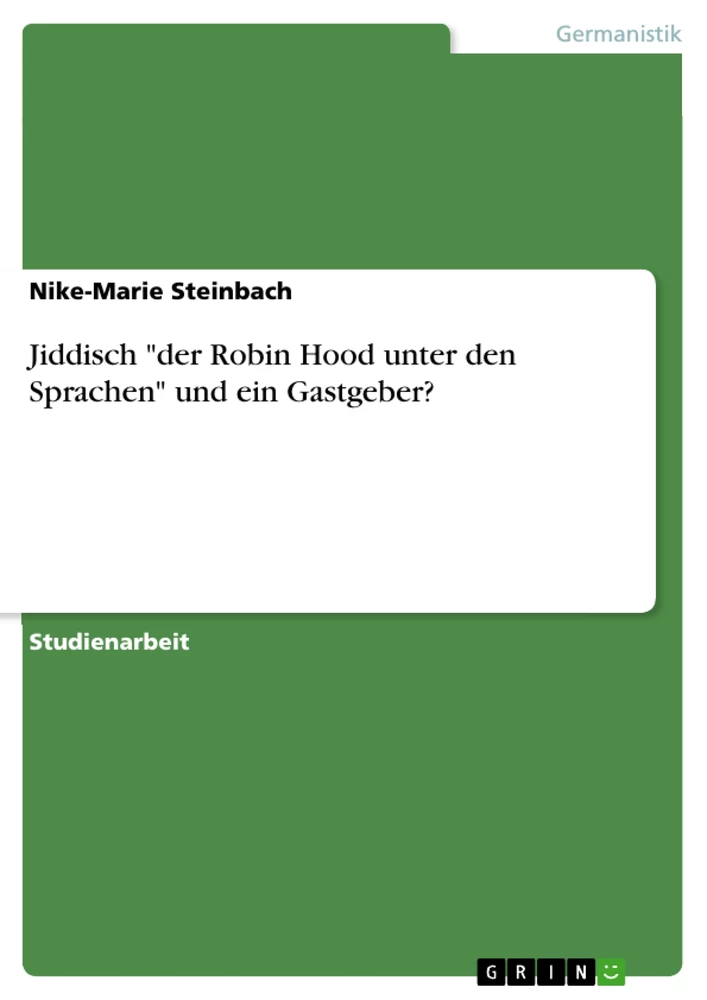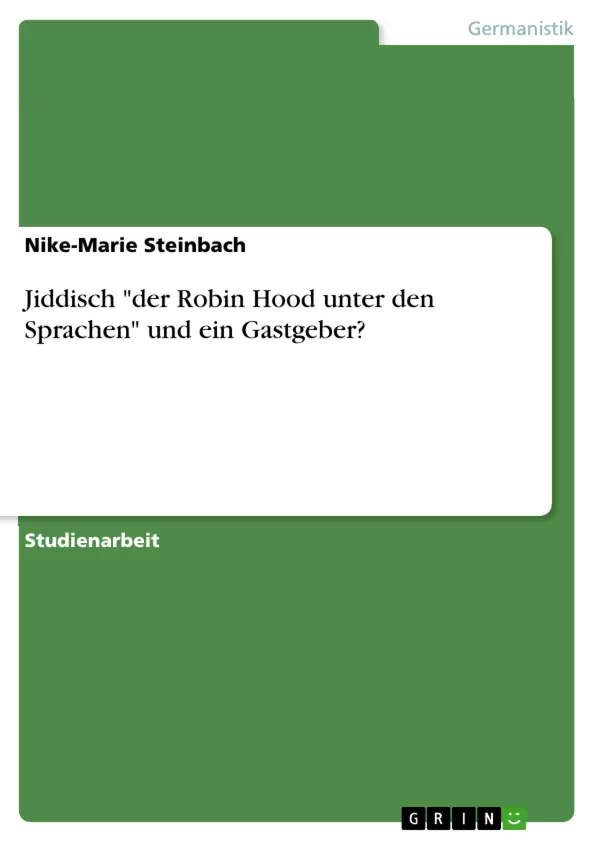Robin Hood, der Held vieler englischer Balladen, beraubt weltliche und geistliche Herren um
mit deren Überfluss die Armen zu unterstützen. Hier wird das Jiddische als solch
ein Gerechtigkeitskämpfer dargestellt, der von reichen Sprachen oder deren Sprechern nimmt
und den Armen gibt. Was aber macht eine Sprache zu einer Wohlhabenden, zu einer die 'zu
viel des Guten' besitzt? Enteignet das Jiddische anderen Sprache manche Teile? Oder vielmehr deren Sprecher? Und wen begünstigt es mit dem Diebesgut? Eine weniger vermögende
Sprache oder eine an 'Spracharmut' leidende Gemeinschaft? Oder begünstigt der Krieger der
Gleichberechtigung namens Jiddisch hier nicht zuletzt sich selbst, beziehungsweise seine
Sprecher?
Gleichzeitig gibt sich Robin Hood hier als Gastfreund, der ohne Einschränkung und ohne Anforderung einer Gegenleistung jeden, der bei ihm anklopft, empfängt, ihm Quartier und Nahrung bietet. Demnach muss das Jiddische ja jede Sprache, die ihm begegnet, nicht nur vollständig aufnehmen, sondern zusätzlich bereichern. Gäste gehen aber wieder, und die wenigsten unter ihnen hinterlassen tatsächlich prägende Spuren bei ihrem ehemaligen Gastgeber.
Dies hieße, dass das Jiddische andere Sprachsysteme zuerst in das Seine aufnimmt, sie dann
aber wieder tilgt.
Inwieweit darf oder kann das Jiddische nun als Robin Hood, inwieweit es als Gastgeber bezeichnet werden ?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein kleiner historischer Abriss
- Das Jiddische als Gastgeber
- Die Hebräische Komponente
- in der Graphemik
- in der Lexik
- in der Morphologie
- Die romanische Komponente
- Die deutsche Komponente
- Die slawische Komponente
- in der Lexik
- Eine osteuropäisches Erscheinung in der Syntax
- Die Hebräische Komponente
- Das Jiddische als ein veritabler „Schmelztigel“?
- Exkurs: Identität durch Sprache
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Geschichte und Struktur der jiddischen Sprache. Sie analysiert das Jiddische als eine „Mischsprache“, die Einflüsse verschiedener Sprachen aufgenommen hat. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Jiddischen als „Gastgeber“ für andere Sprachsysteme und untersucht die Frage, inwieweit das Jiddische als eine eigenständige Sprache angesehen werden kann.
- Die historischen Wurzeln des Jiddischen
- Die sprachlichen Komponenten des Jiddischen
- Der Einfluss des Jiddischen auf die Sprechergemeinschaft
- Die Frage der Identität durch Sprache
- Der Wandel des Jiddischen im Laufe der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt mit einem Zitat in das Thema ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor.
- Das Kapitel „Ein kleiner historischer Abriss“ beleuchtet die historische Entwicklung der jiddischen Sprache und zeigt, wie sie sich durch den Einfluss verschiedener Sprachen geformt hat.
- Das Kapitel „Das Jiddische als Gastgeber“ untersucht die einzelnen Komponenten des Jiddischen und analysiert, welche Sprachen auf die Entwicklung der jiddischen Sprache Einfluss genommen haben.
- Das Kapitel „Das Jiddische als ein veritabler „Schmelztigel“?“ analysiert die Frage, inwieweit das Jiddische als eine Mischsprache angesehen werden kann.
- Der Exkurs „Identität durch Sprache“ beleuchtet die Rolle des Jiddischen als Ausdruck der jüdischen Identität.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Jiddisch, Sprache, Geschichte, Entwicklung, Sprachstruktur, Hebräisch, Deutsch, Romanisch, Slawisch, Mischsprache, Identität, Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Jiddisch als „Robin Hood unter den Sprachen“ bezeichnet?
Die Metapher beschreibt Jiddisch als eine Sprache, die sich Elemente aus „reichen“ Sprachen nimmt und sie in ihr eigenes System integriert, um der Gemeinschaft zu dienen.
Aus welchen Sprachen setzt sich Jiddisch zusammen?
Jiddisch ist eine Mischsprache mit hebräischen, deutschen, romanischen und slawischen Komponenten in Wortschatz, Grammatik und Schrift.
Was bedeutet Jiddisch als „Gastgeber“?
Es bedeutet, dass die Sprache offen für Einflüsse anderer Sprachsysteme ist, diese aufnimmt und beherbergt, ohne ihre eigene Identität zu verlieren.
Welche Rolle spielt Jiddisch für die jüdische Identität?
Jiddisch fungiert als kultureller Schmelztiegel und ist ein wesentlicher Ausdruck der Identität und Geschichte der jüdischen Sprechergemeinschaft.
Gibt es slawische Einflüsse im Jiddischen?
Ja, besonders in der Lexik (Wortschatz) und der Syntax (Satzbau) sind deutliche osteuropäisch-slawische Einflüsse erkennbar.
- Arbeit zitieren
- Nike-Marie Steinbach (Autor:in), 2005, Jiddisch "der Robin Hood unter den Sprachen" und ein Gastgeber?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53025