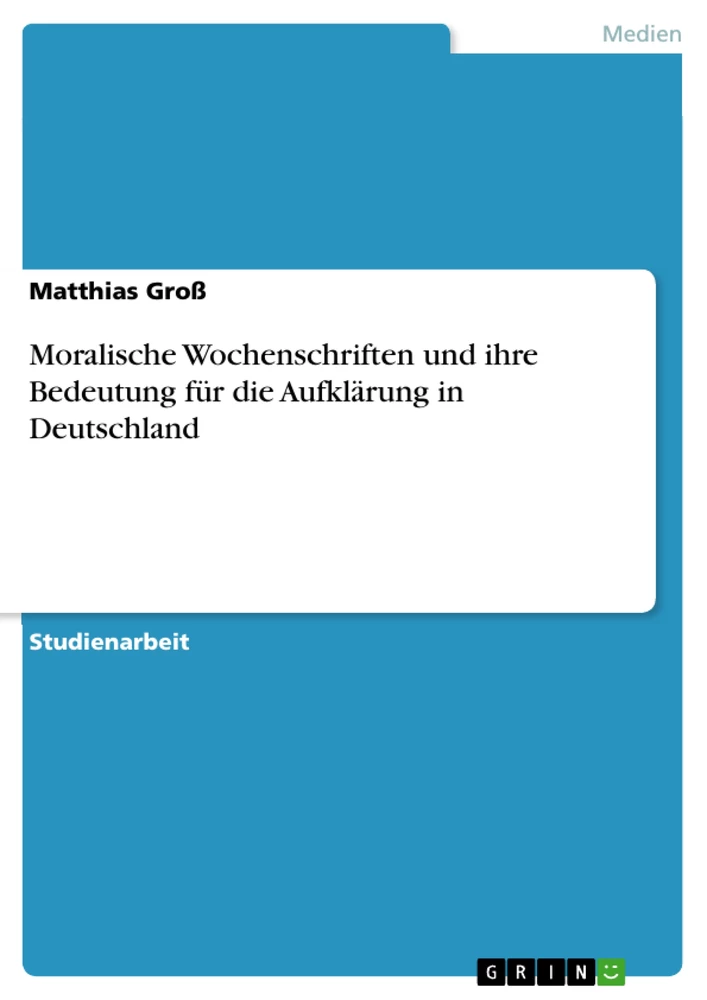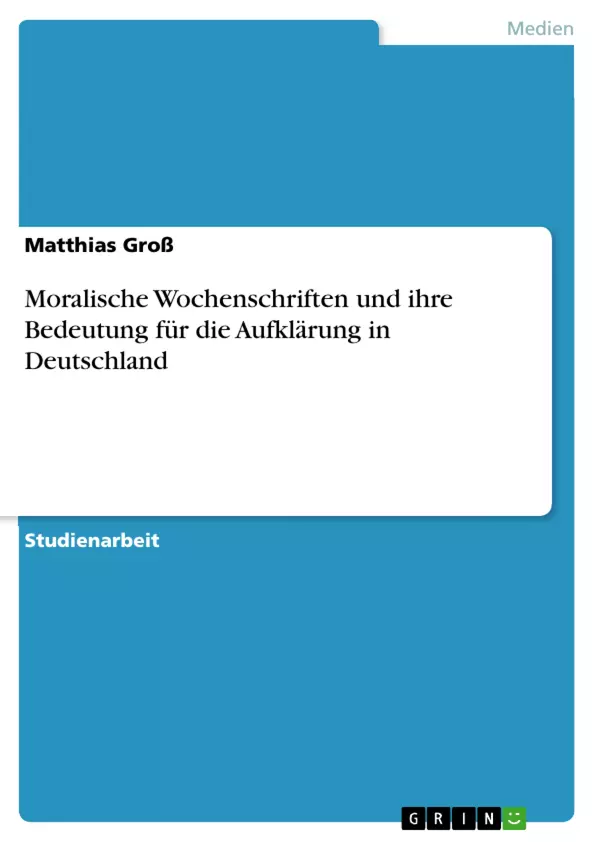Als ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung des bürgerlichen Selbstverständnisses im 18. Jahrhundert ist zweifelsohne der Zeitschriftentypus der Moralischen Wochenschriften anzuführen. Mit Beiträgen zu verschiedensten Fragen des täglichen Lebens und dem Charakter eines Ratgebers propagierten diese nicht nur Bildung und die gesellschaftliche Anerkennung der Frau, sondern behandelten ebenso moralische und religiöse Angelegenheiten. Außerdem trugen sie in großem Maße dazu bei, in breiten Kreisen des Bürgertums das Interesse an Kultur und Literatur zu wecken. Sie lieferten ebenso ein vorparlamentarisches Diskussionsforum auch für jene Teile des Bürgertums, die von der politischen Macht ausgeschlossen waren. Besonders in Deutschland waren die Blätter in ihrer Blütezeit sehr beliebt und verbreiteten hier wie im übrigen Europa mit ihren Beiträgen die Ideen der Aufklärung und erwiesen sich somit als maßgebliches Beeinflussungsorgan der öffentlichen Meinung.
Nachfolgend soll die Ausdifferenzierung und Entstehung der Moralischen Wochenschriften sowie ihre Wegweiser und deren Inhalte erläutert werden. Weiterhin soll auch ein Augenmerk auf den gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge der Aufklärung, wie beispielsweise das neue aufgeklärte Bürgertum und die Entstehung einer (politischen) Öffentlichkeit, liegen. Dabei soll die Rolle der Moralischen Wochenschriften bezüglich dieser Umstrukturierungen, zumindest am Beispiel Deutschlands, herausgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Moralische Wochenschriften
- Entstehung eines neuen Zeitschriftentyps
- Aufbau und Inhalt Moralischer Wochenschriften
- Die Aufklärung in Deutschland
- Das Bürgertum
- Entstehung einer Öffentlichkeit
- Die Rolle der Moralischen Wochenschriften in diesem Kontext (Zusammenfassung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Moralischen Wochenschriften des 18. Jahrhunderts in Deutschland und deren Bedeutung für die Aufklärung. Ziel ist es, die Entstehung dieses neuen Zeitschriftentyps zu beleuchten, seinen Aufbau und Inhalt zu analysieren und seine Rolle im gesellschaftlichen Wandel der Aufklärung herauszustellen.
- Entstehung und Entwicklung der Moralischen Wochenschriften
- Inhalt und Struktur der Moralischen Wochenschriften
- Die Moralischen Wochenschriften und das Bürgertum
- Der Einfluss der Moralischen Wochenschriften auf die öffentliche Meinung
- Die Moralischen Wochenschriften als Medium der Aufklärung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Moralischen Wochenschriften als wichtigen Faktor für die Entwicklung des bürgerlichen Selbstverständnisses im 18. Jahrhundert ein. Sie beschreibt deren Funktion als Ratgeber, ihren Beitrag zur Verbreitung von Bildung und Literatur im Bürgertum und ihre Rolle als Diskussionsforum. Die Arbeit kündigt die Analyse der Entstehung, des Inhalts und der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Zeitschriften an, mit besonderem Fokus auf den deutschen Kontext und die Aufklärung.
Moralische Wochenschriften: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung der Moralischen Wochenschriften, die als "Kind der englischen Aufklärung" betrachtet werden, beeinflusst von Publikationen wie "The Tatler" und "The Spectator". Es werden jedoch auch frühe deutsche Ansätze, wie Thomasius' "Monatsgespräche" und Frischs "Erbaulichen Ruhstunden", als Vorläufer genannt. Das Kapitel hebt die Verbreitung der Moralischen Wochenschriften im deutschsprachigen Raum, insbesondere in protestantischen Städten wie Hamburg und Leipzig, hervor und diskutiert deren Konkurrenz und relativ kurze Lebensdauer, wobei es Beispiele für erfolgreiche und weniger erfolgreiche Titel nennt. Die Adaption englischer Modelle an deutsche Verhältnisse wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Moralische Wochenschriften, Aufklärung, Bürgertum, Öffentlichkeit, Journalismus, Medien, Deutschland, 18. Jahrhundert, „The Tatler“, „The Spectator“, publizistische Kultur, gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Moralische Wochenschriften des 18. Jahrhunderts"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Moralischen Wochenschriften des 18. Jahrhunderts in Deutschland und ihre Bedeutung für die Aufklärung. Sie beleuchtet die Entstehung dieses neuen Zeitschriftentyps, analysiert Aufbau und Inhalt und untersucht die Rolle der Schriften im gesellschaftlichen Wandel der Aufklärung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Moralischen Wochenschriften, ihren Inhalt und ihre Struktur, ihren Bezug zum Bürgertum, ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung und ihre Funktion als Medium der Aufklärung. Besondere Aufmerksamkeit wird der Adaption englischer Modelle an deutsche Verhältnisse gewidmet.
Welche Zeitschriften werden als Vorläufer der Moralischen Wochenschriften genannt?
Als Vorläufer werden unter anderem Thomasius' "Monatsgespräche" und Frischs "Erbaulichen Ruhstunden" genannt. Die Arbeit betont aber auch den starken Einfluss englischer Publikationen wie "The Tatler" und "The Spectator".
Wo und wie wurden Moralische Wochenschriften verbreitet?
Die Moralischen Wochenschriften verbreiteten sich vor allem im deutschsprachigen Raum, insbesondere in protestantischen Städten wie Hamburg und Leipzig. Die Arbeit diskutiert auch ihre relativ kurze Lebensdauer und die Konkurrenz zwischen verschiedenen Titeln.
Welche Rolle spielten die Moralischen Wochenschriften im Kontext der Aufklärung?
Die Arbeit betont die Rolle der Moralischen Wochenschriften als Ratgeber, als Beitrag zur Verbreitung von Bildung und Literatur im Bürgertum und als Diskussionsforum. Sie analysiert ihren Einfluss auf die Entwicklung des bürgerlichen Selbstverständnisses und die Entstehung einer öffentlichen Meinung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Moralische Wochenschriften (einschließlich Entstehung und Inhalt), ein Kapitel über die Aufklärung in Deutschland (mit Fokus auf Bürgertum und Öffentlichkeit) und eine Zusammenfassung der Rolle der Moralischen Wochenschriften in diesem Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Moralische Wochenschriften, Aufklärung, Bürgertum, Öffentlichkeit, Journalismus, Medien, Deutschland, 18. Jahrhundert, „The Tatler“, „The Spectator“, publizistische Kultur, gesellschaftlicher Wandel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entstehung, den Aufbau, den Inhalt und die gesellschaftliche Bedeutung der Moralischen Wochenschriften des 18. Jahrhunderts in Deutschland zu untersuchen und ihre Rolle im Kontext der Aufklärung herauszustellen.
- Citar trabajo
- Matthias Groß (Autor), 2003, Moralische Wochenschriften und ihre Bedeutung für die Aufklärung in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53064