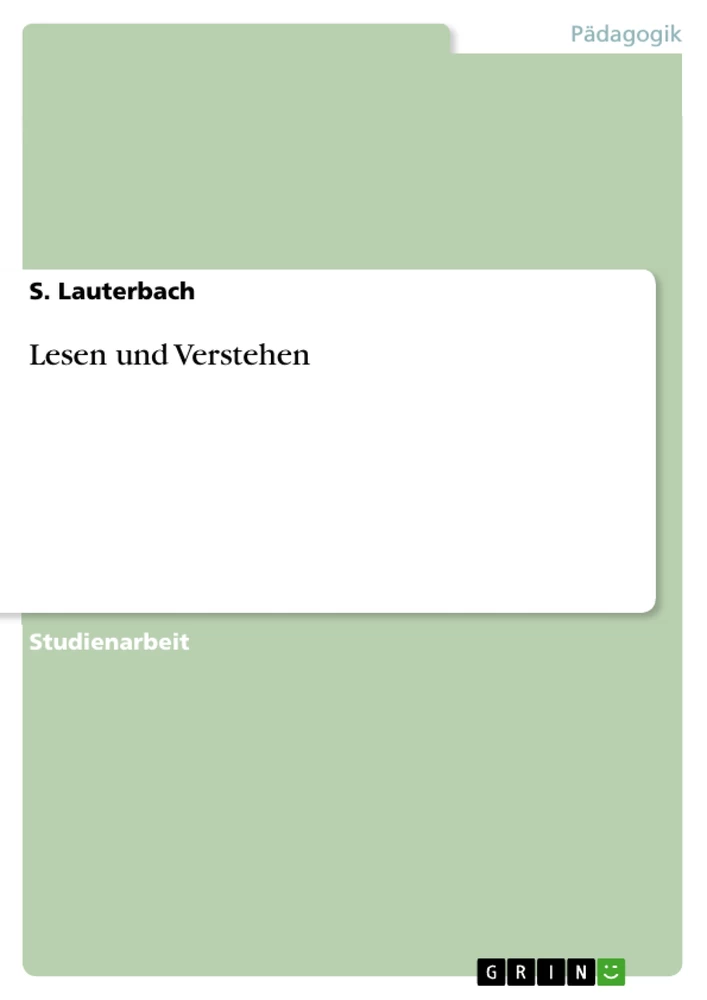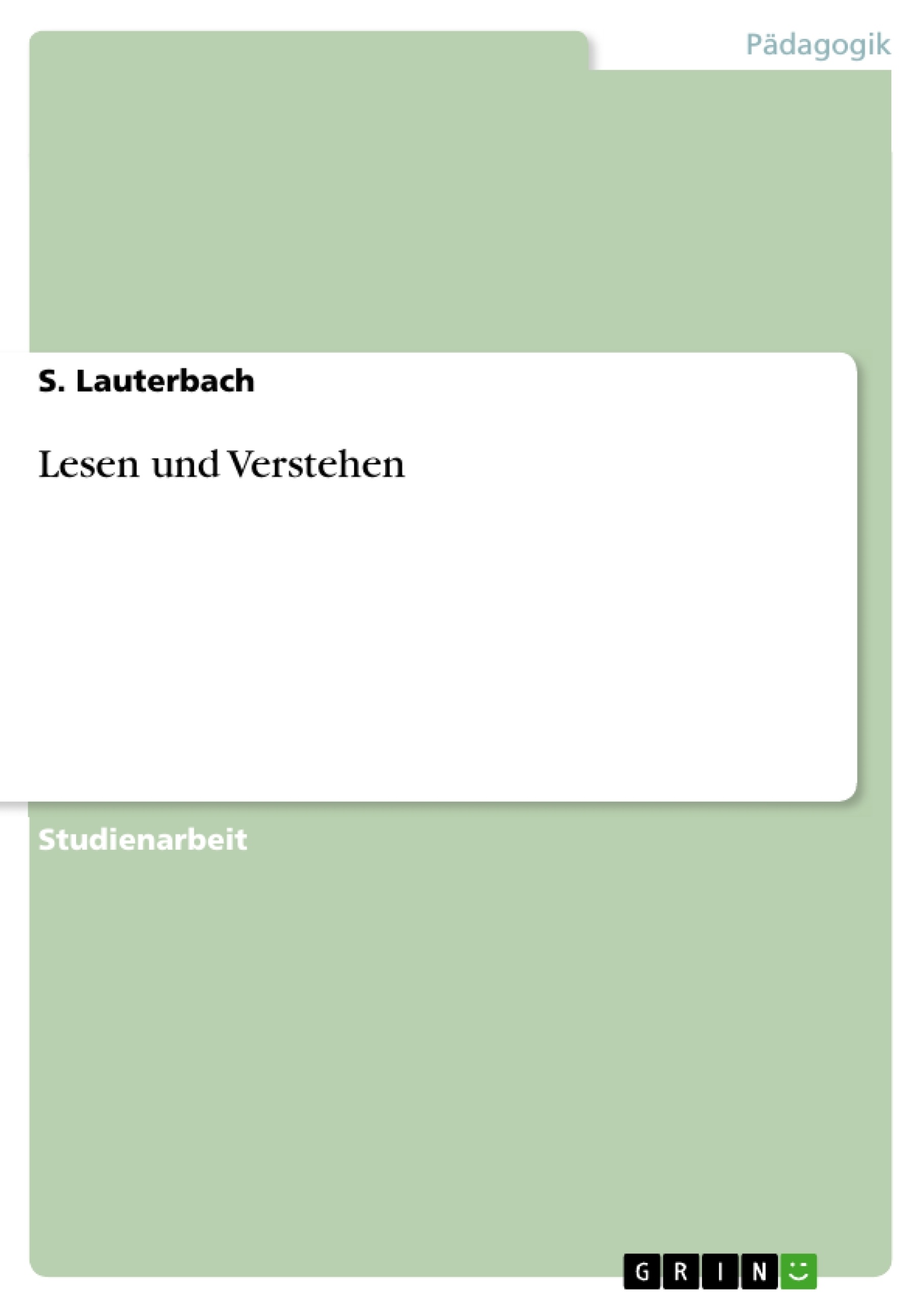Das Lesen ist eine der wichtigsten Kulturtechniken unserer Gesellschaft, doch im Zeitalter von Rundfunk, Fernsehen und Computer scheint es immer mehr an Bedeutung zu verlieren. Damit sich unsere Lesekultur aber als interessante Freizeitbeschäftigung behaupten kann, bedarf es einer Stärkung und Weiterentwicklung. [Vgl. Staatsinstitut (1989), S. 5.] Der Schule, insbesondere der Grundschule, kommt deswegen eine große Bedeutung zu: Neben der Vermittlung der Lesetechnik hat sie auch dafür Sorge zu tragen, die Lesebereitschaft und das Leseinteresse ihrer Schüler zu fördern, um damit auch die Schüler zu einer langfristigen Beschäftigung mit Literatur anzuregen. Je früher die Vermittlung von Lesefreude und die Hinführung zum Buch geschehen, desto effektiver ist sie. Auf ein Kind, das am Ende der Grundschulzeit noch nicht zum Buch gefunden hat, wird es wahrscheinlich später auch nicht mehr anziehend wirken. [Vgl. Staatsinstitut (1989), S. 5.]
Aber gerade das Lesen ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar: "Wann immer wir etwas erfahren, etwas lernen wollen, sind wir auf das Lesen, auf das Buch als Kulturträger angewiesen." [Staatsinstitut (1989), S. 6.]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Leseerziehung
- Lesemotivation und Leseverhalten
- Außerschulisches Leseverhalten und Lesemotive
- Soziokulturelle und psychologische Gesichtspunkte der Leseentwicklung
- Faktoren der (Lese-)motivation
- Schulische Möglichkeiten der Leseerziehung
- Der erste Leseunterricht
- Der Anspruch der Leseförderung
- Erschwernisse beim Aufbau und bei der Förderung der Lesemotivation
- Lesemotivierende Anregungen für den Unterricht
- Erzählen oder Vorlesen von Geschichten
- Lesefreude durch das Lesebuch
- Kreativer Umgang mit altersgemäßen Texten
- Lesen und Verstehen - Ein Diagnose- und Trainingsprogramm
- Kurzbeschreibung des Programms
- Intention der Diagnose
- Anlage des Diagnoseteils
- Gezielte Beobachtung des Leseverhaltens und pädagogische Konsequenzen
- Durchführung der Diagnose
- Auswertung
- Der Rechtschreibunterricht
- Das rechtschriftliche Lernen
- Notwendige Arbeitstechniken
- Rechtschriftliche Übungsformen zur Festigung des Schriftbildes
- Übungsformen der Analogiebildung
- Übungsformen der Kombination
- Übungsformen der Provokation
- Übungsformen der Klassifizierung
- Übungsformen der Komplettierung
- Rätselformen als Übungskategorie
- Das Marburger Rechtschreibtraining - Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder
- Kurzbeschreibung des Marburger Rechtschreibtrainings
- Konzept des Trainingsprogramms
- Theoretische Einordnung des Regeltrainings
- Untersuchungen zur Wirksamkeit des Marburger Rechtschreibtrainings
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Lesens in der heutigen Zeit und erörtert die Herausforderungen und Chancen der Leseerziehung. Sie beleuchtet die Rolle der Schule und der Familie in der Entwicklung von Lesemotivation und Lesekompetenz bei Kindern. Darüber hinaus wird ein Diagnose- und Trainingsprogramm vorgestellt, das die Förderung des Leseverständnisses und der Rechtschreibung zum Ziel hat.
- Die Bedeutung des Lesens in der heutigen Gesellschaft
- Die Rolle der Schule und der Familie in der Leseerziehung
- Faktoren, die die Lesemotivation beeinflussen
- Diagnose und Förderung von Leseverständnis und Rechtschreibung
- Das Marburger Rechtschreibtraining als regelgeleitetes Förderprogramm
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Leseerziehung ein und beleuchtet die Bedeutung des Lesens für das Individuum und die Gesellschaft. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer aktiven Leseerziehung, um den Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln und ihnen den Zugang zur Welt der Literatur zu ermöglichen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Lesemotivation und dem Leseverhalten von Kindern, wobei verschiedene Faktoren wie das außerschulische Umfeld, die soziokulturelle Entwicklung und die psychologischen Aspekte der Leseentwicklung beleuchtet werden. Das dritte Kapitel widmet sich den schulischen Möglichkeiten der Leseerziehung. Hier werden der erste Leseunterricht, der Anspruch der Leseförderung und die Herausforderungen bei der Entwicklung von Lesemotivation behandelt. Des Weiteren werden verschiedene lesemotivierende Anregungen für den Unterricht vorgestellt, wie beispielsweise das Erzählen oder Vorlesen von Geschichten, die Verwendung von Lese-büchern und der kreative Umgang mit Texten. Das vierte Kapitel stellt ein Diagnose- und Trainingsprogramm für Lesen und Verstehen vor. Die Intention, die Anlage des Diagnoseteils, die Durchführung und die Auswertung werden ausführlich erläutert. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Rechtschreibunterricht. Es werden verschiedene Arbeitstechniken und Übungsformen vorgestellt, die der Festigung des Schriftbildes dienen. Das sechste Kapitel präsentiert das Marburger Rechtschreibtraining als regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder. Die Kurzbeschreibung, das Konzept, die theoretische Einordnung und die Ergebnisse von Untersuchungen zur Wirksamkeit des Programms werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Lesemotivation, Leseerziehung, Leseverständnis, Rechtschreibung, Diagnose, Training, Förderung, Schule, Familie, Kinder.
Häufig gestellte Fragen
Warum verliert das Lesen in der heutigen Zeit an Bedeutung?
Durch die Konkurrenz von Rundfunk, Fernsehen und Computern wird das Lesen oft als weniger attraktive Freizeitbeschäftigung wahrgenommen.
Welche Rolle spielt die Grundschule bei der Leseerziehung?
Die Grundschule muss nicht nur die Lesetechnik vermitteln, sondern vor allem Lesefreude wecken, da Kinder, die in dieser Zeit keinen Zugang zum Buch finden, dies später kaum nachholen.
Was beeinflusst die Lesemotivation von Kindern?
Wichtige Faktoren sind das außerschulische Umfeld (Elternhaus), soziokulturelle Bedingungen sowie psychologische Aspekte der individuellen Entwicklung.
Was ist das Marburger Rechtschreibtraining?
Es ist ein regelgeleitetes Förderprogramm, das speziell für rechtschreibschwache Kinder entwickelt wurde, um deren Schriftbild durch systematisches Üben zu festigen.
Wie kann man Lesefreude im Unterricht fördern?
Durch Methoden wie das Vorlesen von Geschichten, den kreativen Umgang mit Texten und die Nutzung ansprechender Lesebücher.
- Citation du texte
- S. Lauterbach (Auteur), 2005, Lesen und Verstehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53340