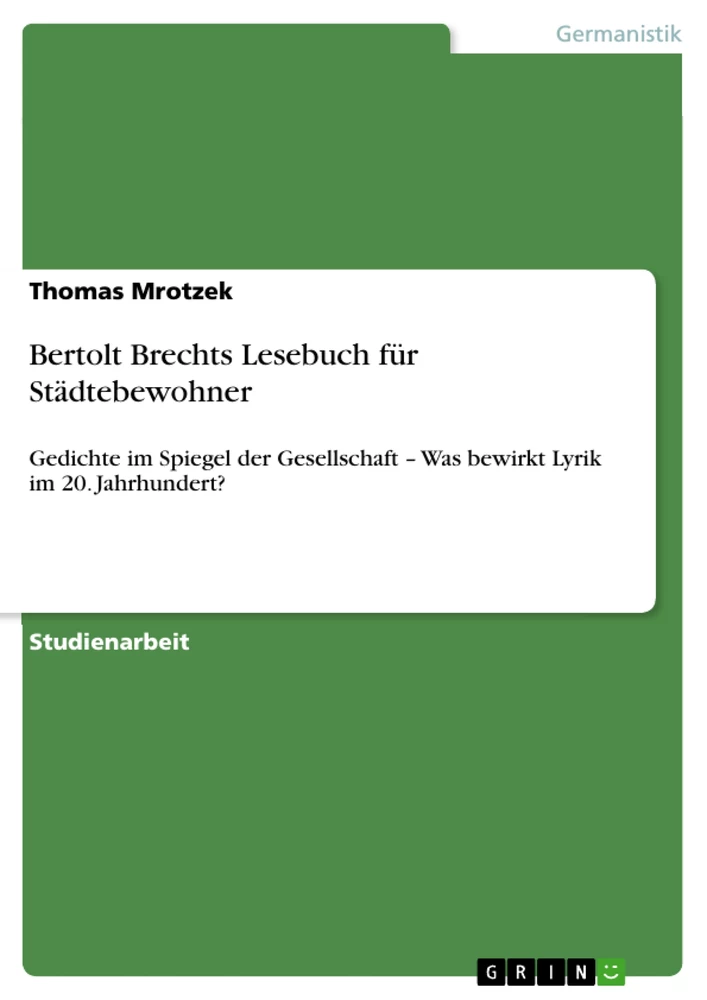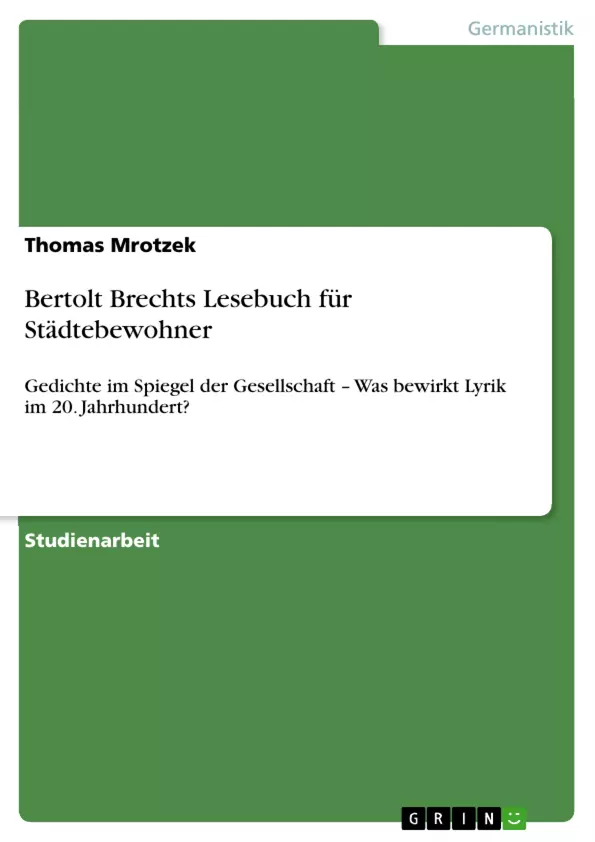Die Tradition der Großstadtlyrik nahm in der deutschen Literatur einen großen Raum ein. Insbesondere um die Jahrhundertwende und nach dem Ersten Weltkrieg spielte diese Form der Poesie eine wichtige Rolle. Urbanisierung, Massenelend, gesellschaftliche Randgruppen und ausschweifende Lebensgestaltung waren sowohl kennzeichnend für diesen Stil der Lyrik als auch für eine ganze Epoche selbst. In dieser Zeit wirkte Bertolt Brecht und auch er versuchte, seine ersten Großstadterfahrungen zu verarbeiten bzw. den Lebensstil zu beschreiben.
Ein zentrales Werk bildet die Gedichtsammlung „Aus dem Lesebuch für Städtebewohner“, welches im Zeitraum von 1921 bis 1928 entstand. Diese Anthologie vermittelt einen Eindruck, wie es in der Weimarer Republik in den Goldenen Zwanzigern zuging.
In der Seminararbeit Bertolt Brechts Lesebuch für Städtebewohner. Gedichte im Spiegel der Gesellschaft - Was bewirkt Lyrik im 20. Jahrhundert? soll das Lesebuch für Städtebewohner analysiert und daraufhin untersucht werden, welche Wirkungsabsichten von diesem Werk ausgehen. Parallel dazu wird herausgearbeitet, inwieweit die Neue Sachlichkeit – eine Tendenz in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts - zum Tragen kommt. Weiterhin untersucht die Darstellung, ob und welche Gruppen der Gesellschaft angesprochen und welche Ansprüche bzw. Anforderungen an das Publikum gestellt werden. Die Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe bildet die textliche Grundlage der Seminararbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vorbetrachtungen und theoretische Annäherung an den Begriff Neue Sachlichkeit
- 1.1 Historischer Kontext – die Goldenen Zwanziger
- 1.2 Begriff Neue Sachlichkeit
- 2. Allgemeine Analyse
- 2.1 Allgemeine Analyse der Gedichtanthologie
- 2.2 Trenne dich von deinen Kameraden
- 2.3 Ich bin ein Dreck
- 2.4 Zusammenfassung der Analyse
- 4. Schlussbetrachtung
- Anhang
- Textquellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Analyse von Bertolt Brechts „Lesebuch für Städtebewohner“ und untersucht die Wirkungsabsichten des Werkes. Sie analysiert, wie die Neue Sachlichkeit als Tendenz der 20er Jahre in den Gedichten zum Tragen kommt und welche gesellschaftlichen Gruppen angesprochen werden. Dabei wird die „Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe“ als textliche Grundlage verwendet.
- Analyse von Brechts „Lesebuch für Städtebewohner“
- Wirkungsabsichten des Werkes
- Einfluss der Neuen Sachlichkeit
- Angesprochene gesellschaftliche Gruppen
- Interpretation der Gedichte im Kontext der Großstadtlyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Tradition der Großstadtlyrik in der deutschen Literatur vor und erläutert den historischen Kontext der Gedichtsammlung. Sie beschreibt die Entstehung des „Lesebuchs für Städtebewohner“ und die zentrale Rolle der Weimarer Republik in den Goldenen Zwanzigern. Die Arbeit erläutert die Zielsetzung und Forschungsfragen der Analyse.
Kapitel 1 widmet sich den Vorbetrachtungen und der theoretischen Annäherung an den Begriff der Neuen Sachlichkeit. Es beleuchtet den historischen Kontext der 1920er Jahre und definiert den Begriff der Neuen Sachlichkeit.
Kapitel 2 beinhaltet eine allgemeine Analyse der Gedichtanthologie, die verschiedene Einzelcharaktere in der Großstadt beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf zwei Gedichte, „Trenne dich von deinen Kameraden“ und „Ich bin ein Dreck“, um die Themen und Motive des Werkes exemplarisch zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Großstadtlyrik, Neue Sachlichkeit, Bertolt Brecht, „Lesebuch für Städtebewohner“, Weimarer Republik, 1920er Jahre, Gesellschaftskritik, Individuum, Großstadt, Urbanisierung, Randgruppen, Medienexperiment, Handlungsanweisungen, Sprecherkonstellation.
- Citation du texte
- Thomas Mrotzek (Auteur), 2006, Bertolt Brechts Lesebuch für Städtebewohner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53359