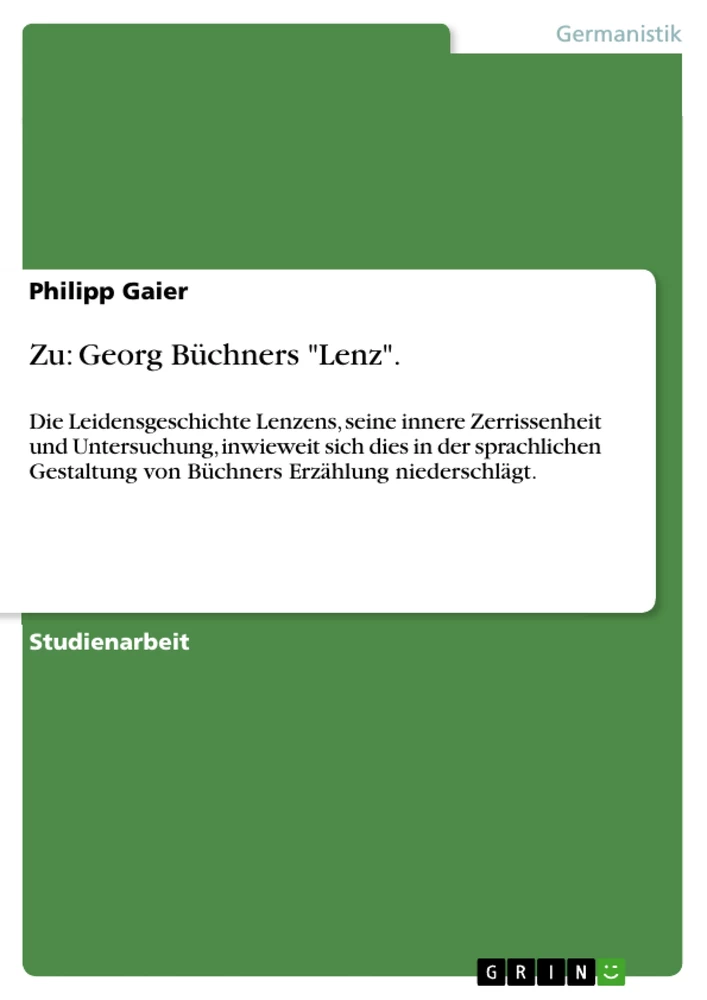Büchners Werk Lenz, welches in dem Zeitraum „Sommer 1835 und Frühjahr 1836“1 in Straßburg entstand und die einzige Erzählung im Repertoire des Autors darstellt2, basiert zum größten Teil auf den Aufschriften des Pfarrers Friedrich Oberlin, in dessen elsässisches Heimatdorf der Sturm und Drang – Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz im Jahre 1778 gelangte und wo es zum Ausbruch seiner geistigen Krankheit kam.3 „Der Pfarrer Oberlin [...] hat die Schreie, Ausrufe, Erschütterungen, Selbstmordversuche eines vom Wahnsinn Bedrohten aufgezeichnet“4. Büchners Werk wird auch als „erste klinisch exakte Fallbeschreibung der Schizophrenie“5 betrachtet. Diese Arbeit soll die Leidensgeschichte Lenzens, seine innere Zerrissenheit aufzeigen, wobei auch untersucht werden soll, inwieweit sich dies in der sprachlichen Gestaltung von Büchners Erzählung niederschlägt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Stationen des Leidens
- Der Wanderer
- Lenz und Oberlin
- Die Predigt
- Das Kunstgespräch
- Das kranke Mädchen
- Die gescheiterte Wiederauferweckung
- Der „Riss“
- Die Sprache/Erzählsituation
- Syntax
- Wortfelder
- Erzählperspektive
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Georg Büchners Erzählung „Lenz“, die die Leidensgeschichte des Sturm und Drang Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz schildert. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Lenzens innerer Zerrissenheit und dem Einfluss dieser auf die sprachliche Gestaltung der Erzählung.
- Die Darstellung der geistigen Krankheit Lenzens und ihre Symptome
- Die Rolle der Natur in der Erzählung und ihr Einfluss auf Lenzens Psyche
- Die sprachliche Gestaltung der Erzählung und ihre Funktion in der Darstellung von Lenzens innerem Zustand
- Die Bedeutung der Begegnung mit dem Pfarrer Oberlin für Lenzens Entwicklung
- Die Kritik am Idealismus in Lenzens Fall
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Der Wanderer“ beschreibt den Anfang von Lenzens Leidensweg. Er zeigt sich orientierungslos, sein Wahrnehmung der Welt ist verzerrt. Die Natur erscheint zunächst trostlos, später jedoch romantisch und aufwühlend. Lenz versucht sich mit der Natur zu verbinden, versinkt jedoch in Angst und Wahnsinn.
Das Kapitel „Lenz und Oberlin“ stellt die Begegnung mit dem Pfarrer Oberlin vor, der Lenz in sein Pfarrhaus aufnimmt. Die Gegenüberstellung von Licht und Finsternis sowie deren Auswirkungen auf Lenz werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Lenz, Jakob Michael Reinhold Lenz, Schizophrenie, Idealismus, Natur, Sprache, Erzählsituation, Pfarrer Oberlin, Geisteskrankheit, Leidensgeschichte, Wahrnehmung, Orientierungslosigkeit, Angst, Wahnsinn, Licht, Finsternis.
- Citar trabajo
- Philipp Gaier (Autor), 2003, Zu: Georg Büchners "Lenz". , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53388