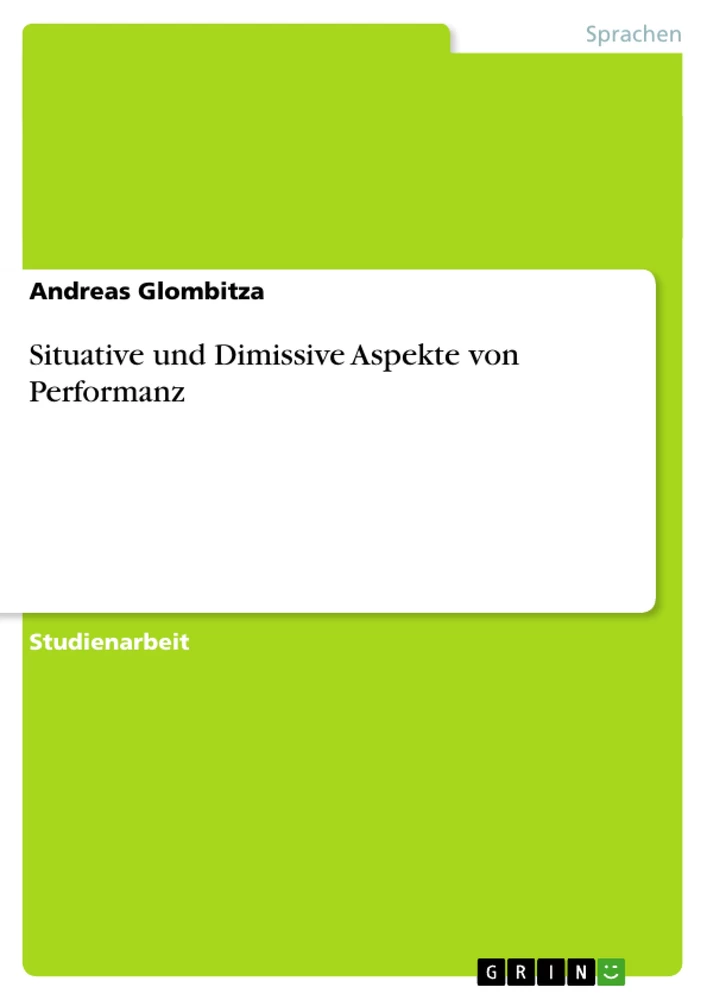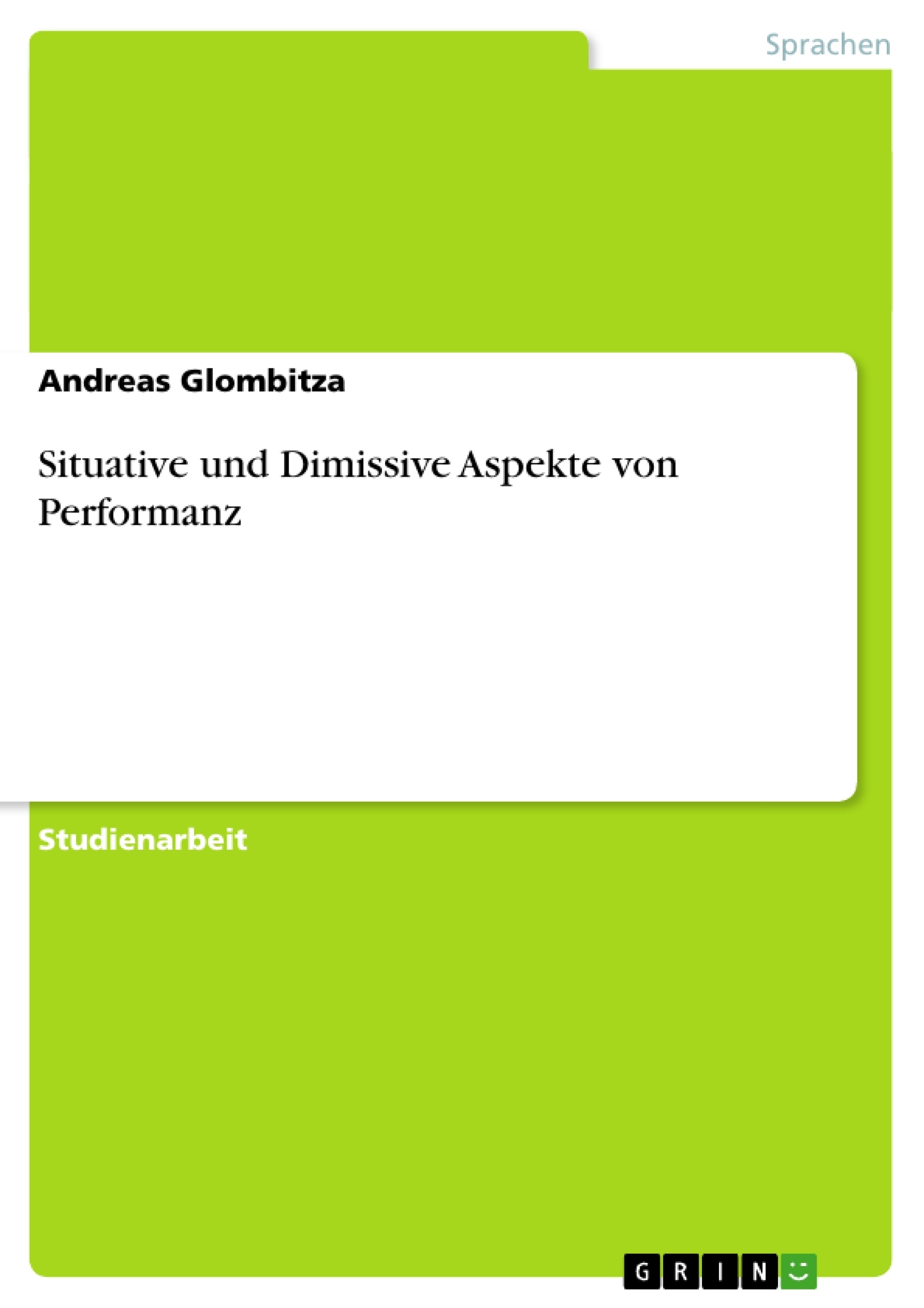Die antike Rhetoriktheorie nach Cicero unterscheidet bekanntlich fünf partes artis, deren sich drei mit Fragen der Textproduktion beschäftigen (inventio, dispositio, elocutio), einer mit der Textspeicherung (memoria) und der letzte (actio) mit der Aufführung oder Sendung. Fast das vollständige Gewicht des rhetorischen Theoriegebäudes lastet dabei auf den ersten drei partes; Speicherung und Sendung von Texten werden eher spärlich abgehandelt. Dieser Umstand scheint im krassen Widerspruch zur Persuasionsrelevanz zumindest des letzten pars zu stehen: Die römischen Rhetoriklehrer überlieferten die Anekdote, daß der berühmteste griechische Redner Demosthenes auf die Frage, was das wichtigste Element der Beredsamkeit sei, geantwortet habe: Erstens actio, zweitens actio, drittens actio!1 Die bloße Möglichkeit der persuasiven Wechselerzeugung hat die Sendung des Redetextes notwendig zur Voraussetzung. Dass der theoretische Zugriff auf diesen Sektor trotzdem recht knapp ausfiel, mag damit zusammenhängen, „[...] daß man die rhetorisch-performative Kompetenz (Aufführungskompetenz) weitgehend für eine Naturgabe hielt, die sich der rhetorischen Kunstlehre entzog“2. In den letzten Jahrzehnten hat der Begriff der „Performanz“ und des „Performativen“ in verschiedenen theoretischen Diskursen große Beachtung erfahren.
Aus Sicht der Rhetoriktheorie stellt sich die Frage, ob die genannten Performanzbegriffe mit einer rhetorischen Sichtweise überhaupt kompatibel sind und inwieweit man die teils interdisziplinären Theorieansätze zur Performanz für eine Austheoretisierung der erwähnten rhetorischen „performativen Kompetenz“ nutzbar machen kann. Gesonderte Beachtung soll dabei den Medialisierungsbedingungen situativer, also klassisch-rhetorischer Settings einerseits, und den Herausforderungen dimissiver Kommunikation andererseits gelten. Zunächst bedarf es dazu einer Bestimmung des Performanzbegriffes in seinen verschiedenen Verwendungszusammenhängen. Diese können wir auf drei Begriffsoppositionen eindampfem. Schließlich wird zu klären sein, welcher theoretische Stellenwert dem Performanzbegriff dabei jeweils zukommt. Wir werden dann kurz summieren, was die klassische Rhetorik an Theorie zu bieten hat und wie sie zur Performanz steht. Schließlich werden wir drei Basissettings beleuchten und feststellen, ob und wie man unter deren Bedingungen von Performanz sprechen kann und wo sich Anschlussmöglichkeiten ergeben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ANALYSE
- Begriffsklärung: Verwendungszusammenhänge „Performanz/performance/Performativität“
- Performance vs. Competence: Der transformationsgrammatische Performanzbegriff
- Performative vs. Constative Utterances: Der Performanzbegriff Austins
- Performanz vs. Text: Performanztheorie des Theaters
- Bewertung der Performanzbegriffe im Hinblick auf rhetorische Theoriebildung
- Performanz als Präsenz: zum rhetorischen Performanzbegriff
- Performanz in der Situation
- Performanz unter dimissiven Bedingungen
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den Performanzbegriff aus verschiedenen Perspektiven, wobei der Schwerpunkt auf der Relevanz des Begriffs für die Rhetoriktheorie liegt. Der Text untersucht die verschiedenen Verwendungszusammenhänge des Performanzbegriffs in Linguistik, Theaterwissenschaft und Kunst und erörtert, ob und inwieweit diese mit einer rhetorischen Sichtweise kompatibel sind.
- Performanzbegriff in der Linguistik
- Performanzbegriff in der Theaterwissenschaft
- Performanzbegriff in der Kunst
- Kompatibilität der Performanzbegriffe mit einer rhetorischen Sichtweise
- Relevanz des Performanzbegriffs für die Rhetoriktheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Der Text beginnt mit einer Diskussion über die Rolle der "actio" in der antiken Rhetoriktheorie und stellt fest, dass die Sendung des Redetextes als ein wichtiger Aspekt der persuasiven Wechselerzeugung in der klassischen Rhetorik oft nur unzureichend behandelt wurde. Anschließend wird die Entwicklung des Performanzbegriffs in verschiedenen theoretischen Diskursen dargestellt, darunter die Linguistik, die Theaterwissenschaft und die Kunst. Der Text stellt die Frage, ob die verschiedenen Performanzbegriffe mit einer rhetorischen Sichtweise kompatibel sind und inwieweit man die interdisziplinären Theorieansätze zur Performanz für eine Austheoretisierung der rhetorischen "performativen Kompetenz" nutzen kann.
2. Analyse
Das zweite Kapitel analysiert den Performanzbegriff in seinen verschiedenen Verwendungszusammenhängen, indem es drei Begriffsoppositionen betrachtet: Performance vs. Competence, Performative vs. Constative Utterances und Performanz vs. Text. Dabei wird der transformationsgrammatische Performanzbegriff von Noam Chomsky, der Performanzbegriff von J.L. Austin und die Performanztheorie des Theaters diskutiert. Der Text erörtert die Schwächen des transformationsgrammatischen Performanzbegriffs im Hinblick auf die Rhetorik, indem er die "human agency" und die Perspektive des Orators hervorhebt, die in Chomskys Theorie nicht berücksichtigt werden. Anschließend werden die unterschiedlichen Theorieansätze auf ihre Relevanz für die Rhetoriktheorie hin analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Performanz, Performativität, Rhetorik, Rhetoriktheorie, actio, linguistische Kompetenz, kommunikative Kompetenz, performative Sprache, Theater, Kunst, Medialisierungsbedingungen, dimissive Kommunikation.
- Citation du texte
- Andreas Glombitza (Auteur), 2006, Situative und Dimissive Aspekte von Performanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53416