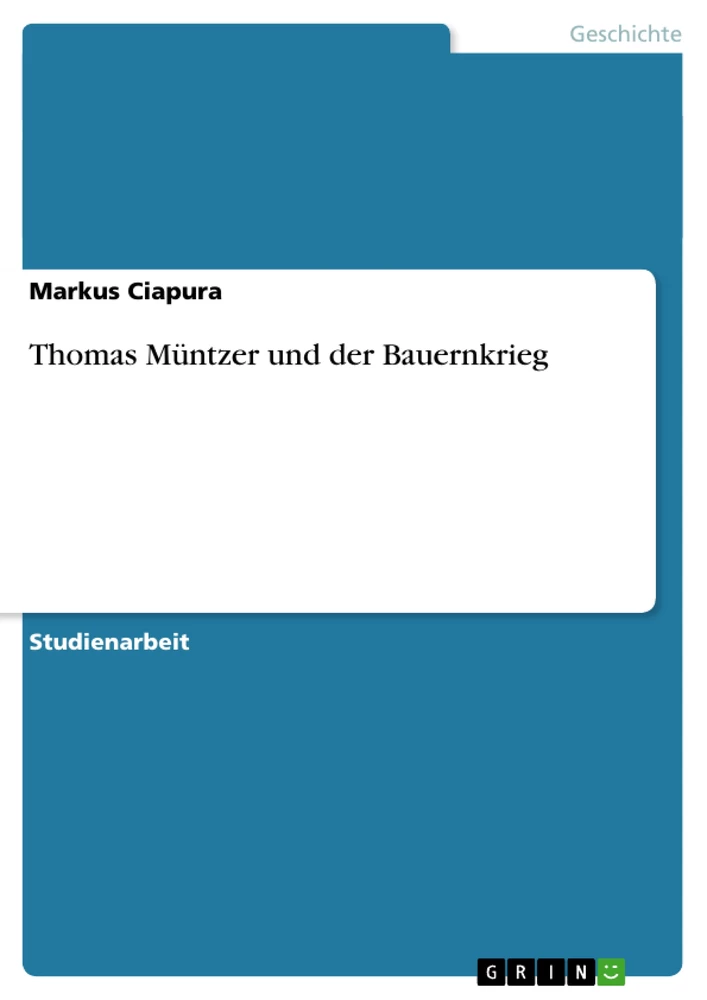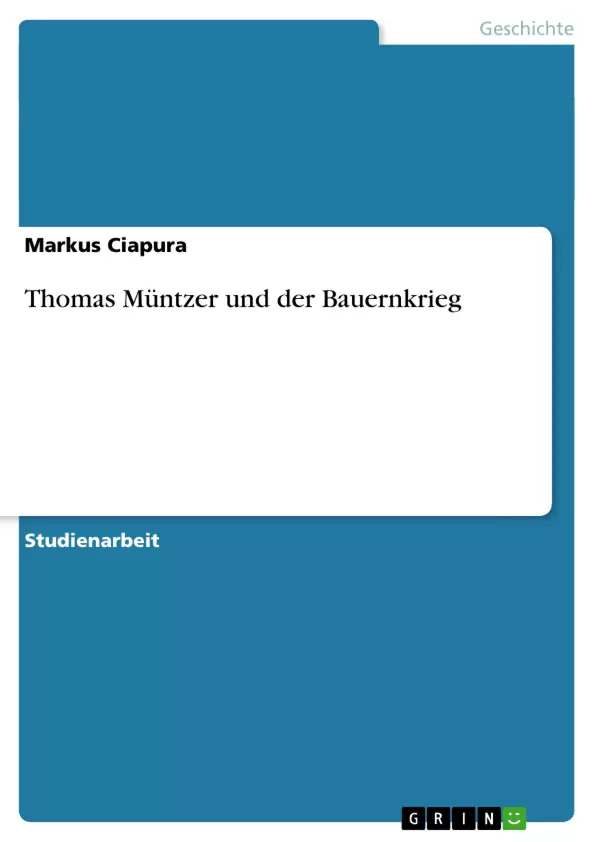Als 1525 der Aufstand der Bauern in Thüringen seinen Verlauf nahm, stellte Thomas Müntzer eine der wichtigsten Personen in diesen Vorkommnissen dar. Einerseits wirkte er schon vor dem Bauernkrieg als Reformator, andererseits entwickelte er sich zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar zu dem wichtigsten Führer der Aufstandsbewegung in Thüringen. Er wirkte also sowohl religiös, als auch politisch und bildet somit ein Bindeglied zwischen den religiösen Umwälzungen und den politischen und sozialen Unruhen, die sich im Bauernkrieg entluden.
Es stellt sich nun die Frage, wie Müntzer, der Reformator, später in die Position kam, zusammen mit den Bauern für deren Sache zu kämpfen. Folgte seine Führungsposition auf Seiten der Bauern zwingend aus seiner theologischen Überzeugung und war er zudem ein Vordenker des Sozialismus oder waren es die Umstände, die ihn eine Allianz mit den Bauern eingehen ließen? Betrachtet man die Literatur zu Müntzer und zum Bauernkrieg, so lassen sich beide Deutungen finden. Die marxistische Forschung geht von ersterem aus. Liest man westliche Veröffentlichungen, so findet man vorwiegend Darstellungen, die jener der marxistisch geprägten Forschungsmeinung widersprechen. Müntzer war von der marxistischen Forschung zu einem Vordenker der eigenen Sache stilisiert worden. Mit dem Zusammenbruch der sozialistisch regierten Länder, verschwindet dann auch die vehemente Darstellung Müntzers als politischem Visionär.
Diese Arbeit soll sich vor allem mit der Frage nach einer der aktuellen Forschung gerecht werdenden Deutung von Müntzers Person und seinem Wirken beschäftigen. Dazu wird es nötig sein, sich auch mit der marxistischen Müntzerforschung auseinanderzusetzen, da sie etwa die Hälfte der zu findenden Forschungsliteratur ausmacht, die Grundzüge der müntzerschen Theologie darzustellen und sie in Verhältnis zu den Vorkommnissen vor und während des Bauernkrieges zu setzen.
Im folgenden wird kurz die Entstehung und der Inhalt der marxistischen Müntzerforschung und anschließend in Grundzügen Müntzers Auffassung vom rechten Glauben dargestellt. Da es sich jedoch nicht um eine theologische Hausarbeit handelt, soll Müntzers Theologie nur insofern behandelt werden, als sie für die historische Bewertung Müntzers und seines Handelns wichtig ist. Weiterhin wird auf das sogenannte „Prager Manifest“, Müntzers Wirken in Allstedt und Mühlhausen und die Ereignisgeschichte während des Bauernkrieges eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Müntzer und die „frühbürgerliche Revolution“
Müntzers Theologie
Das Prager Manifest
Der Bund der Auserwählten und die Fürstenpredigt
Müntzer in Mühlhausen
Situation und Einflussnahme Müntzers
Die weitere Entwicklung
Zusammenfassung
Bibliographie
Bildnachweis
Einleitung
Als 1525 der Aufstand der Bauern in Thüringen seinen Verlauf nahm, stellte Thomas Müntzer eine der wichtigsten Personen in diesen Vorkommnissen dar. Einerseits wirkte er schon vor dem Bauernkrieg als Reformator, andererseits entwickelte er sich zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar zu dem wichtigsten Führer der Aufstandsbewegung in Thüringen. Er wirkte also sowohl religiös, als auch politisch und bildet somit ein Bindeglied zwischen den religiösen Umwälzungen und den politischen und sozialen Unruhen, die sich im Bauernkrieg entluden.
Es stellt sich nun die Frage, wie Müntzer, der Reformator, später in die Position kam, zusammen mit den Bauern für deren Sache zu kämpfen. Folgte seine Führungsposition auf Seiten der Bauern zwingend aus seiner theologischen Überzeugung und war er zudem ein Vordenker des Sozialismus oder waren es die Umstände, die ihn eine Allianz mit den Bauern eingehen ließen? Betrachtet man die Literatur zu Müntzer und zum Bauernkrieg, so lassen sich beide Deutungen finden. Die marxistische Forschung, die bis zum Zusammenbruch des Ostblocks in den Ländern östlich des Eisernen Vorhanges betrieben wurde, geht von ersterem aus. Liest man westliche Veröffentlichungen, so findet man vorwiegend Darstellungen, die jener der marxistisch geprägten Forschungsmeinung widersprechen. Müntzer war von der marxistischen Forschung zu einem Vordenker der eigenen Sache stilisiert worden, um dem Sozialismus in Deutschland eine lange Tradition zu verschaffen. Mit dem Zusammenbruch der sozialistisch regierten Länder, verschwindet dann auch die vehemente Darstellung Müntzers als politischem Visionär.
Diese Arbeit soll sich vor allem mit der Frage nach einer der aktuellen Forschung gerecht werdenden Deutung von Müntzers Person und seinem Wirken beschäftigen. Dazu wird es nötig sein, sich auch mit der marxistischen Müntzerforschung auseinanderzusetzen, da sie etwa die Hälfte der zu findenden Forschungsliteratur ausmacht, die Grundzüge der müntzerschen Theologie darzustellen und sie in Verhältnis zu den Vorkommnissen vor und während des Bauernkrieges zu setzen.
Im folgenden wird kurz die Entstehung und der Inhalt der marxistischen Müntzerforschung und anschließend in Grundzügen Müntzers Auffassung vom rechten Glauben dargestellt. Da es sich jedoch nicht um eine theologische Hausarbeit handelt, soll Müntzers Theologie nur insofern behandelt werden, als sie für die historische Bewertung Müntzers und seines Handelns wichtig ist. Weiterhin wird auf das sogenannte „Prager Manifest“, Müntzers Wirken in Allstedt und Mühlhausen und die Ereignisgeschichte während des Bauernkrieges eingegangen werden.
Müntzer und die „frühbürgerliche Revolution“
Beschäftigt man sich mit Thomas Müntzer, so begegnet man häufig der These, er sei ein Anführer einer „frühbürgerlichen Revolution“ gewesen. Diese These wird vor allem von Autoren und Forschern der ehemaligen UdSSR und der DDR vertreten. Als Grundlage für diese Behauptung beziehen sich diese auf Friedrich Engels, der in „Der deutsche Bauernkrieg“1 darstellte, dass sich unter dem Einfluss der Reformation neu entstandene Klassen in der Bevölkerung sammelten und in Gestalt „theologischer Ketzereien“2 ihre, nach Engels, „sehr positiven materiellen Klasseninteressen“3 als religöse Streitigkeiten austrugen. Dies sei eben nur unter dem Deckmantel des Streites um theologische Fragen möglich gewesen. Den Beginn der „frübürgerlichen Revolution“ setzt Engels auf das Jahr 14764 und sieht ihn als erste Revolution in einem Zyklus von Revolutionen an, die am Ende zu einer Abschaffung des Kapitalismus führen werde. Denn „seit ihm [Müntzer] finden wir sie [kommunistische Anklänge] in jeder großen Volkserschütterung wieder, bis sie allmählich mit der modernen proletarischen Bewegung zusammenfließen.“5
Engels begriff die Vorkommnisse während des Bauernkrieges als einen Aufstand der untersten, ausgebeuteten Klassen, zu deren geistigem Repräsentanten Müntzer aus Überzeugung wurde.6 Dadurch verwischte er den Unterschied zwischen der theologischen Auseinandersetzung auf der einen und der sozialen auf der anderen Seite, die beide zur gleichen Zeit stattfanden und ohne Zweifel auch in einem einzigen gewaltvollen Konflikt eskalierten, dessen soziale und religiöse Grundlagen jedoch getrennt voneinander betrachtet werden müssen.7 Wie später noch gezeigt werden wird, ging es Müntzer primär keineswegs darum, die Ziele der Bauern durchzusetzen. Vielmehr war sein Anliegen die Durchsetzung seiner theologischen Ziele, zu deren Verwirklichung er sich Unterstützung suchen musste. Diese fand er zwar letztlich bei den Bauern, jedoch hätte er sie ebenso von den herrschenden Fürsten gerne angenommen.
Für Engels jedoch handelte es sich beim Bauernkrieg um die erste Revolution der Bourgeoisie an deren Spitze Müntzer stand. Er ist der „plebejische Revolutionär“8, dessen Anschauung teilweise sogar „an Atheismus anstreift“9. Müntzer predigte nach Engels seine Lehren „meist versteckt unter denselben christlichen Redeweisen, unter denen sich die neuere Philosophie eine Zeitlang verstecken musste. [...] Wie Müntzers Religionsphilosophie an den Atheismus, so streifte sein politisches Programm an den Kommunismus.“10 Für Engels war Müntzer also in erster Linie kein Theologe, sondern politischer Revolutionär.
Engels Grundauffassung von Müntzer als Anführer einer nun sogenannten „frühbürgerlichen Revolution“ wurde dann von der marxistischen Geschichtswissenschaft in den kommunistischen Ländern wieder aufgenommen und wissenschaftlich zu belegen versucht. Wichtige Vertreter dieses Ansatzes sind neben Moisej M. Smirin, der als erster auf die Darstellung Engels zurückgriff und damit die marxistische Müntzerforschung begründete, Alfred Meusel, Leo Stern, Heinz Kamnitzer, Karl Kleinschmidt11 und Max Steinmetz, auf deren Werke hier jedoch nicht im Einzelnen eingegangen werden kann.
Wichtig in der marxistischen Müntzerforschung ist, dass die Vereinnahmung Müntzers als Vorkämpfer einer ersten proletarischen Revolution, seine eigentlichen theologischen Ziele weiterhin wie bei Engels überdeckt. Dies wird besonders deutlich, wenn wir lesen:
„Seine Ideologie – und das ist das Ausschlaggebende – [...] erweist sich als Vorform der proletarischen Klassenideologie. Müntzer überspringt gleichsam seine Zeit und weist den Weg zu einer damals undurchführbaren, aber in der Zukunft allein richtigen Lösung. [...] Müntzer [war] als Repräsentant der ersten Proletarischen Elemente in der zerfallenden Feudalordnung gleichzeitig derjenige, der auch das entscheidenste und weitgehendste Programm der nationalen Entwicklung Deutschlands (als demokratische Republik) vertrat. Bei diesem Programm aber handelt es sich zweifellos um eine keimhaft-unreife, für ihre Zeit letztlich utopische, im ganzen aber doch geniale Antizipation der wahrhaft nationalen Politik der deutschen Arbeiterklasse.“12
Die Darstellung Müntzers und des Bauernkrieges unter der Prämisse der Theorie der „frühbürgerlichen Revolution“ ist wie man sieht durchdrungen von der Absicht, Müntzer als einen der Vordenker des Sozialismus und des Kommunismus darzustellen, was den tatsächlichen Bedingungen, wie zu zeigen sein wird, nicht entsprechen kann.
Müntzers Theologie
Thomas Müntzer wurde 1489 oder 1490 in Stolberg am Harz als Sohn eines angesehenen Bürgers geboren. Er studierte Theologie, führte ein unstetes Leben und musste sich als Weltgeistlicher um sein Auskommen sorgen. Wie Franz schreibt, nutzte er seine Ersparnisse vor allem, um sich mit Büchern zu versorgen.13 Hierbei handelte es sich um die Schriften Luthers und seiner Anhänger und Gegner, um die der Kirchenväter, Akten der Reformkonzilien, um antike Klassiker und natürlich die Bibel, die er später zum Teil auswendig konnte. Er betrieb außerdem Studien des Hebräischen und des Griechischen. Franz nennt ihn einen der „gelehrtesten, fleißigsten und geistig regsamsten Geistlichen Norddeut schlands.“14 Luther empfahl ihn als Prediger nach Zwickau, wo er dem Einfluss des taboritischen Schwärmers Nikolaus Storch erlag. Von ihm erwarb er die Überzeugung, dass Gott sich den Menschen immer noch in Gesichten und Träumen offenbare, dass bald das tausendjährige Reich anbreche, der Antichrist erscheine und dass alle Gottlosen von den Auserwählten erschlagen würden. Müntzer sah sich nun als einen dieser Auserwählten und verstand sich als Gesandter Gottes. Nach Storch und dann auch Müntzer eröffne sich dem Menschen durch das Kreuz, nicht wie bei Luther durch den Glauben, ein neuer Heilsweg. Der Mensch habe das Kreuz zu tragen um dadurch reif zu werden, den heiligen Geist zu empfangen. Diejenigen, die so den heiligen Geist empfangen hätten, seien die Auserwählten, mit denen zusammen Müntzer seine Gemeinde bilden wollte. Müntzers Überzeugung unterscheidet sich von Luthers Prinzip der Schriftdeutung in diesem Geistglauben.15 Da sich nun aber nach Müntzers Überzeugung der Geist in alle Menschen ergießen konnte, konnten auch Laien und nicht nur Gelehrte ihn empfangen, was sie in die Lage versetzte, ebenso zu predigen.
Um die Reformation machte sich Müntzer verdient, indem er 1523 in Allstedt die lateinische Messe für den Gemeindegebrauch verdeutschte, die nicht mit der evangelischen Lehre zu vereinbarenden Teile abschaffte und eine neue Gottesdienstordnung in Druck gab. Zudem erstellte er Formulare für die täglichen Wochengottesdienste aus den Stundengebeten der Kleriker zusammen und ließ sie drucken. Weiterhin übersetzte er bekannte lateinische Hymnen und machte den Gemeindegesang noch vor Luther zum Bestandteil des Gottesdienstes.
Das Prager Manifest
Das sogenannte Prager Manifest Müntzers von 1521 ist in vier verschiedenen Fassungen überliefert, zwei deutschen (einer längeren und einer kürzeren), einer lateinischen und einer unvollständigen tschechischen. Im Prager Manifest fasst Müntzer seine theologischen Überzeugungen zusammen. Er kritisiert die Geistlichkeit, legt seine Sichtweise des unmittelbaren Geistempfangs dar und spricht über das seiner Überzeugung nach kurz bevorstehende Ende der Zeit.
Zu Anfang des Prager Manifests gibt Müntzer an, „das ich meinen merklichsten und allerhochsten Fleiß furgewant habe, das ich muchte vor andern Menschen hochlicher erkennen, wie der heilige, unuberwintliche Christenglaube gegrundet weher.“16 Es folgt eine harsche Kritik am Klerus, der seiner Meinung nach Gott niemals selbst erfahren habe und die Menschen daran hindere, eben dies zu tun. Müntzer verwendet das Bild, die kirchlichen Autoritäten hätten versagt. Sie wüssten nichts vom Willen Gottes und könnten dem Menschen nicht sagen, wie dieser Wille lebendig erfahren werden könne.
Er erklärt, dass Gott seine Schrift nicht mit Tinte auf Papier geschrieben habe, sondern sie mit dem Finger in die Herzen der Menschen schreibe. „Disse Schrift künnen alle auserwelten Menschen lesen [...].“17, schreibt er und unterscheidet somit zwischen Auserwählten und Gottlosen.
In der marxistischen Müntzerforschung wird das Prager Manifest angeführt um Müntzer als frühen sozialistisch-kommunistisch eingestellten Vorkämpfer darzustellen, denn nach seiner Kritik am Klerus und der Darstellung seiner Überzeugung der Geisteserfahrung schreibt er: „Aber am Volk zweifel ich nicht.“18 Allerdings ist die Gegenüberstellung Volk/Klerus nicht, wie es dort getan wird, als soziale Unterscheidung zu verstehen. Schon gar nicht darf sie zu einer Unterscheidung Volk/Herrscher verkehrt werden, denn von den weltlichen Fürsten spricht Müntzer nur am Rande. Es handelt sich vielmehr um eine religiöstheologische Unterscheidung. Das Volk sind diejenigen, die nicht dem Klerus angehören. Das Brot, das dem Volk, wie Müntzer weiter schreibt, vorenthalten werde ist das Brot des rechten Glaubens. Dabei beziehen sich seine Äußerungen nicht auf soziale Ungerechtigkeiten, sondern darauf, dass der Klerus seiner Aufgabe den Menschen den Glauben nahezubringen nicht nachgekommen sei.
Es seint der geltdorstigen Buben vil do gewest, die dem armen, armen, armen Volklein, die dem patischen, unerfarnen Texte der Biblien vorgeworfen haben, wie man den Hunden das Brot pfleget vorzuwerfen. Sie habens ihn aber durch die Kunst des Heiligen Geistes nicht gebrochen, das ist, sie haben ihre Vornunft nicht eroffnet, das sie den heiligen Geist in ihn mochten erkennen.19
[...]
1 Engels, Friedrich: „Der deutsche Bauernkrieg“, zuerst in: Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue, Heft 5/6, 1850.
2 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke. Bd. 7, Berlin 1960, S. 342.
3 ebda., S. 344/345.
4 vgl. ebda., S. 359. Engels bezieht sich auf Vorkommnisse im Bistum Würzburg in deren Mittelpunkt Hans Böheim von Nikolashausen stand.
5 ebda, S. 347.
6 Buszello, Horst: „Deutungsmuster des Bauernkriegs in historischer Perspektive:“ in: Buszello, Horst/Blickle, Peter/Endres, Rudolf (Hrsg.): Der deutsche Bauernkrieg, Paderborn 1991, S. 18/19.
7 siehe hierzu Abschnitt Müntzers Theologie
8 Marx/Engels, S. 351.
9 ebda., S. 353.
10 ebda.
11 vgl. Steinmetz, Max: „Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland 1476 bis 1535“, in: Bartel, Horst/Heitzner, Heinz/Kossok, Manfred/Küttler, Wolfgang/Laschitza, Annelies/Schmidt, Walter/Seeber, Gustav: Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland, Berlin 1985, S. 38.
12 Steinmetz, S. 48.
13 Franz, Günther: Der deutsche Bauernkrieg7 Darmstadt 1965, S. 252.
14 ebda.
15 vgl. Franz 1965, S. 253.
16 Franz, Günther (Hrg.): Thomas Müntzer. Die Fürstenpredigt. Theologisch-politische Schriften. Stuttgart 1967, S. 3.
17 Franz 1967, S. 7.
18 ebda., S. 9.
19 ebda.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Thomas Müntzer im Bauernkrieg von 1525?
Müntzer war einer der wichtigsten Führer der Aufstandsbewegung in Thüringen und fungierte als Bindeglied zwischen religiöser Reformation und sozialpolitischen Unruhen.
Was besagt die marxistische These der "frühbürgerlichen Revolution"?
Diese Forschung sieht Müntzer primär als politischen Revolutionär und Vordenker des Sozialismus, der religiöse Themen nur als "Deckmantel" für materielle Klasseninteressen nutzte.
Wie unterschied sich Müntzers Theologie von der Martin Luthers?
Während Luther das Schriftprinzip betonte, glaubte Müntzer an eine fortlaufende Offenbarung durch den Heiligen Geist in Träumen und Visionen sowie an einen Heilsweg durch das Leiden (Kreuz).
Was war das "Prager Manifest"?
Im Prager Manifest legte Müntzer seine radikale Theologie dar, forderte eine Erneuerung der Kirche durch den "lebendigen Geist" und drohte den "Gottlosen" mit dem Strafgericht.
Warum suchte Müntzer das Bündnis mit den Bauern?
Müntzer brauchte eine weltliche Machtbasis zur Durchsetzung seiner theologischen Ziele. Nachdem die Fürsten seine Forderungen ablehnten, sah er in den Bauern die "Auserwählten" für den Umsturz.
Was geschah in Mühlhausen unter Müntzers Einfluss?
Mühlhausen wurde zu einem Zentrum des radikalen Aufstands, in dem Müntzer versuchte, eine Gesellschaft nach seinen religiösen Vorstellungen zu etablieren, bevor die Bewegung militärisch niedergeschlagen wurde.
- Citar trabajo
- Markus Ciapura (Autor), 2005, Thomas Müntzer und der Bauernkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53442