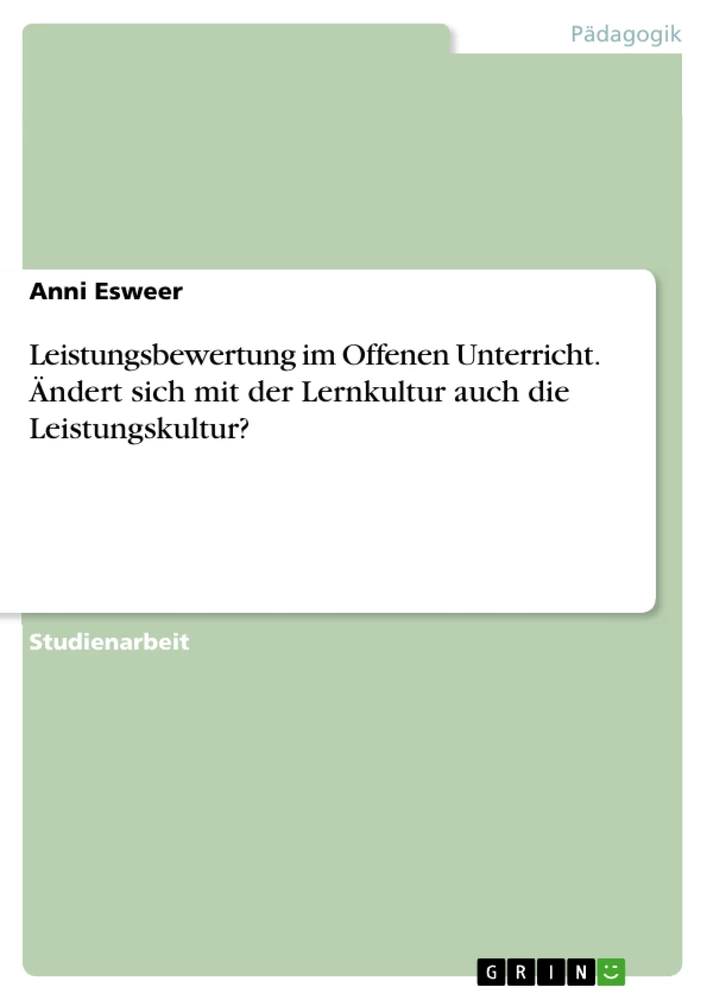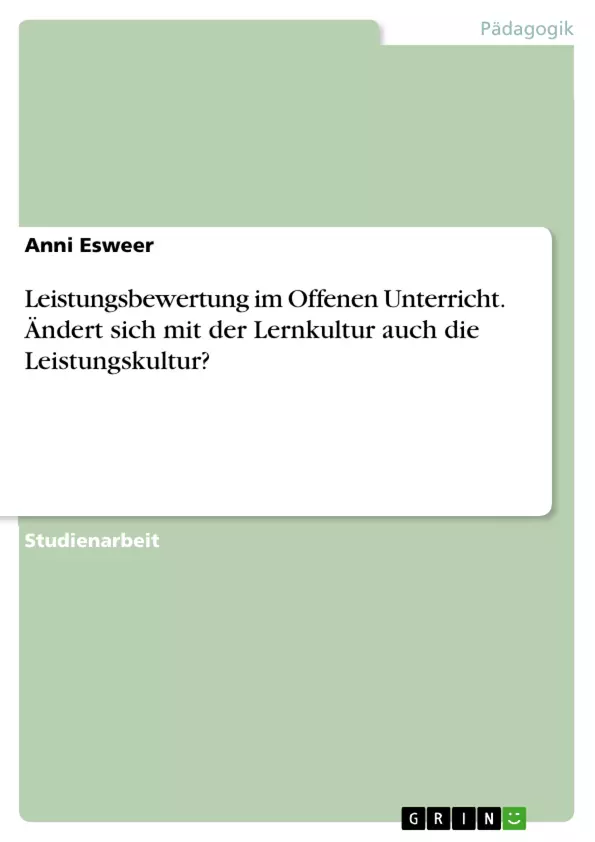Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer Abwendung vom klassischen Unterrichtsmodell, hin zum so genannten "Offenen Unterricht". Zunächst wird die Begrifflichkeit durch das Aufzeigen von Abgrenzungen inhaltlich präzisiert und eingerahmt. Auch die auffallende Nähe zu Merkmalen des schülerzentrierten Unterrichts wird dabei aufgezeigt. Anschließend wird Offener Unterricht auf seine motivational fördernden Aspekte hin dargestellt, welche als bedeutsam für den Schulalltag gesehen werden. Daran schließt sich das theoretische Themenfeld der Leistungsbewertung in der Schule an, bei welchem ebenfalls im Rahmen des Leistungsbegriffs aus pädagogischer Sicht die gegenwärtigen Veränderungen aufgezeigt werden. Mögliche Formen der Leistungsbewertung werden aufgezeigt, um die Frage beantworten zu können, ob Offener Unterricht Anspruch auf andere Bewertung stellt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden abschließend in einem Fazit dargestellt.
Wenn von Offenem Unterricht die Rede ist, ist schnell festzustellen, dass eine universelle Definition in der Literatur nicht zu finden ist. Dies ist nicht verwunderlich, da es auch den einen Offenen Unterricht nicht gibt. Stattdessen kann Offener Unterricht auf viele unterschiedliche Arten durchgeführt werden und unterschiedliche Interaktions- und auch Handlungsformen zulassen. In Offenen Unterrichtsformen ist das Schülerverhalten von Eigenständigkeit geprägt. Ebenso ist eine Orientierung hin zum Lernprozess mit seinen Erfahrungswerten und aktivem Handeln erkennbar. Hier ist ein erweiterter prozessori-entierter Lernbegriff anzunehmen, der neben dem inhaltlichen auf soziales und strategisches Lernen abzielt, bei dem vielfältige Methoden genutzt werden. Letztlich sind auch eine beson-dere Stellung der Lernorganisation und Raumnutzung zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Offener Unterricht
- Definitions- und Abgrenzungsversuch.....
- Nähe zum schülerzentrierten Unterricht.
- Offener Unterricht aus Sicht der Motivationsforschung.....
- Leistungsbewertung in der Schule ...........\n
- Der erweiterte Leistungsbegriff aus pädagogischer Sicht.…………………..\n
- Gütekriterien......
- Formen der Leistungsbewertung in der Schule..\n
- Leistungsbewertung im Offenen Unterricht\n
- Fazit...........
- Literaturverzeichnis...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Offenen Unterricht und dessen Leistungsbewertung im Kontext einer neuen Schulkultur. Ziel ist es, das Konzept des Offenen Unterrichts zu beleuchten, seine Abgrenzung zu anderen Unterrichtsformen zu verdeutlichen und seine motivationalen Aspekte herauszustellen. Darüber hinaus wird die aktuelle Entwicklung des Leistungsbegriffs in der Pädagogik und die verschiedenen Formen der Leistungsbewertung in der Schule betrachtet, um die Frage zu klären, ob der Offene Unterricht spezifische Bewertungsansätze erfordert.
- Definition und Abgrenzung des Offenen Unterrichts
- Nähe des Offenen Unterrichts zum schülerzentrierten Unterricht
- Motivationale Aspekte des Offenen Unterrichts
- Der erweiterte Leistungsbegriff in der Pädagogik
- Leistungsbewertung im Offenen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Offenen Unterrichts ein und unterstreicht die Bedeutung von Handlungsbezug und Könnerschaft in der heutigen Bildung. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition und Abgrenzung des Offenen Unterrichts. Es werden verschiedene Definitionsansätze dargestellt und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum schülerzentrierten Unterricht herausgearbeitet. Der Fokus liegt dabei auf den Merkmalen von Schüler- und Lehrerverhalten, den methodischen Grundprinzipien sowie den Lern- und Unterrichtsformen im Offenen Unterricht.
Kapitel drei untersucht die motivationalen Aspekte des Offenen Unterrichts. Es wird dargelegt, inwiefern die Eigenständigkeit und Selbststeuerung der Schüler im Offenen Unterricht die Motivation und das Engagement der Lernenden fördern kann. Das vierte Kapitel beleuchtet die Thematik der Leistungsbewertung in der Schule. Hier wird der erweiterte Leistungsbegriff aus pädagogischer Sicht betrachtet, der über die reine Wissensreproduktion hinausgeht und den Lernprozess in seiner Gesamtheit berücksichtigt. Zudem werden die verschiedenen Formen der Leistungsbewertung in der Schule aufgezeigt.
Im fünften Kapitel wird die Frage thematisiert, ob der Offene Unterricht spezifische Bewertungsansätze erfordert. Es werden die Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Offenen Unterricht diskutiert, wobei die Eigenständigkeit und Selbststeuerung der Schüler eine zentrale Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, schülerzentrierter Unterricht, Leistungsbewertung, Lernmotivation, Selbststeuerung, Eigenständigkeit, Handlungsorientierung, erweiterter Leistungsbegriff, formative Diagnostik, pädagogische Perspektiven, Lernkultur, Schüler-Lehrer-Beziehung, Lernorganisation, Raumnutzung.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet „Offenen Unterricht“ aus?
Offener Unterricht ist durch Eigenständigkeit der Schüler, Prozessorientierung, aktive Handlungsformen und eine flexible Lernorganisation geprägt.
Wie ändert sich die Leistungsbewertung im Offenen Unterricht?
Anstatt nur das Endergebnis zu prüfen, rückt der Lernprozess (formative Diagnostik) und der erweiterte Leistungsbegriff (soziale und strategische Kompetenzen) in den Fokus.
Welche motivationalen Vorteile bietet Offener Unterricht?
Die Selbststeuerung und Mitbestimmung fördern das Interesse und die intrinsische Motivation der Schüler.
Gibt es eine einheitliche Definition für Offenen Unterricht?
Nein, in der Literatur gibt es keine universelle Definition, da Offener Unterricht viele verschiedene Interaktions- und Handlungsformen zulässt.
Was versteht man unter dem pädagogischen Leistungsbegriff?
Er geht über reine Wissensreproduktion hinaus und berücksichtigt individuelle Lernfortschritte sowie methodische und soziale Fähigkeiten.
- Quote paper
- Anni Esweer (Author), 2019, Leistungsbewertung im Offenen Unterricht. Ändert sich mit der Lernkultur auch die Leistungskultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/534868