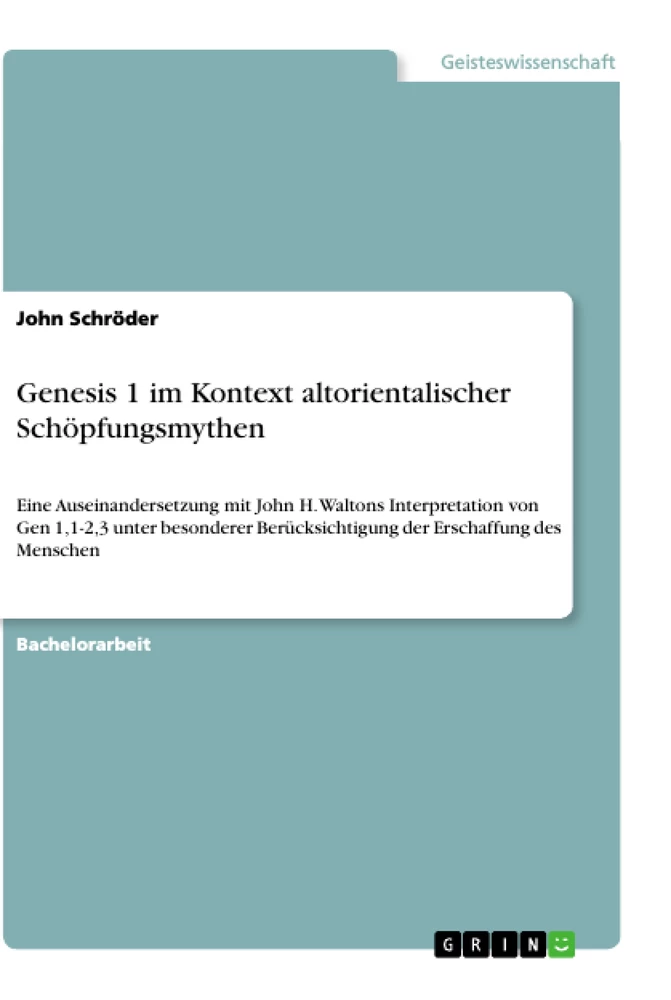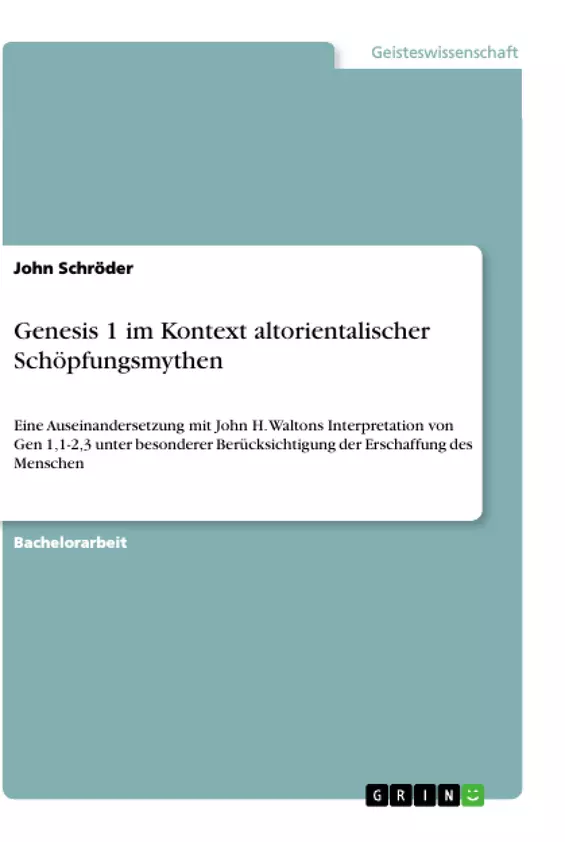Diese Arbeit setzt sich mit dem hermeneutisch-exegetischen Ansatz von John H. Walton zu Gen 1,1-2,3 auseinander. In einem ersten Schritt wird Waltons Ansatz dargestellt. Hier wird auf seine grundsätzliche Methode eingegangen, auf seine Analyse altorientalischer Literatur und auf seine Exegese des alttestamentlichen Schöpfungstextes. Ein Schwerpunkt wird auf Waltons Sichtweise der Erschaffung des Menschen gelegt, um seine Hermeneutik und Auslegung von Gen 1 an einem repräsentativen Textabschnitt tiefer zu beleuchten. Neben Gen 1,26-28 wird daher auch Gen 2,4-24 wichtig.
In einem zweiten Schritt wird Waltons Ansatz kritisch reflektiert. Dabei wird auf den im ersten Schritt dargestellten Argumentationsstrang Bezug genommen (grundsätzliche Methode, altorientalische Literatur, Gen 1,1-2,3, Menschenbild), die einzelnen Argumente von Walton werden untersucht und mit anderen Interpretationen ins Gespräch gebracht.
Mit dem Aufkommen der Altorientalistik in den letzten Jahrhunderten stellte sich vermehrt die Frage, in welchem Verhältnis das Alte Testament und der restliche Alte Vordere Orient zueinander stehen. Friedrich Delitzsch stellte im Zuge des sogenannten „Bibel-Babel-Streites“ die These auf, dass sich das Alte Testament ausschließlich mesopotamischer Literatur und Kultur bedient hätte. Auf der anderen Seite begegnet man häufig auch einer konfessionellen Altorientalistik, die das Alte Testament vom altorientalischen Hintergrund völlig lösen möchte oder sich zumindest nur auf die Unterschiede fixiert. Insbesondere bei der Urgeschichte in Gen 1-11 muss man nach dem Einfluss altorientalischer Kultur fragen und damit auch nach einer angemessenen Exegese, die diese Einflüsse berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Waltons Interpretation von Gen 1,1-2,3
- Der hermeneutische Rahmen
- Grundsätzliche Methodologie
- Materielle Ontologie vs. Funktionelle Ontologie
- Altorientalische Schöpfungsmythen haben eine funktionale Ontologie
- Die funktionale Gestalt des Kosmos
- Die Rolle der Götter im Kosmos
- Funktionen und Funktionsträger
- „Control attributes“ und „destinies“
- Tempel und Kosmos
- Gen 1,1-2,3 hat eine funktionale Ontologie
- Gen 1,1 als einleitende Überschrift
- bezieht sich auf Funktionen
- Gen 1,2: Der Urzustand ist funktionsuntüchtig
- Gen 1,3-13: Die Tage 1-3 etablieren Funktionen
- Gen 1,14-25: Die Tage 4-6 etablieren Funktionsträger
- Ruhe, Tempel und Tempeleinweihung in Gen 1,1-2,3
- Zusammenfassung
- Gen 1,26-31 und Gen 2,4-25: Ein funktionsorientiertes Menschenbild
- Die Erschaffung des Menschen in altorientalischer Literatur ist funktional
- Die Erschaffung des Menschen in Gen 1,26-28 ist funktional
- Der Mensch als Mann und Frau
- Die Erschaffung des Menschen in Gen 2,4-24 ist archetypisch
- Gen 2,4ff. ist eine Fortsetzung von Gen 1,1ff.
- Die Erschaffung Adams
- Die Erschaffung Evas
- Zusammenfassung der Erschaffung des Menschen bei Walton
- Kritische Reflexion von Waltons Ansatz
- Gen 1 als altorientalisches Dokument
- Der Einfluss altorientalischer Kultur
- Funktionale oder materielle Ontologie?
- Haben altorientalischen Schöpfungsmythen eine funktionale Ontologie?
- Gen 1,1-2,3: Geht es ausschließlich um Funktionen?
- Die literarische Funktion von Gen 1,1
- …ברא Das Verb
- Die literarische Struktur von Gen 1,1-2,3
- Gen 1,3-13: Die Tage 1-3
- Gen 1,14-25: Die Tage 4-6
- Ist Genesis 1,1-2,3 ein Tempeltext?
- Zusammenfassung zu Gen 1,1-2,3
- Die Erschaffung des Menschen
- Die Erschaffung des Menschen in altorientalischer Literatur
- Die Erschaffung des Menschen in Gen 1,26-28
- Die Erschaffung des Menschen in Gen 2,4-24
- Fazit und Ausblick
- Waltons hermeneutischer Rahmen und seine grundsätzliche Methodologie
- Die Rolle altorientalischer Schöpfungsmythen in Waltons Interpretation
- Waltons Auslegung von Gen 1,1-2,3 und die funktionale Ontologie
- Die Erschaffung des Menschen in Gen 1,26-31 und Gen 2,4-24 aus Waltons Perspektive
- Kritische Reflexion von Waltons Ansatz und seine Relevanz für die Bibelinterpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Arbeit analysiert die hermeneutisch-exegetische Interpretation von John H. Walton zu Gen 1,1-2,3, mit besonderem Fokus auf die Erschaffung des Menschen. Die Arbeit beleuchtet Waltons Ansatz, indem sie seine Methode, seine Analyse altorientalischer Literatur und seine exegetische Herangehensweise an den alttestamentlichen Schöpfungstext darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und erläutert die Bedeutung des altorientalischen Kontexts für die Interpretation des Alten Testaments. Sie führt dann John H. Waltons hermeneutischen Ansatz zur Gen 1,1-2,3 ein, einschließlich seiner Methodik und seiner Analyse altorientalischer Literatur.
Anschließend beleuchtet die Arbeit Waltons Interpretation des Schöpfungsberichts, wobei sie sich auf die funktionale Ontologie, die Rolle der Götter und die Funktionsbereiche in der Schöpfung konzentriert. Sie beleuchtet auch Waltons spezifische Sichtweise auf die Erschaffung des Menschen in Gen 1,26-31 und Gen 2,4-24, wobei sie seine Argumente in Bezug auf das altorientalische Menschenbild untersucht.
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Reflexion von Waltons Ansatz, wobei sie die Stärken und Schwächen seiner Interpretation diskutiert und seine Schlussfolgerungen mit anderen Interpretationen vergleicht.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Themen der biblischen Exegese, der altorientalischen Literatur, der Schöpfungsgeschichte, der Ontologie, der funktionellen Perspektive und der Erschaffung des Menschen. Sie beleuchtet insbesondere die hermeneutischen Ansätze von John H. Walton und untersucht deren Einfluss auf die Interpretation von Gen 1,1-2,3.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von John H. Waltons Ansatz zu Genesis 1?
Walton argumentiert, dass Genesis 1 nicht die materielle Entstehung der Welt beschreibt, sondern deren funktionale Ordnung (funktionale Ontologie) im altorientalischen Kontext.
Was bedeutet "funktionale Ontologie" im Gegensatz zur materiellen?
Funktionale Ontologie besagt, dass etwas existiert, wenn es eine Funktion in einem geordneten System hat, während materielle Ontologie auf die physische Erschaffung fokussiert.
Wie interpretiert Walton die Erschaffung des Menschen?
Der Mensch wird primär in seiner Funktion als Stellvertreter Gottes und Funktionsträger im Kosmos gesehen, wobei Adam und Eva als archetypische Figuren fungieren.
Welche Rolle spielt der Tempel in Waltons Exegese?
Walton sieht Genesis 1 als einen "Tempeltext", bei dem der Kosmos als Tempel Gottes verstanden wird, der nach sechs Tagen der Funktionszuweisung eingeweiht wird.
Was war der "Bibel-Babel-Streit"?
Ein wissenschaftlicher Konflikt um die These von Friedrich Delitzsch, dass das Alte Testament lediglich eine Kopie mesopotamischer Mythen und Kultur sei.
- Citation du texte
- John Schröder (Auteur), 2019, Genesis 1 im Kontext altorientalischer Schöpfungsmythen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535042