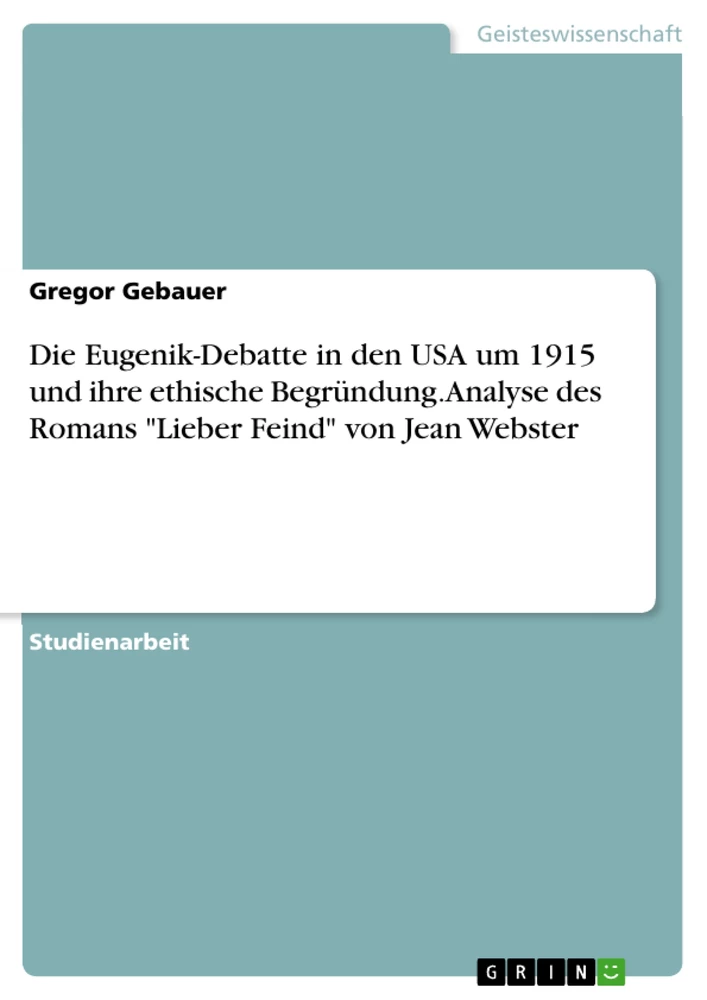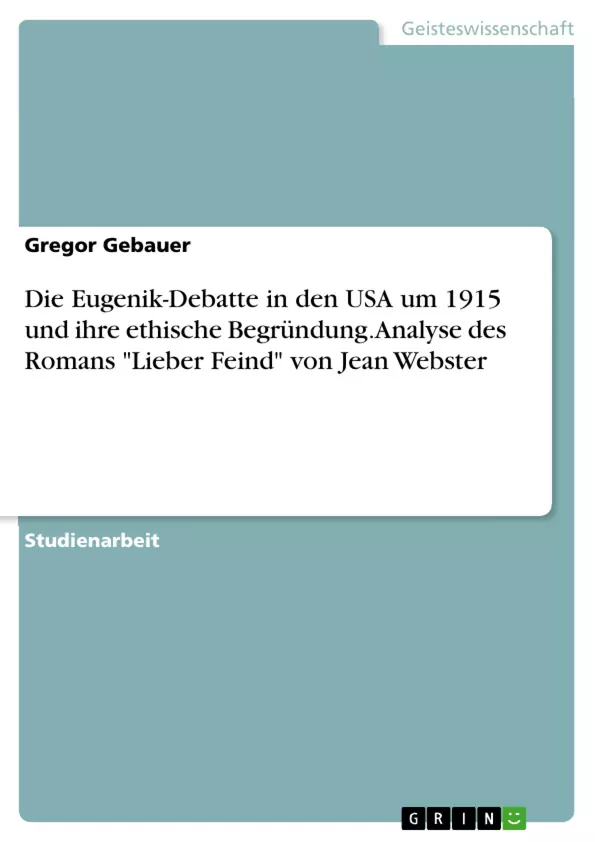Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, wie anhand des Romanes „Lieber Feind“ aus dem Zeitgeist Anfang des 20. Jahrhunderts heraus die Notwendigkeit eugenischer Maßnahmen begründet und ethisch untermauert wurde.
Der 2018 in einer Neuübersetzung wieder aufgelegte Briefroman „Lieber Feind“ von Jean Webster aus dem Jahre 1915 ist auf den ersten Blick ein sehr unterhaltsames und charmantes Buch. Die neu eingestellte Waisenhausleiterin Sallie McBride hat sich das Ziel gesetzt, ein Waisenhaus dieser Zeit mit jugendlichem Schwung zu reformieren. Der ungemein charmant/humorvolle Ton dieses Buches, das vor allem an junge Mädchen und Frauen adressiert ist, täuscht darüber hinweg, dass vor allem im Subtext des Romans „Lieber Feind“ ein intensiver, ernsthafter Diskurs über eugenische Fragestellungen und pädagogische Reformbestrebungen der Zeit um 1915 stattfindet.
Warum sollte man sich heute ernsthaft damit auseinandersetzen? Ein aktuell erhältlicher Roman, der eugenische Theorien unterhaltsam und vergnüglich in den jugendlichen Leser einfließen lässt, ist es allemal wert, sich damit zu beschäftigen. Dazu kommt, dass eugenische Fragestellungen in Zeiten der modernen Genetik, der Präimplantationsdiagnostik und der Debatte um die relativ neue Epigenetik aktueller denn je sind. Obwohl man lange glaubte, dass nach der radikalen Umsetzung eugenischer Überlegungen durch die Euthanasie der Nationalsozialisten die Menschheit gegen solche Lösungen immunisiert wurde.
Wir neigen heute dazu, historische Entwicklungen aus der Rückschau zu betrachten, mit all dem Wissen über die barbarische Zuspitzung und Radikalisierung während der Zeit des Nationalsozialismus. Wenn wir dann Begriffe wie Eugenik lesen, steht uns automatisch völlig klar vor Augen, was für eine unausweichliche Entwicklung diese damalige Forschungsrichtung nehmen musste. Für die damaligen Menschen war diese Logik so nicht zu erkennen, es bedurfte vieler Komponenten, um eine so einschneidende Entwicklung wie im Deutschland der Jahre 1933-45 zu ermöglichen. Auch erklärt diese Logik nicht, warum diese radikale Entwicklung in andren Ländern so eben nicht stattfand. Genau aus diesem Grund bietet sich als Grundlage einer solchen Untersuchung als frische, unverfälschte Stimme aus der Vergangenheit der Roman „Lieber Feind“ an. Er ermöglicht es uns, einen relativ authentischen Blick auf den Stand der Eugenik-Debatte des Jahres 1915 in den USA zu werfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über den Stand der eugenischen Debatte Anfang des 20. Jhdts.
- Wiederspiegelung der eugenischen Debatte im Roman „Lieber Feind“ von Jean Webster (USA 1915)
- Begründung des Nutzens von Eugenik und Exklusion im Roman
- Darstellung von Denk- und Wertevorstellungen der damaligen Zeit, die die eugenischen Argumente im Roman „Lieber Feind“ unterfüttern
- Der religiöse Faktor in der Eugenik
- Der,,Geist\" des Kapitalismus, Utilitarismus und Eugenik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Roman „Lieber Feind“ von Jean Webster aus dem Jahr 1915, um die eugenische Debatte der Zeit im Kontext des Romans zu analysieren. Sie analysiert, wie der Roman die eugenischen Ideen der damaligen Zeit widerspiegelt und wie diese Ideen im Roman begründet werden. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die zentralen Denk- und Wertvorstellungen, die die eugenischen Argumente im Roman unterfüttern.
- Eugenische Debatte im frühen 20. Jahrhundert
- Wiederspiegelung eugenischer Ideen in Literatur
- Begründung eugenischer Maßnahmen in „Lieber Feind“
- Einfluss von Religion, Kapitalismus und Utilitarismus auf eugenische Argumente
- Ethische Dimensionen eugenischer Ideen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den Roman „Lieber Feind“ als Ausgangspunkt der Untersuchung und stellt die Relevanz der eugenischen Debatte im Kontext des Romans heraus. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über den Stand der eugenischen Debatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es beleuchtet wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse wie die von Gregor Mendel und Charles Darwin, die zur Entwicklung der Eugenik beigetragen haben. Weiterhin wird auf die Rolle von Sir Francis Galton als Begründer der Eugenik und seine Konzepte von „gutem Erbe“ und negativer Eugenik eingegangen. Das Kapitel analysiert auch die sozioökonomischen und politischen Faktoren, die zur Verbreitung eugenischer Ideen im frühen 20. Jahrhundert beitrugen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Eugenik, „Lieber Feind“, Jean Webster, Vererbung, „gutes Erbe“, negative Eugenik, Darwinismus, Lamarckismus, Rassendegeneration, Kapitalismus, Utilitarismus, Religion.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Jean Websters Roman "Lieber Feind"?
Der Briefroman von 1915 handelt von der Reform eines Waisenhauses durch Sallie McBride und thematisiert dabei unterschwellig eugenische und pädagogische Debatten jener Zeit.
Welche Rolle spielt die Eugenik in diesem Roman?
Der Roman spiegelt den Zeitgeist wider, in dem die Verbesserung des "Erbgutes" und die Exklusion von als "minderwertig" angesehenen Menschen ethisch begründet wurden.
Wie wurde der Nutzen der Eugenik damals ethisch untermauert?
Oft durch eine Mischung aus religiösem Sendungsbewusstsein, utilitaristischem Denken (Wirtschaftlichkeit) und dem Glauben an den wissenschaftlichen Fortschritt durch Selektion.
Wer gilt als Begründer der Eugenik?
Sir Francis Galton prägte den Begriff und die Konzepte des "guten Erbes" Ende des 19. Jahrhunderts, basierend auf den Theorien von Darwin.
Warum ist die Auseinandersetzung mit historischer Eugenik heute noch relevant?
In Zeiten von Präimplantationsdiagnostik und moderner Genetik stellen sich ähnliche ethische Fragen nach der Bewertung von Leben erneut.
- Quote paper
- Gregor Gebauer (Author), 2019, Die Eugenik-Debatte in den USA um 1915 und ihre ethische Begründung. Analyse des Romans "Lieber Feind" von Jean Webster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535114