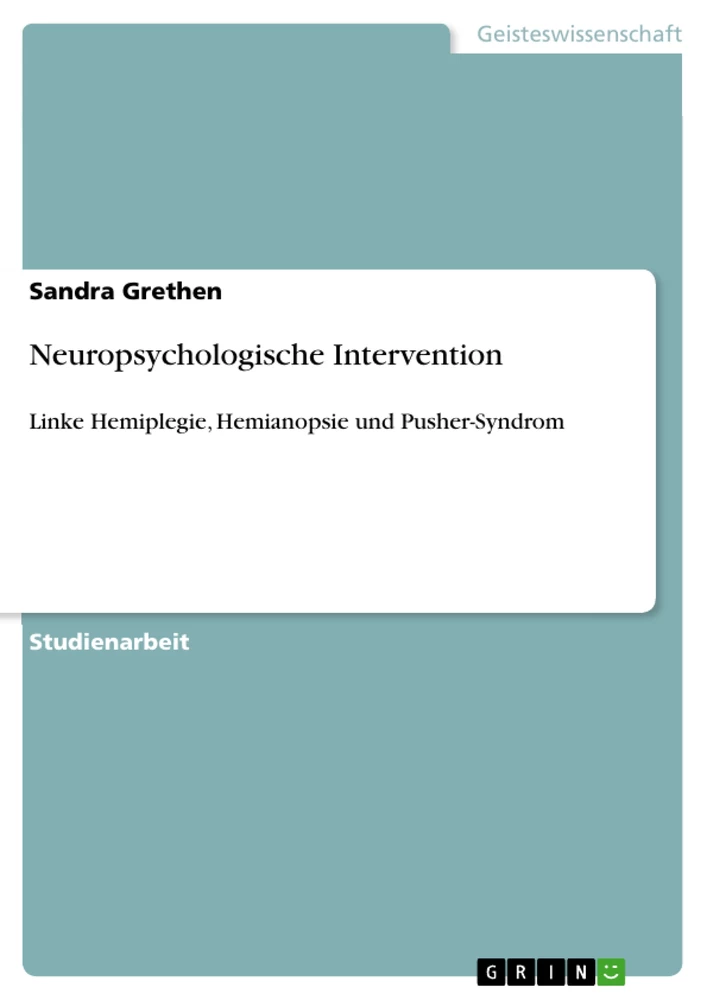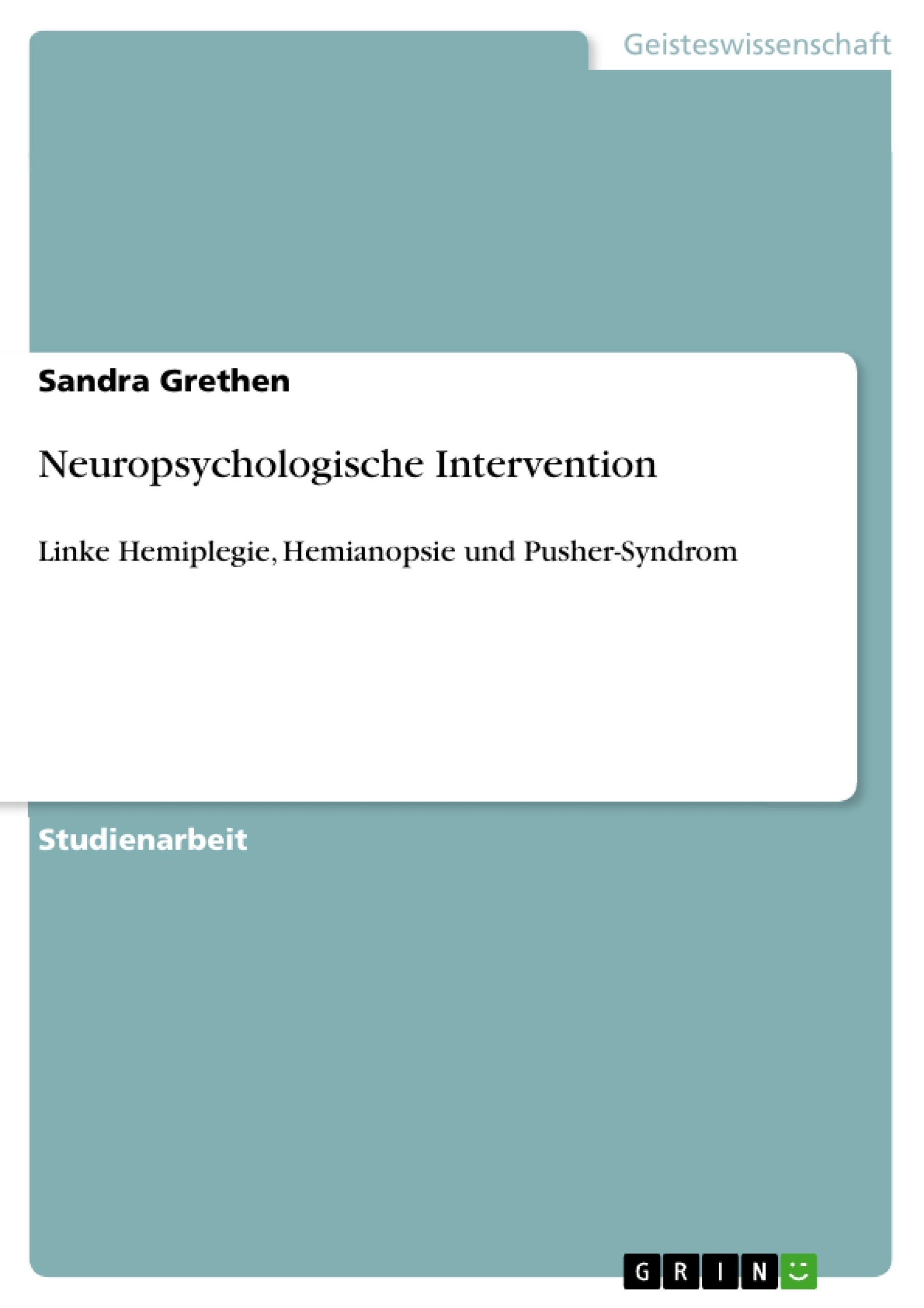Im Manuskript wird erläutert, welche wissenschaftlich fundierte neuropsychologische Interventionen bei Patienten mit linker Hemiplegie, einer Hemianopsie und dem Pusher-Syndrom verwendet werden. Dies wird anhand eines Fallbeispiels illustriert und einer Eignungsdiagnostik vorangegangen.
Die Problembereiche lassen sich grob in fünf Gebiete einteilen. Das erste wäre die exekutiven Funktionen; es gibt vor allem eine Beeinträchtigung der Hemmungskapazität (gestörte Aktivitätsregulation), die dazu führt, dass er sich leicht ablenken lässt, einen starken Redefluss hat, leicht abschweift, und somit Probleme auftreten, wenn Aufgaben ausgeführt werden sollen. Zusätzlich hat diese gestörte Inhibition aber auch einen Einfluss auf das Arbeitsgedächtnis. Reihenfolgen, die vorwärts aufgesagt werden sollen, können von ihm problemlos wiedergegeben werden, allerdings ergeben sich Probleme, wenn er die Reihenfolge rückwärts aufsagen muss, was dadurch kommen kann, dass er sich die Zahlen zwar merken kann, durch seine erhöhte Ablenkbarkeit und gestörte Inhibition aber zu viele unnütze Informationen aufnimmt, und es zum Informationsüberfluss kommt, der ihn daran hindert, die Zahlen nicht nur zu speichern, sondern ebenfalls zu bearbeiten.
Der dritte Bereich bezieht sich auf die Aufmerksamkeit, mit Beeinträchtigungen der tonischen und phasischen Alertness, der Orientierung sowie der auditiven und visuellen Selektivität. Der vierte Problembereich umfasst sein linkes Halbseitenneglect, durch das die visuelle und taktile Exploration nach rechts verschoben ist. Letzter Problembereich bezieht sich auf die Motorik, genauer die linke Hemiplegie und das Pusher-Syndrom.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Eingangsdiagnostik
- 1.1 Herr G.s Befund
- 1.2 Störungsschwerpunkte
- 2. Ableitung von Therapiezielen
- 2.1 Grobziele
- 2.2 Feinziele
- 3. Auswahl von Therapiemethoden
- 4.1 Therapie des Neglects
- 4.2 Therapie des Pusher-Syndroms
- 4.3 Therapie des psychischen Wohlbefindens
- 4.4 Therapie exekutiver Funktionen
- 4.4.1 Arbeitsgedächtnistraining
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschreibt die neuropsychologische Intervention bei Herrn G., einem 43-jährigen Patienten nach einem rechten sylvischen Apoplex. Das Ziel ist die Ableitung und Beschreibung eines individuellen Therapieplans, basierend auf einer detaillierten Eingangsdiagnostik und der Definition konkreter Therapieziele.
- Eingangsdiagnostik und Beschreibung der Störungsschwerpunkte bei Herrn G.
- Definition von Grob- und Fein-Therapiezielen basierend auf den identifizierten Defiziten.
- Auswahl und Begründung geeigneter Therapiemethoden für die verschiedenen Störungsbilder.
- Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen, Aufmerksamkeit und Neglect.
- Relevanz der Verbesserung des psychischen Wohlbefindens im Therapieprozess.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Eingangsdiagnostik: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Eingangsdiagnostik von Herrn G., einem 43-jährigen Patienten nach einem Schlaganfall. Es werden Anamnese, neurologischer Befund und eine Funktionsanalyse nach vier Monaten detailliert beschrieben. Die Funktionsanalyse enthüllte Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit (tonische und phasische Alertness, auditive und visuelle Selektivität), der exekutiven Funktionen (insbesondere Hemmungskapazität und Arbeitsgedächtnis) und einen linksseitigen Neglect. Die Verhaltensbeobachtung zeigt Schwierigkeiten im Gesprächsverhalten und in der Aufgabenbewältigung sowie ein Pusher-Syndrom. Die Umfeldanalyse verdeutlicht die soziale Isolation des Patienten und die Überforderung seiner Eltern. Schließlich werden die Störungsschwerpunkte in fünf Bereiche eingeteilt: exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Neglect, Motorik (Hemiplegie und Pusher-Syndrom). Die detaillierte Beschreibung dieser Befunde legt die Grundlage für die Ableitung der Therapieziele im folgenden Kapitel.
2. Ableitung von Therapiezielen: Aufbauend auf der Eingangsdiagnostik werden in diesem Kapitel die Grob- und Feinziele der Therapie für Herrn G. formuliert. Vier übergeordnete Grobziele werden definiert: Verbesserung der Aktivitätsregulation (Inhibition), Verbesserung der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses, Verbesserung des motorischen Funktionsniveaus (Neglect und Pusher-Syndrom) und Verbesserung des psychischen Wohlbefindens. Die Grobziele werden im Anschluss mithilfe der SMART-Kriterien in messbare und erreichbare Feinziele überführt. Für jedes Feinziel werden konkrete Maßnahmen und Evaluationsmöglichkeiten beschrieben, um den Therapieerfolg zu überprüfen. Die enge Verknüpfung der Grob- und Feinziele mit den im ersten Kapitel beschriebenen Befunden verdeutlicht den individualisierten Ansatz der Therapieplanung.
Schlüsselwörter
Neuropsychologische Intervention, Schlaganfall (Apoplex), Neglect, Pusher-Syndrom, Hemiplegie, Exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Hemmungskapazität, Therapieziele, Aktivitätsregulation, psychisches Wohlbefinden, SMART-Kriterien.
Häufig gestellte Fragen zur Neuropsychologischen Intervention bei Herrn G.
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit beschreibt die neuropsychologische Intervention bei Herrn G., einem 43-jährigen Patienten nach einem rechten sylvischen Apoplex. Ziel ist die Ableitung und Beschreibung eines individuellen Therapieplans, basierend auf detaillierter Eingangsdiagnostik und der Definition konkreter Therapieziele.
Welche Aspekte der Eingangsdiagnostik werden behandelt?
Die Eingangsdiagnostik umfasst Anamnese, neurologischen Befund und eine Funktionsanalyse nach vier Monaten. Diese enthüllte Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit, der exekutiven Funktionen (insbesondere Hemmungskapazität und Arbeitsgedächtnis) und einen linksseitigen Neglect. Zusätzlich wird ein Pusher-Syndrom und die soziale Isolation des Patienten beschrieben.
Welche Störungsschwerpunkte werden bei Herrn G. identifiziert?
Die identifizierten Störungsschwerpunkte umfassen: exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Neglect, Motorik (Hemiplegie und Pusher-Syndrom) und psychisches Wohlbefinden.
Wie werden die Therapieziele definiert?
Die Therapieziele werden in Grob- und Feinziele unterteilt. Vier übergeordnete Grobziele zielen auf die Verbesserung der Aktivitätsregulation, der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses, des motorischen Funktionsniveaus (Neglect und Pusher-Syndrom) und des psychischen Wohlbefindens ab. Diese werden mit SMART-Kriterien in messbare und erreichbare Feinziele umgewandelt, inklusive konkreter Maßnahmen und Evaluationsmöglichkeiten.
Welche Therapiemethoden werden eingesetzt?
Die Hausarbeit beschreibt die Auswahl und Begründung geeigneter Therapiemethoden für die verschiedenen Störungsbilder, darunter spezifische Ansätze zur Therapie des Neglects, des Pusher-Syndroms und zur Verbesserung der exekutiven Funktionen (z.B. Arbeitsgedächtnistraining). Die Verbesserung des psychischen Wohlbefindens wird ebenfalls als wichtiger Therapieaspekt hervorgehoben.
Welchen Zusammenhang besteht zwischen exekutiven Funktionen, Aufmerksamkeit und Neglect?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen diesen drei Bereichen im Kontext der neuropsychologischen Beeinträchtigungen bei Herrn G. Die Interdependenz dieser Funktionen wird im Therapieplan berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neuropsychologische Intervention, Schlaganfall (Apoplex), Neglect, Pusher-Syndrom, Hemiplegie, Exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Hemmungskapazität, Therapieziele, Aktivitätsregulation, psychisches Wohlbefinden, SMART-Kriterien.
Wie wird der Therapieerfolg evaluiert?
Für jedes Feinziel werden konkrete Maßnahmen und Evaluationsmöglichkeiten beschrieben, um den Therapieerfolg zu überprüfen. Die enge Verknüpfung der Grob- und Feinziele mit den Befunden aus der Eingangsdiagnostik soll einen individualisierten Ansatz und die Erfolgskontrolle gewährleisten.
- Citation du texte
- Sandra Grethen (Auteur), 2019, Neuropsychologische Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535120