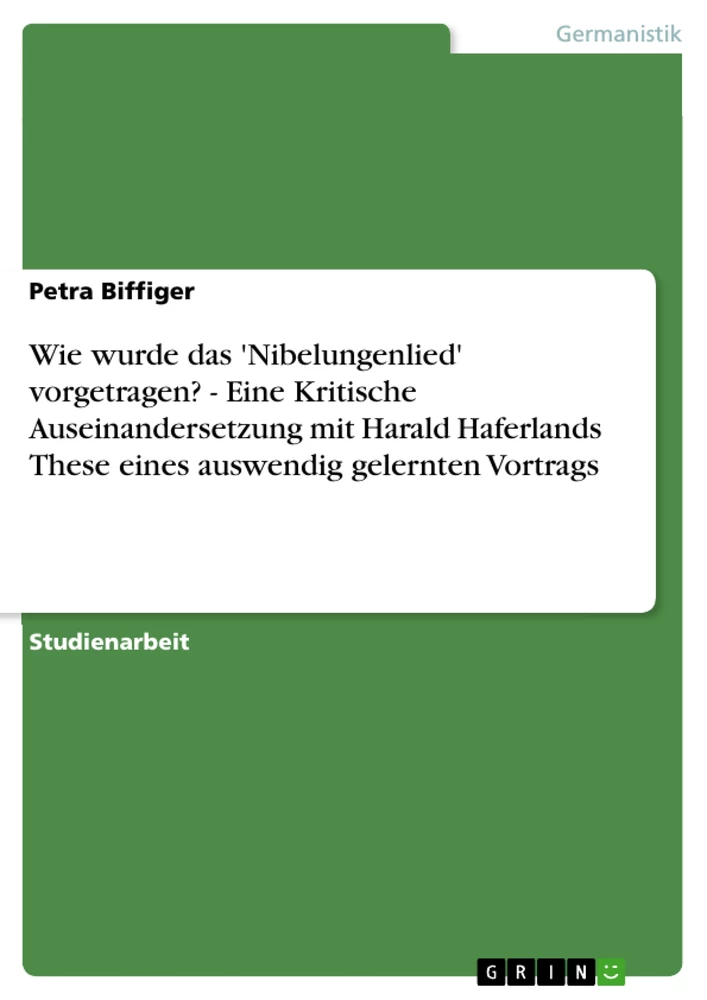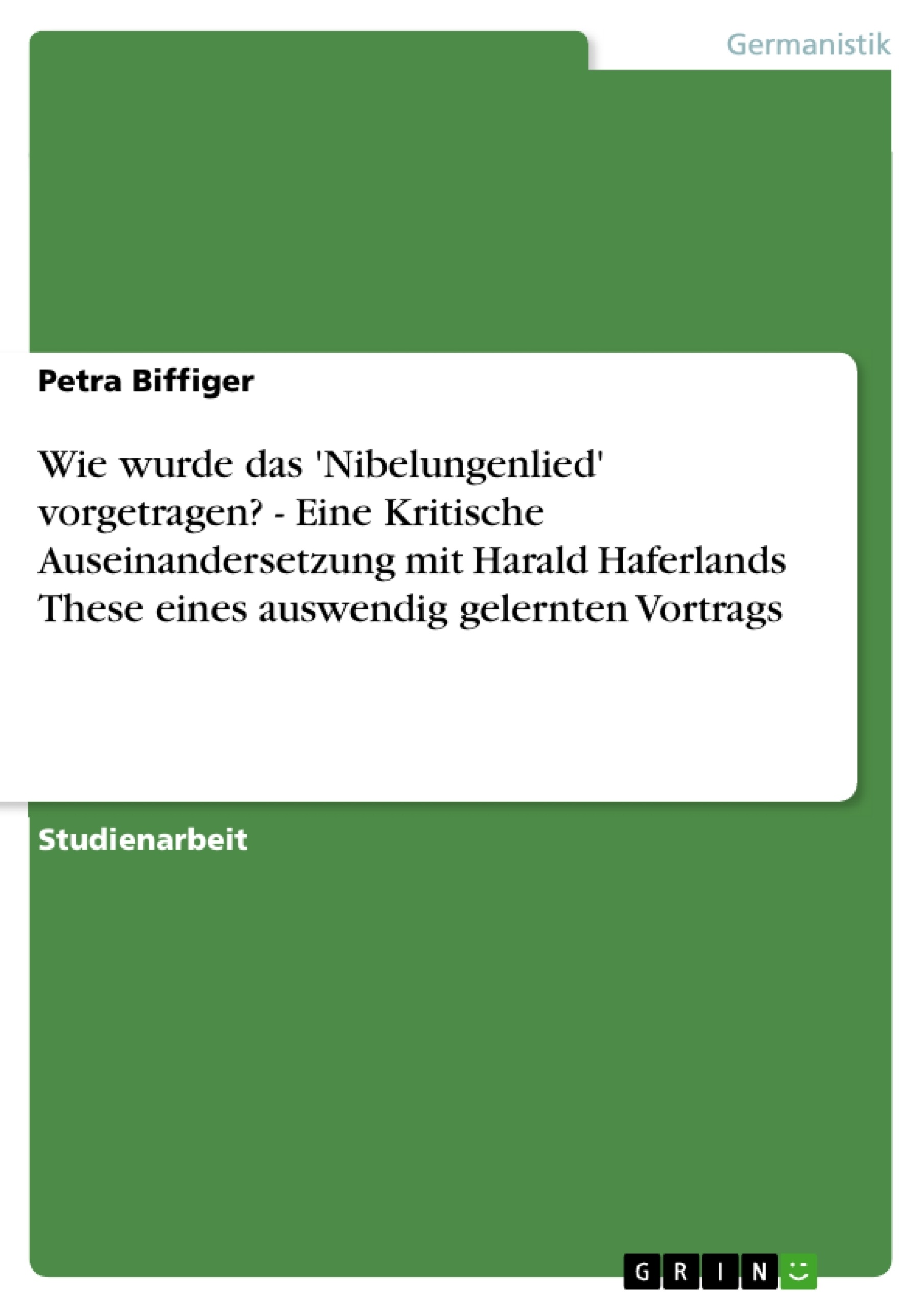In der Regel bestand die Vortragsform der höfischen Dichtung im Vorlesen durch den Autor oder einen Vorleser. Selten mag es zu einer einsamen Lektüre gekommen sein. Wie ‘Erec’, ‘Iwein’, ‘Parzival’ usw. gehört das ‘Nibelungenlied’ zur Buchdichtung. Es gliedert sich mit seinem Inhalt über höfische Lebensformen durchaus auch in diese Reihe ein. Doch in seinem Vortrag unterscheidet es sich, laut Haferland, auffällig vom neuen höfischen Literaturbetrieb.
Aufgrund des Umfanges des ‘Nibelungenliedes’ ging man bislang davon aus, dass es vor Jahrhunderten als schriftliche Dichtung verfasst und beim Vortrag abgelesen wurde. Doch war dem wirklich so? Harald Haferland, der an der Freien Universität Berlin Altgermanistik lehrt, ist diesem Problem in seinem Aufsatz über die „Mündlichkeit des ‘Nibelungenliedes’“ auf den Grund gegangen. Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist es nun, einen Überblick über diesen Aufsatz und dessen Hypothesen zu verschaffen, kritisch dazu Stellung zu nehmen und einige neue Punkte aufzugreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der mündliche Vortrag ohne Schriftstütze
- Die Eingangsinitiale der St. Galler Handschrift
- Haferland
- Aufsatz von Christel Meier zur Unterstützung der These von Haferland
- Die fehlende Prologstrophe in der St. Galler Handschrift
- Persönliche Stellungnahme
- Der Epilog der ‘Klage’
- Das in der 'Klage' vorgestellte Überlieferungsmodell des 'Nibelungenlied'
- Stellungnahme Haferlands zu diesem Überlieferungsmodell
- Das 'Nibelungenlied' als mündlicher Vortrag, im Sinne einer „composition in performance“ (Dichten aus dem Stegreif)
- Was sind,,Formeln“?
- Oral-Formulaic Theory von Parry und Lord
- Die Stellungnahme Haferlands zu der Oral-Formulaic Theory
- Stellungnahme anderer Forscher
- Was blieb von dieser Theorie noch übrig?
- Persönliche Stellungnahme
- Die Eingangsinitiale der St. Galler Handschrift
- Der mündliche Vortrag mit Schriftstütze
- Der auswendig gelernte Vortrag
- Die poetische Sprache
- Die Funktion von Rhythmus und Reim
- Die Funktion von Vers und Strophen
- Die Funktion von Melodie und Tanz
- Hypothese Haferlands
- Die Theorie von Curschmann
- Stellungnahme Haferlands zur Theorie von Curschmann
- Der vorgelesene Vortrag
- Was spricht für einen vorgelesenen Vortrag?
- Was spricht gegen diese zwei Punkte für einen vorgelesenen Vortrag?
- Der auswendig gelernte Vortrag
- Die Repräsentivität der Handschriften A, B und C
- Die Münchener Handschrift (A)
- Die St. Galler Handschrift (B)
- Die Hohenems-Lassbergsche 'Nibelungenlied'-Handschrift (C)
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie das 'Nibelungenlied' im Mittelalter vorgetragen wurde. Sie analysiert die These von Harald Haferland, der argumentiert, dass das 'Nibelungenlied' auswendig gelernt und ohne Schriftstütze vorgetragen wurde. Die Arbeit beleuchtet die relevanten Argumente und Gegenargumente, um die Plausibilität von Haferlands These zu bewerten.
- Mündlichkeit des 'Nibelungenliedes'
- Analyse der St. Galler Handschrift
- Oral-Formulaic Theory
- Der auswendig gelernte Vortrag
- Die Repräsentativität der Handschriften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die Mündlichkeit des 'Nibelungenliedes', indem sie verschiedene Aspekte des Vortrags beleuchtet. Kapitel 2 analysiert die Eingangsinitiale der St. Galler Handschrift und die Rolle der "Oral-Formulaic Theory" in Bezug auf das 'Nibelungenlied'. In Kapitel 3 wird der auswendig gelernte Vortrag näher beleuchtet und die Theorie von Curschmann in Beziehung zu Haferlands These gesetzt. Kapitel 4 untersucht die Repräsentativität der verschiedenen Handschriften des 'Nibelungenliedes'.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Mündlichkeit, 'Nibelungenlied', Harald Haferland, St. Galler Handschrift, Oral-Formulaic Theory, auswendig gelernter Vortrag, Handschriftenvergleich, Repräsentativität.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde das Nibelungenlied im Mittelalter vorgetragen?
Die Arbeit untersucht die These von Harald Haferland, wonach das Epos nicht abgelesen, sondern auswendig gelernt und mündlich ohne Schriftstütze vorgetragen wurde.
Was ist die „Oral-Formulaic Theory“?
Diese Theorie besagt, dass Epen durch die Verwendung fester Formeln während des Vortrags spontan neu komponiert wurden („composition in performance“).
Welche Rolle spielt die St. Galler Handschrift (B) in der Debatte?
Analyseobjekte wie die Eingangsinitiale und die fehlende Prologstrophe in dieser Handschrift dienen als Indizien für oder gegen die Mündlichkeitsthese.
Was spricht für einen auswendig gelernten Vortrag?
Haferland argumentiert, dass Rhythmus, Reim, Strophenbau und Melodie als Gedächtnisstützen fungierten und so einen Vortrag ohne Buch ermöglichten.
Was ist eine „Schriftstütze“ beim Vortrag?
Eine Schriftstütze ist ein Manuskript oder Buch, das dem Vorleser während des Vortrags vorliegt, um den Text originalgetreu wiederzugeben.
- Quote paper
- Petra Biffiger (Author), 2005, Wie wurde das 'Nibelungenlied' vorgetragen? - Eine Kritische Auseinandersetzung mit Harald Haferlands These eines auswendig gelernten Vortrags, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53538