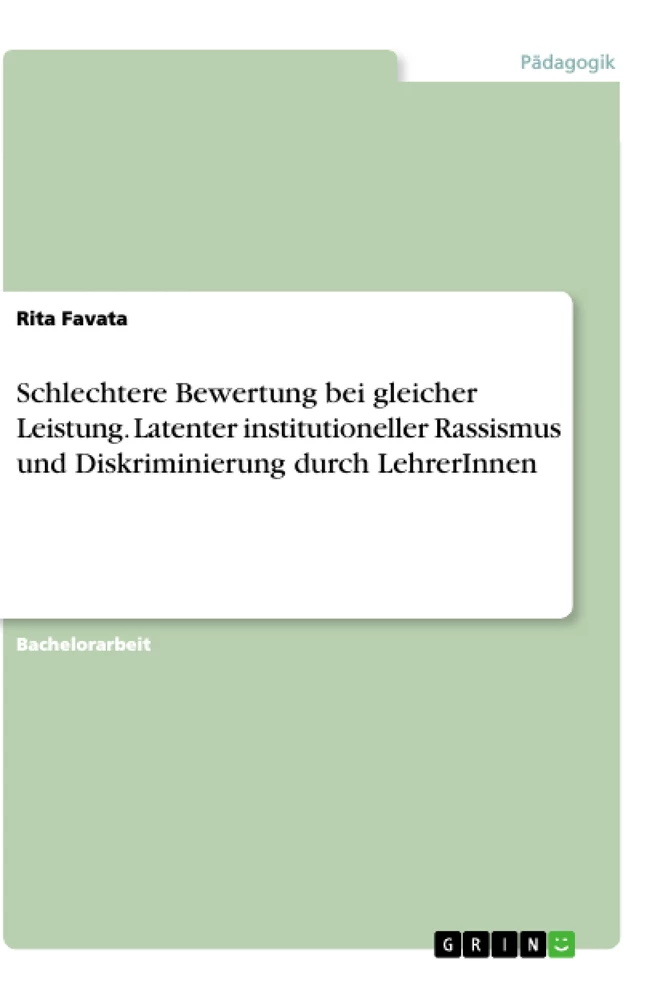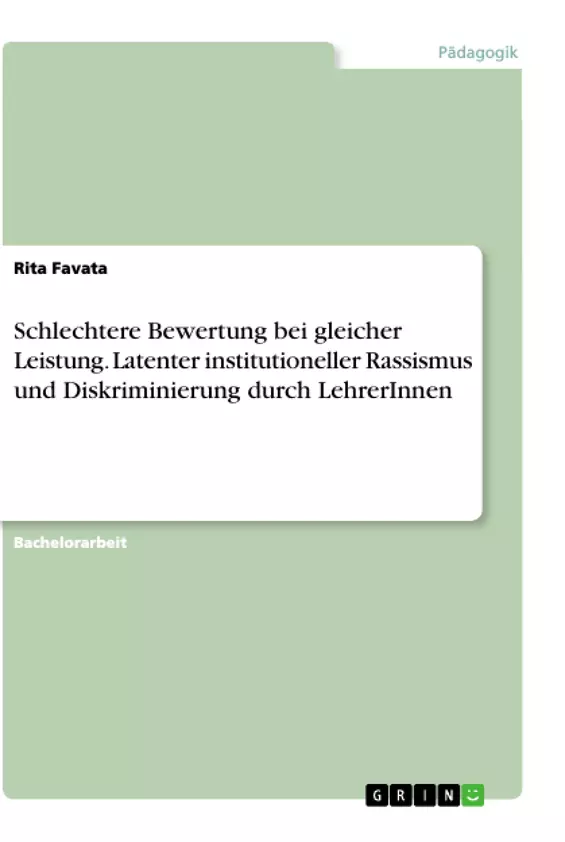Die vorliegende Arbeit geht u.a. der Frage nach, welche Rolle die Lehrer im Kontext Rassismus und Schule, spielen. Das
Konzept ist in zwei große Abschnitte, den theoretischen Rahmen und den empirischen Teil, gegliedert.
Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel der Forschungsstand aufgezeigt und die Forschungsfrage ausformuliert. Danach erfolgt im dritten Kapitel die Vorstellung von Michel Foucault, der den theoretischen Kontext bildet. Mit seiner Sichtweise auf die Thematik des Diskurses und die damit zusammenhängenden Machtstrukturen, sowie dessen Wirkung
auf Konstrukte, beschäftigt sich dieser Teil der Arbeit.
Hierbei wird auf den Rassismus-Diskurs (und Schule) im vierten Kapitel hingewiesen. Folgende Erklärung zeigt die Bedeutsamkeit des Ansatzes von Foucault für die Untersuchung des vorliegenden Konzepts auf. In seinem Text "Subjekt und Macht" von 1982 deskribiert Foucault, dass wenn menschliche Subjekte in Produktionsverhältnisse und Sinn-Beziehungen eingebunden sind, auch komplexe Machtverhältnisse vorhanden sind. Er sieht die Machtbeziehungen tief in unserer Gesellschaft verwurzelt.
Ausschlaggebend bei der vorliegenden Arbeit ist die Analyse von Machtrelationen um dann veranschaulichen zu können, welche Machtfaktoren in schulischen (rassistischen) Diskursen vorhanden sind, um das stereotype Denken bei Lehrern zu suggerieren. Um den Begriff Rassismus zu erklären, wird u.a. Albert Memmi aufgeführt. In diesem Kontext fokussiert sich der Blick auf die Machtstrukturen des Rassismus und diesbezüglich auf die Institution Schule, ihr Lehrplan und die Rolle
der Schulbücher.
Anschließend wird der Terminus "Institutionelle Diskriminierung" definiert. Zu bemerken wäre hier, dass sich mit dieser Thematik nur wenige Wissenschaftler auseinandersetzen. Aufbauend auf diese Definition wird der Ansatz der Stigmatisierungsprozesse von Erving Goffman vorgestellt. Es folgt der Forschungsstand über die Bewertungspraxis der LehrerInnen, um nachfolgend die Kompetenzen bei der Notengebung und des daraus resultierenden Machtverhältnisses zwischen LehrerInnen und SchülerInnen erläutern zu können.
In diesem Kontext werden die Studien von Rosenthal & Jacobsen, "man wird wie man gesehen wird" und die Erwartungseffekte der Lehrer-Schüler-Interaktion von Brophy & Good erklärt und abschließend die Auswirkung auf die SchülerInnen dargestellt. Die Beschreibung des Migration-Begriffs findet im sechsten Kapitel statt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Theoretischer Bezugsrahmen
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand und Forschungsfrage
- 3. FOUCAULT
- 3.1 Diskurs und Macht
- 3.2 Diskurse und ihre Wirkung auf Konstrukte
- 4. RASSISMUS
- 4.1 Rassismus als Diskurs
- 4.2 Alltagsrassismus
- 4.3 Rassismus und Schule
- 4.4 Rassismus nach Lehrplan
- 4.5 Rassismus in Schulbücher
- 5. INSTITUTIONELLE DISKRIMINIERUNG
- 5.1 Institutionelle Diskriminierung im Kontext Schule: Gomolla und Radtke
- 5.2 Stigmatisierungsprozesse: Goffman
- 5.3 Forschungsstand: Bewertungspraxis der LehrerInnen
- 5.4 Kompetenzen der Lehrerinnen im Sektor Notengebung
- 5.5 Machtverhältnisse zwischen LehrerInnen und SchülerInnen
- 5.6 Pygmalion Effect: Rosenthal & Jacobson
- 5.7 Erwartungseffekte
- 6. MIGRATION
- 6.1 SchülerInnen mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen
- 6.2 Migrationspädagogik: Mecheril
- B. Empirischer Teil
- 7. FORSCHUNGSDESIGN
- 7.1 Methodik
- 7.2 Situationsanalyse nach Adele Clarke
- 7.3 Problemzentriertes Interview
- 7.4 Leitfaden Interview
- 7.5 Ausführung Interview
- 7.6 Analyse und Darstellung der Befunde
- 8. FAZIT und AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Rolle Lehrerinnen im Kontext von Rassismus und Schule spielen, und untersucht, ob und wie latente institutionelle Diskriminierung und latenter Rassismus durch Lehrerinnen zu schlechteren Bewertungen bei gleicher Leistung führen können. Die Arbeit analysiert, wie sich Machtstrukturen in schulischen Diskursen manifestieren und wie diese zum stereotypen Denken bei Lehrerinnen beitragen können.
- Machtverhältnisse zwischen Lehrerinnen und Schülern
- Institutionelle Diskriminierung in der Schule
- Rassismus als Diskurs und seine Auswirkungen auf Schüler mit Migrationshintergrund
- Bewertungspraxis von Lehrerinnen und der Einfluss von Stereotypen
- Der Einfluss von Erwartungen auf die Leistung von Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und den Forschungsstand beleuchtet. Anschließend wird der theoretische Rahmen der Arbeit vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf Michel Foucault und seinem Konzept des Diskurses und der Macht liegt. Die Arbeit untersucht die spezifischen Auswirkungen des Rassismusdiskurses auf Schule und die Entstehung von institutioneller Diskriminierung. Es werden die Erkenntnisse von Goffman über Stigmatisierungsprozesse sowie die Bewertungspraxis von Lehrerinnen und deren Einfluss auf die Leistung von Schülern erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Rassismus, institutionelle Diskriminierung, Machtverhältnisse, Bewertungspraxis, Stereotype, Erwartungseffekte, Migration, Schulen und Lehrerinnen.
- Citation du texte
- Rita Favata (Auteur), 2019, Schlechtere Bewertung bei gleicher Leistung. Latenter institutioneller Rassismus und Diskriminierung durch LehrerInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535519