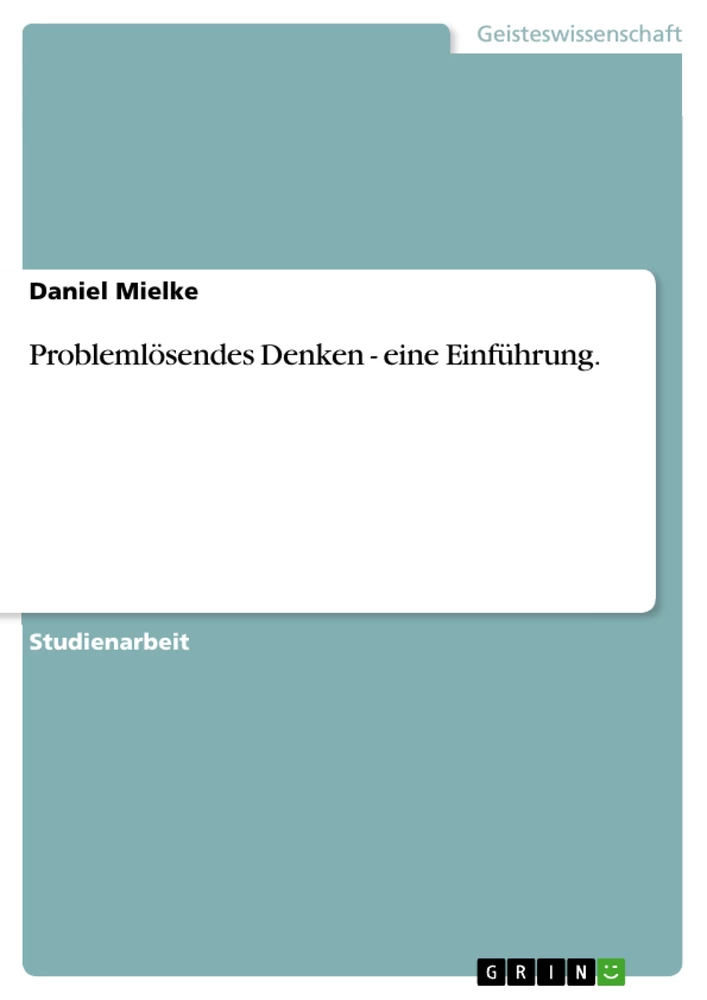Problemlösendes Denken - Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung - ist ein Teil der Denkpsychologie, dessen theoretischer Ursprung primär in der Gestaltpsychologie zu finden ist, welche mittels Tierexperimenten/ -beobachtungen Lösungsprozesse in großer Zahl untersuchte. Diese greifen auf prozedurales Wissen, „also Wissen über Art und Weise, wie man verschiedene kognitive Aktivitäten und Operationen ausführt“ zurück und lassen sich schließlich auf menschliches Verhalten umlegen, da dieses immer teleologisch ist. Im Rahmen entsprechender Prozesse sind drei Merkmale von exponierter Stellung, nämlich die Zielgerichtetheit, welche bestimmt, dass Verhalten respektive Operationen eindeutig einem bestimmten Ziel folgen, Zerlegung in Teilziele, die eine für das Erreichen zu generierende Differenzierung in separate Aufgaben konkretisiert und letzten Endes die hierfür erforderliche Anwendung von Operatoren. „Ein Problem liegt immer dann vor, wenn ein Hindernis oder eine Barriere das unmittelbare Erreichen eines Ziels verhindert.“ Jedoch gibt es unterschiedliche Problemtypen, die als gut bzw. schlecht definiert angegeben werden können. Erstgenannte zeichnet aus, dass ihr Anfangs- sowie Zielzustand klar identifizierbar ist, wohingegen letztere eben keine genaue Spezifizierung lösungsrelevanter Komponenten aufweisen. Allerdings können einige schlecht stellenweise auch in gut bestimmte umgeformt werden, wofür Pläne auszuarbeiten sind. Angesprochene Diskrepanz, die ein Problem ja auszeichnet, kann über eine Ansammlung weiterer Informationen umgeformt werden, was über unterschiedliche Operationen geschieht, und schließlich vermindert werden, bis eine Lösung gefunden ist. Zu Beginn nutzt man das schon bestehende Wissen, um die Aufgabe festzulegen. Die durch den Lösungsprozess permanent erweiterte Kenntnismenge bezeichnet man als Wissenszustand. Kurz gesagt: beim Problemlösen wird ein Anfangs- schlussendlich in einen Zielzustand überführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Summe aller Zustände - der Problemraum
- 3. Problemlöseoperatoren
- 3.1. Algorithmus und Heuristik als Problemlösungsverhalten
- 3.2. Hilfreiche Richtlinien und ihre Grenzen
- 3.3. Enkodierte „kristallisierte“ Problemlöseoperatoren - die Produktionsregeln
- 4. Die Auswahl von Operatoren
- 4.1. Wie findet man einen (geeigneten) Operator?
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem problemlösenden Denken, einem Teilgebiet der Denkpsychologie mit Wurzeln in der Gestaltpsychologie. Ziel ist es, die grundlegenden Konzepte und Prozesse des Problemlösens zu erläutern, von der Definition eines Problems über die Struktur des Problemraums bis hin zur Auswahl von Problemlöseoperatoren.
- Definition und Typen von Problemen
- Der Problemraum und seine Struktur
- Problemlöseoperatoren: Algorithmen und Heuristiken
- Strategien zur Operatorenauswahl
- Vorwärts- und Rückwärtssuche
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema problemlösenden Denkens ein und beschreibt es als einen Prozess, der auf prozeduralem Wissen basiert und durch Zielgerichtetheit, Zerlegung in Teilziele und die Anwendung von Operatoren gekennzeichnet ist. Es werden verschiedene Problemtypen unterschieden (gut und schlecht definiert) und die Bedeutung des Wissenszustandes im Lösungsprozess hervorgehoben. Der Prozess wird als Transformation eines Anfangszustandes in einen Zielzustand beschrieben, wobei die Überwindung von Hindernissen im Vordergrund steht. Die Ausführungen basieren auf theoretischen Grundlagen der Gestaltpsychologie und verweisen auf die Bedeutung von Tierversuchen für das Verständnis menschlicher Problemlöseprozesse.
2. Summe aller Zustände – der Problemraum: Das Kapitel beschreibt Problemlösen als Suche innerhalb eines Problemraums, der aus verschiedenen Problemzuständen besteht: Anfangszustand, intermediäre Zustände und Zielzustand. Am Beispiel eines Labyrinths wird veranschaulicht, wie der Problemraum alle möglichen Zustände umfasst, unabhängig davon, ob sie zum Ziel führen oder nicht. Mentale Operatoren, die oft einem Wenn-Dann-Schema folgen, transformieren einen Zustand in den nächsten. Die Komplexität des Problemraums (z.B. die exponentiell wachsende Anzahl möglicher Wege in einem Labyrinth) führt zur Notwendigkeit von Problemlösungsstrategien, die im folgenden Kapitel behandelt werden.
Schlüsselwörter
Problemlösendes Denken, Denkpsychologie, Gestaltpsychologie, Problemraum, Problemzustände (Anfangs-, Zwischen-, Zielzustand), Problemlöseoperatoren, Algorithmen, Heuristiken, Vorwärts- und Rückwärtssuche, Wissenszustand, Zielgerichtetheit, Teilziele.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Problemlösendes Denken"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema "Problemlösendes Denken", ein Teilgebiet der Denkpsychologie. Er behandelt grundlegende Konzepte und Prozesse des Problemlösens, von der Definition eines Problems über die Struktur des Problemraums bis hin zur Auswahl von Problemlöseoperatoren. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einführung, 2. Summe aller Zustände - der Problemraum, 3. Problemlöseoperatoren (mit Unterkapiteln zu Algorithmus und Heuristik, hilfreichen Richtlinien und Produktionsregeln), 4. Die Auswahl von Operatoren (mit Unterkapitel zur Suche nach geeigneten Operatoren) und 5. Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist die Erklärung der grundlegenden Konzepte und Prozesse des Problemlösens. Es werden die Definition von Problemen, die Struktur des Problemraums und die Auswahl von Problemlöseoperatoren erläutert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Definition und Typen von Problemen, die Struktur des Problemraums, Problemlöseoperatoren (Algorithmen und Heuristiken), Strategien zur Operatorenauswahl und Vorwärts- und Rückwärtssuche.
Was wird im Kapitel "Einführung" behandelt?
Die Einführung beschreibt problemlösendes Denken als einen prozeduralen Prozess, der durch Zielgerichtetheit, Zerlegung in Teilziele und die Anwendung von Operatoren gekennzeichnet ist. Es werden verschiedene Problemtypen (gut und schlecht definiert) unterschieden und die Bedeutung des Wissenszustandes hervorgehoben. Der Prozess wird als Transformation eines Anfangs- in einen Zielzustand beschrieben, wobei die Überwindung von Hindernissen im Vordergrund steht. Der Einfluss der Gestaltpsychologie und die Bedeutung von Tierversuchen werden erwähnt.
Was wird im Kapitel "Summe aller Zustände - der Problemraum" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Problemlösen als Suche innerhalb eines Problemraums, der aus verschiedenen Zuständen (Anfangs-, Zwischen- und Zielzustand) besteht. Am Beispiel eines Labyrinths wird die Komplexität des Problemraums (exponentiell wachsende Anzahl möglicher Wege) verdeutlicht und die Notwendigkeit von Problemlösungsstrategien begründet.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Problemlösendes Denken, Denkpsychologie, Gestaltpsychologie, Problemraum, Problemzustände (Anfangs-, Zwischen-, Zielzustand), Problemlöseoperatoren, Algorithmen, Heuristiken, Vorwärts- und Rückwärtssuche, Wissenszustand, Zielgerichtetheit und Teilziele.
Auf welchen theoretischen Grundlagen basiert der Text?
Der Text basiert auf theoretischen Grundlagen der Gestaltpsychologie und bezieht sich auf die Bedeutung von Tierversuchen für das Verständnis menschlicher Problemlöseprozesse.
Welche Arten von Problemlöseoperatoren werden beschrieben?
Der Text beschreibt Algorithmen und Heuristiken als Problemlöseoperatoren. Es wird auch der Begriff der "enkodierten kristallisierten Problemlöseoperatoren" - die Produktionsregeln - eingeführt.
Wie wird die Auswahl von Operatoren behandelt?
Der Text widmet sich der Frage, wie man einen geeigneten Operator findet und behandelt Strategien zur Operatorenauswahl, einschließlich Vorwärts- und Rückwärtssuche.
- Citation du texte
- Daniel Mielke (Auteur), 2005, Problemlösendes Denken - eine Einführung., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53567