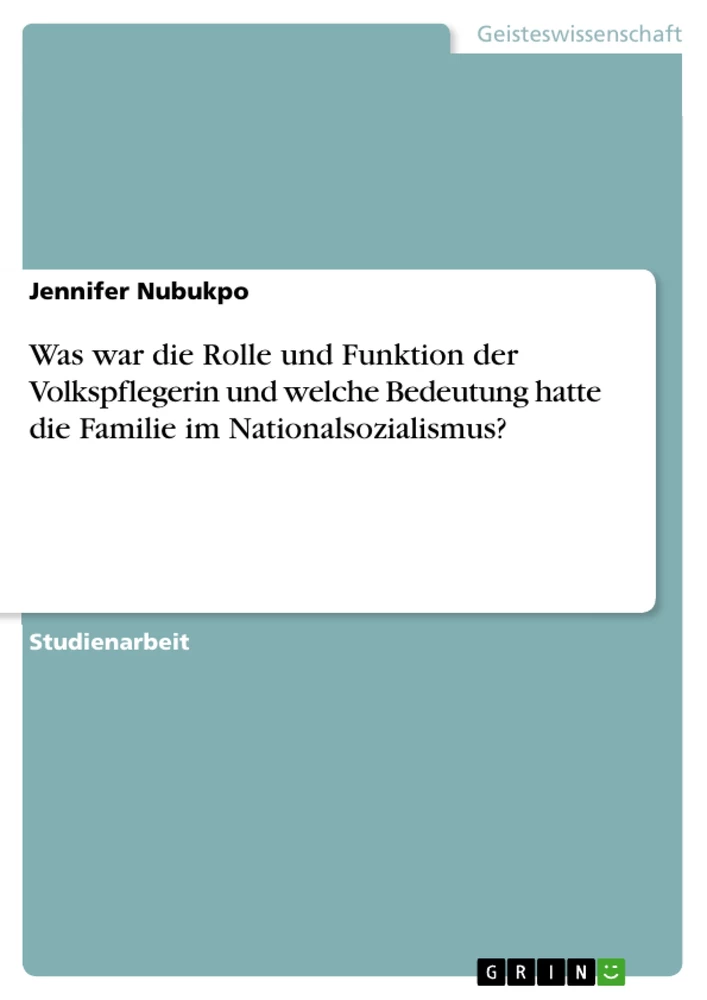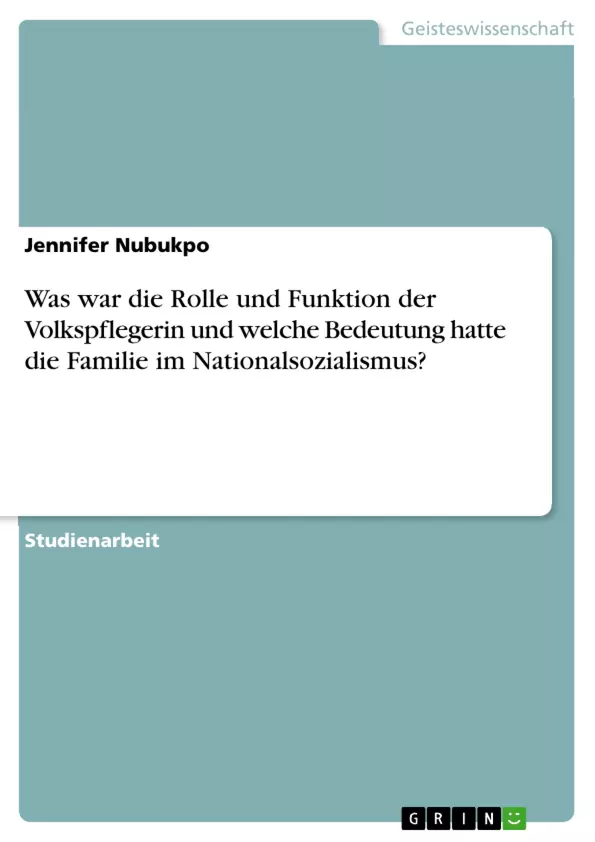Der Nationalsozialismus war das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Im Jahr 1933 kam Adolf Hitler an die Macht, womit sich die Politik der Weimarer Republik in das diktatorische Regime des Nationalsozialismus entwickelte. Zu dieser Zeit spielte die Soziale Arbeit eine wesentliche Rolle. Während die Sozialarbeit noch in der Weimarer Republik als Wohlfahrtspflege/Fürsorge bekannt war, forcierte sich diese im Nationalsozialismus in die Volkspflege. Doch neben der Veränderung in der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus, erfolgte eine massive Reformierung der Familienpolitik in dieser Zeit, die drastische Auswirkungen auf die Erziehung von Kindern und das Leben in Familien nach sich zog.
Somit wird in der Hausarbeit der Frage nachgegangen, welche Rolle und Funktion der Volkspflegerin und welche Bedeutung die Familie im Nationalsozialismus hatte.
Dazu wird im ersten Teil der Arbeit die Geschichte und die Entwicklung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus vorgestellt. Darin wird auf die Entstehung der Volkspflege eingegangen, worin die Situation der Fürsorge während des Faschismus dargestellt wird. Des Weiteren wird die daraus resultierende Volkspflege sowie der berufliche Werdegang der Frauen und dessen Berufsbedingungen erläutert. Im weiteren Verlauf des Kapitels folgt dann die Darstellung der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV). Infolgedessen wird verdeutlicht, welche Bedeutung die Familie zu dieser Zeit hatte. Dabei soll der Fokus konkret auf der Erziehung des Kindes und der Rollenverteilung in der Familie liegen. Abschließend folgt das Fazit.
Für die weiteren Ausführungen innerhalb der vorliegenden Arbeit wird lediglich auf die Tätigkeit der Frauen eingegangen und der Begriff der Volkspflegerin (weibliche Form) verwendet, zumal die Fürsorgearbeit/Volkspflege, mit nahezu 90 % der Beschäftigten, in den Arbeitsbereich der Frauen fiel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte und Entwicklung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus.
- Die Entstehung der Volkspflege
- Der Fürsorgerinnenberuf
- Von der Fürsorge zur Volkspflege
- Beruflicher Werdegang der Frauen / Arbeitsmarkt und Berufsbedingungen
- Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
- Die Entstehung der Volkspflege
- Die Familie im Nationalsozialismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle und Funktion der Volkspflegerin sowie der Bedeutung der Familie im Nationalsozialismus. Dabei wird insbesondere die Entwicklung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus von der Fürsorge zur Volkspflege beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Arbeitsbedingungen und dem beruflichen Werdegang der Frauen, sowie auf der NSV. Weiterhin werden die Auswirkungen der nationalsozialistischen Familienpolitik auf die Erziehung von Kindern und die Rollenverteilung in der Familie analysiert.
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit vom Fürsorgesystem zur Volkspflege im Nationalsozialismus
- Die Rolle der Volkspflegerinnen und ihre Arbeitsbedingungen im NS-Regime
- Die Bedeutung der Familie im Nationalsozialismus, insbesondere im Kontext von Erziehung und Rollenverteilung
- Die Einflüsse der NSV auf die Familienpolitik und die Soziale Arbeit
- Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Ideologie auf die Familienstruktur und die Rolle der Frau in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die historische und politische Situation im Nationalsozialismus dar und führt in die Thematik der Hausarbeit ein. Sie skizziert die Problematik der Sozialen Arbeit im Kontext des nationalsozialistischen Regimes und die Veränderungen, die sich in der Familienpolitik vollzogen haben. Des Weiteren wird die Fragestellung der Hausarbeit formuliert und die Gliederung der Arbeit erläutert.
Geschichte und Entwicklung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus
Dieses Kapitel behandelt die Entstehung der Volkspflege im Nationalsozialismus. Zunächst wird der Fürsorgerinnenberuf im Kontext der Weimarer Republik betrachtet, um die Vorgeschichte und die Bedingungen zu verstehen, aus denen die Volkspflege hervorging. Anschließend wird die Entwicklung von der Fürsorge zur Volkspflege unter dem Einfluss des Nationalsozialismus beleuchtet. Des Weiteren werden die Berufsbedingungen und der berufliche Werdegang der Frauen in diesem Bereich dargestellt. Schließlich wird die NSV vorgestellt und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus beleuchtet.
Die Familie im Nationalsozialismus
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Familie im Nationalsozialismus beleuchtet, wobei der Fokus auf der Erziehung von Kindern und der Rollenverteilung in der Familie liegt. Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Familienpolitik auf die Familienstruktur und die Rolle der Frau in der Gesellschaft werden analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Sozialen Arbeit, der Volkspflege, der Familie, dem Nationalsozialismus, der NSV, der Fürsorge, der Erziehung und der Frauenrolle im NS-Regime. Weitere wichtige Begriffe sind: Fürsorgerinnenberuf, Arbeitsmarkt, Berufsbedingungen, Familienpolitik, Rollenverteilung, NS-Ideologie, Minderwertigkeit, Volksgemeinschaft, Volkskörper, Erziehungsziele, und ideologische Steuerung. Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus und den Auswirkungen der NS-Ideologie auf die Familie und die Rolle der Frau.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Unterschied zwischen Fürsorge und Volkspflege im Nationalsozialismus?
Während die Fürsorge in der Weimarer Republik auf individueller Hilfe basierte, diente die Volkspflege im NS-Staat der ideologischen Steuerung der „Volksgemeinschaft“ und der Auslese nach rassistischen Kriterien.
Welche Aufgaben hatte eine Volkspflegerin?
Volkspflegerinnen arbeiteten meist für die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). Ihre Aufgabe war die Überwachung und Erziehung von Familien im Sinne der NS-Ideologie sowie die Selektion von Hilfsbedürftigen.
Welche Bedeutung hatte die Familie für das NS-Regime?
Die Familie galt als „Keimzelle der Nation“ und diente primär der biologischen Reproduktion des „Volkskörpers“ sowie der frühen ideologischen Erziehung der Kinder.
Wie veränderte sich die Rolle der Frau in dieser Zeit?
Frauen wurden primär in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau gesehen. Berufe im Bereich der Volkspflege wurden als „weibliche“ Dienstleistung an der Volksgemeinschaft umgedeutet.
Was war die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)?
Die NSV war die zentrale Organisation für soziale Arbeit im Dritten Reich, die alle freien Wohlfahrtsverbände gleichschaltete und Hilfe nur an „erbgesunde“ und „rassisch wertvolle“ Bürger leistete.
- Quote paper
- Jennifer Nubukpo (Author), 2019, Was war die Rolle und Funktion der Volkspflegerin und welche Bedeutung hatte die Familie im Nationalsozialismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535830