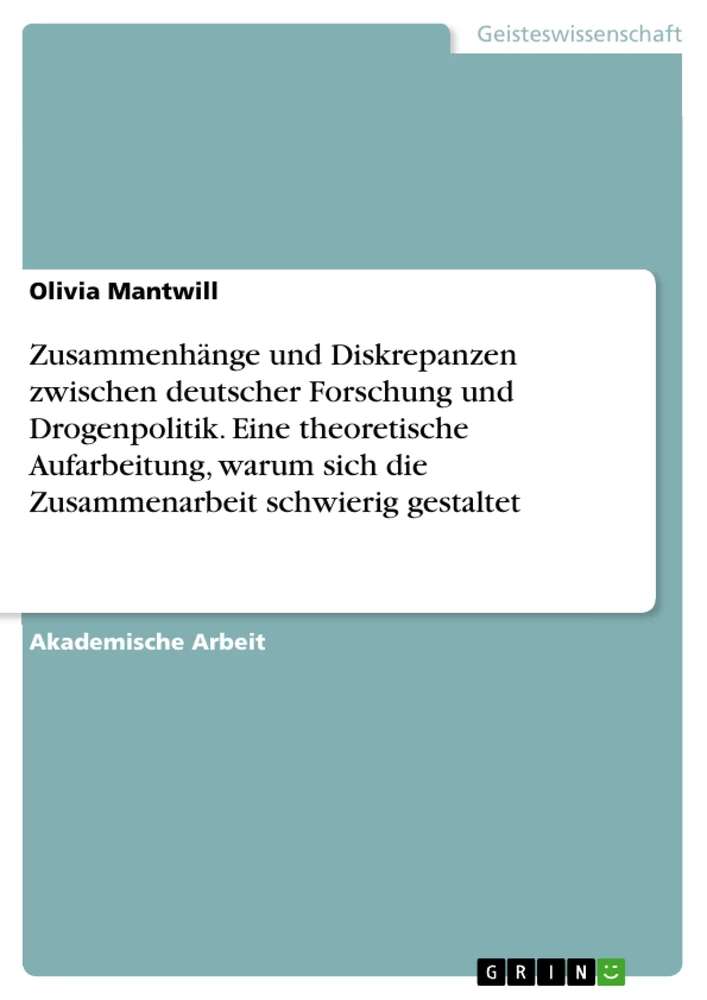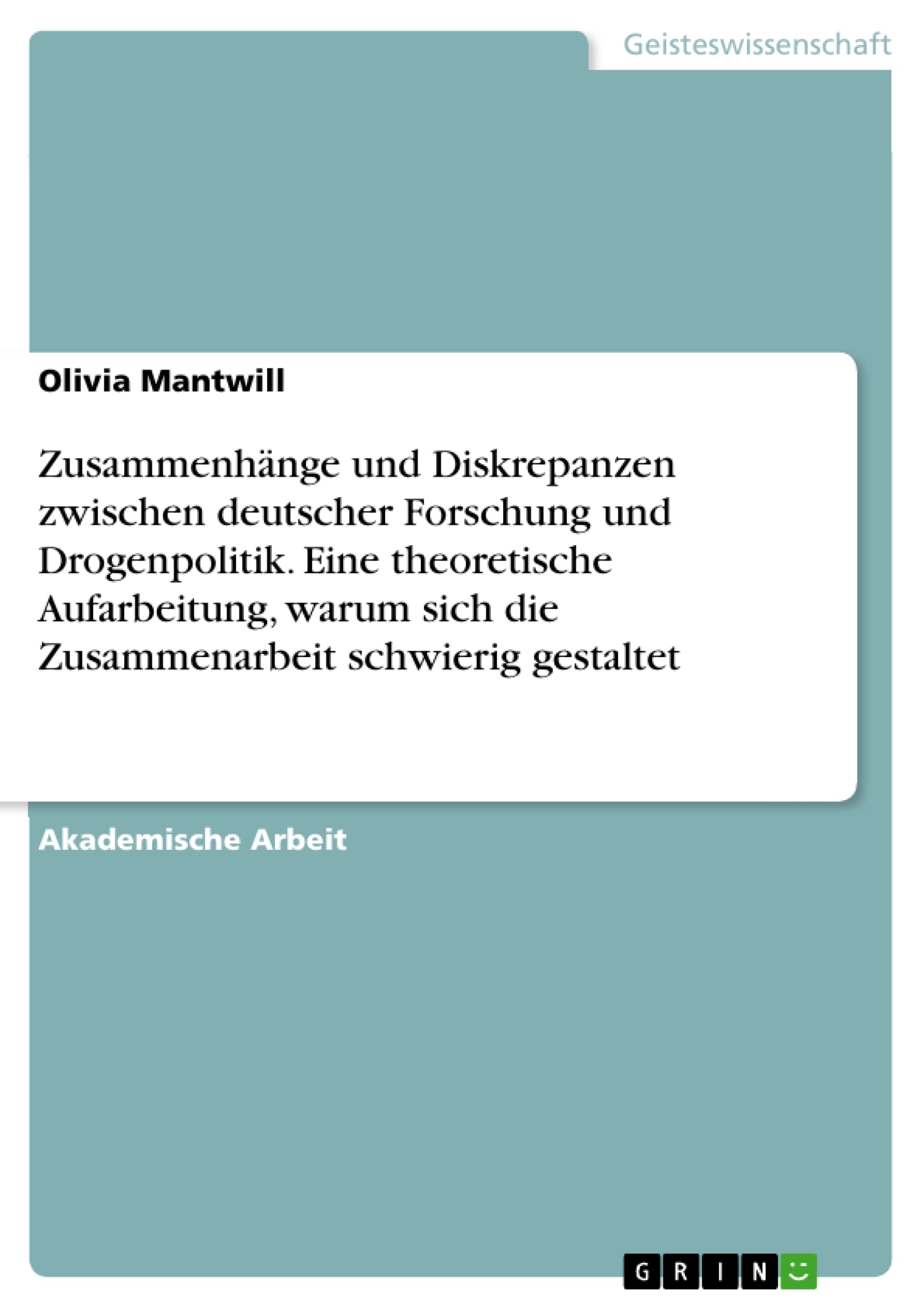Wie sind die Zusammenhänge und Diskrepanzen zwischen deutscher Forschung und Drogenpolitik, warum haben die beiden sich über die Jahre hinweg nicht weiterentwickelt, vor allem nicht gemeinsam, und was kann zur Lösung des Problems beitragen?
Zur Beantwortung dieser Frage wird in der vorliegenden Arbeit zuerst der Status quo bezüglich der Drogenpolitik und ihrer gesellschaftlichen Zusammenhänge betrachtet. Anschließend wird die Perspektive der aktuellen Drogenpolitik behandelt, aufbauend auf der Entwicklungsgeschichte, der Organisationsstruktur und Vergleichen zu anderen Ländern, und diese Thematik unter den Gesichtspunkten von Webers und Kuhns Theorien beleuchtet. Dann wird der Stand der Wissenschaft selbst thematisiert, anhand einer Analyse der vorhandenen Literatur und der Aufarbeitung weiterer Kritikpunkte von Kuhn und Beck. Zuletzt werden noch kurz Mertons Normen und Böhmes Finalisierungsthese angeschnitten, um einen Ausblick auf weitere Ansätze zu schaffen, und ein Fazit gezogen, das auf Politisierung der Wissenschaft hinausläuft. Im Anschluss soll eine fundierte Diskussion über Hintergründe, Ziel und Umsetzung einer wissenschaftsbasierten Drogenpolitik möglich sein.
Ein Wandel zeigt sich in den letzten Jahren immer deutlicher, angefangen bei der zunehmenden Diskussion über Marihuana und dessen Legalisierung. Erste fatale Kurzschlussentscheidungen vor den Wahlen wurden bereits getroffen, wie beispielsweise die Zulassung von Marihuana als Medikament (BMG 2017). Des Weiteren wird ein gefühlter internationaler Druck ausgeübt, indem Länder wie Portugal beispielsweise alle Drogen legalisieren, die Schweiz ein neues Gesundheitssystem diesbezüglich etabliert und verschiedene Staaten der USA diverse Konzepte der sogenannten "Harm reduction", also akzeptierender Drogenarbeit, ausprobieren. Deutschland steht währenddessen still – die Politik ebenso wie die Wissenschaft, die sich jahrelang zurückgezogen und abgegrenzt von jeglichen anderen Disziplinen nur geringfügig zu dieser Thematik geforscht hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Drogen als gesellschaftliches Problem - Drogen als Ursache?
- Drogenpolitik im Fokus
- Konflikt als Lösungsansatz
- Alternative Wege
- Wissenschaft als Chance
- Prämissen der Wissenschaft
- Notwendigkeit der Politisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Spannungsverhältnisse zwischen deutscher Drogenpolitik und wissenschaftlicher Forschung. Sie analysiert die Gründe für die schwierige Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Bereichen und die Herausforderungen, die sich daraus für eine effektive und gesellschaftlich sinnvolle Drogenpolitik ergeben.
- Die historische Entwicklung und der aktuelle Status Quo der deutschen Drogenpolitik
- Die Rolle und die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung im Kontext der Drogenpolitik
- Die Bedeutung der Politisierung der Wissenschaft für eine effektive Drogenpolitik
- Die Analyse der Konflikttheorien von Weber und Kuhn im Hinblick auf die Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft
- Die Entwicklung von Perspektiven für eine zukünftige, wissenschaftlich fundierte Drogenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Problematik der deutschen Drogenpolitik und stellt die zentrale Frage nach den Zusammenhängen und Diskrepanzen zwischen Forschung und Politik in diesem Bereich. Es wird deutlich, dass die aktuelle Drogenpolitik mit ihren restriktiven Ansätzen nicht nur ökonomische Kosten verursacht, sondern auch soziale Probleme verschärft. Die Arbeit untersucht die Gründe für diesen Zustand und die Möglichkeiten einer wissenschaftsbasierten Lösung.
- Drogen als gesellschaftliches Problem - Drogen als Ursache?: Dieses Kapitel analysiert den Drogenkonsum als gesellschaftliches Problem und hinterfragt die übliche Zuschreibung von Drogen als Ursache für soziale Konflikte. Es wird argumentiert, dass die Betrachtung des Drogenkonsums aus einer soziologischen Perspektive notwendig ist, um eine differenzierte und effektive Drogenpolitik zu entwickeln.
- Drogenpolitik im Fokus: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle deutsche Drogenpolitik unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung, ihrer Organisationsstruktur und ihrer Vergleichbarkeit mit anderen Ländern. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Konfliktmanagement und alternative Wege diskutiert.
- Wissenschaft als Chance: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der Wissenschaft im Kontext der Drogenpolitik. Es werden die Prämissen der Wissenschaft und die Notwendigkeit ihrer Politisierung im Hinblick auf die Herausforderungen der Drogenproblematik analysiert. Die Analyse der Theorien von Weber und Kuhn bietet wichtige Einblicke in die Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft und ihre Auswirkungen auf die Drogenpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Drogenpolitik, Wissenschaft, Politisierung, Konflikt, Soziologie, Gesellschaft, Drogenkonsum, Sucht, Harm Reduction, Deutschland, internationale Vergleiche, Weber, Kuhn, Merten, Böhme.
- Citar trabajo
- Olivia Mantwill (Autor), 2020, Zusammenhänge und Diskrepanzen zwischen deutscher Forschung und Drogenpolitik. Eine theoretische Aufarbeitung, warum sich die Zusammenarbeit schwierig gestaltet, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536218