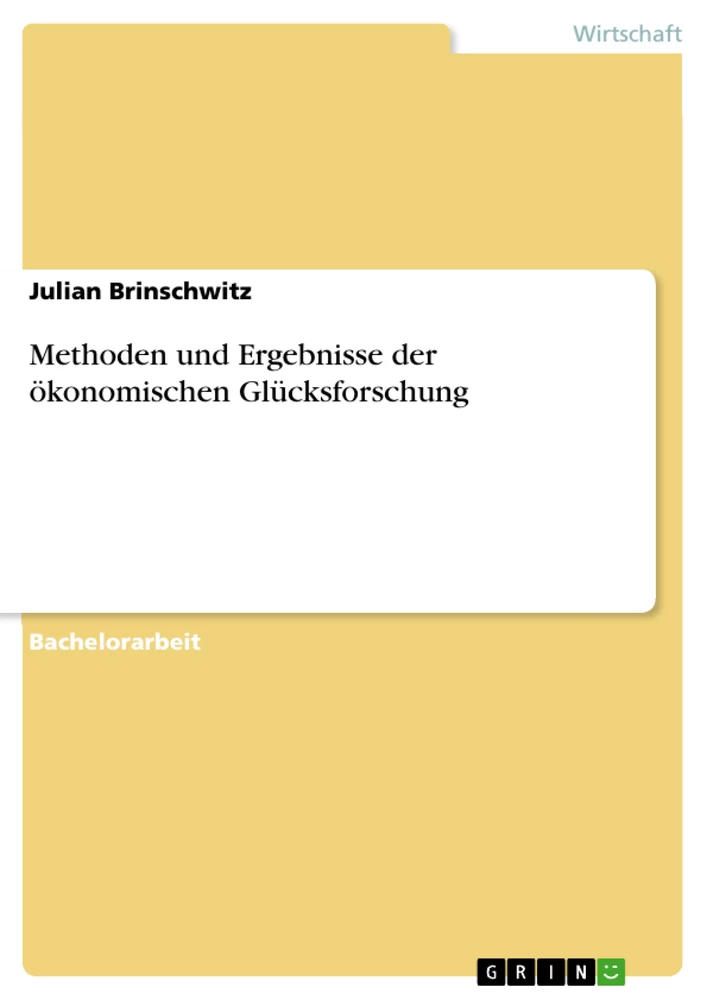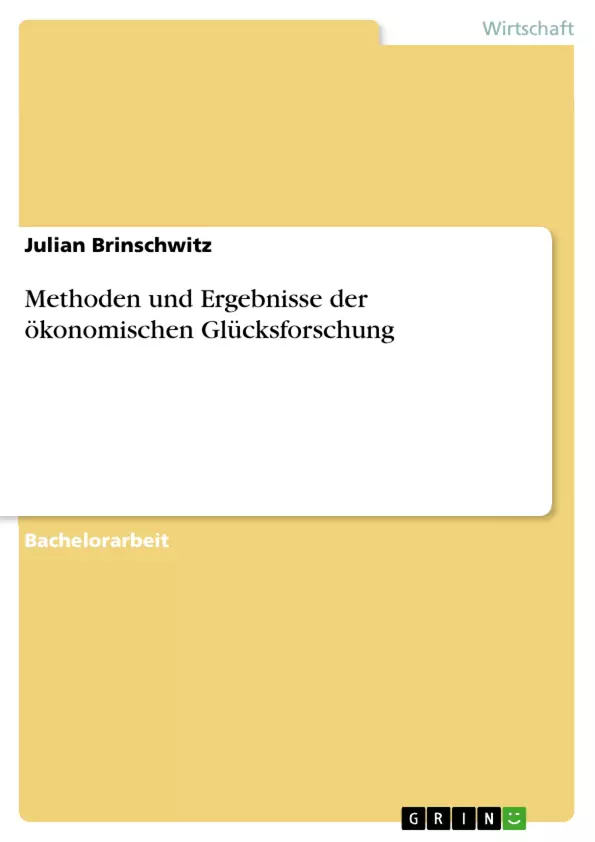Schon seit der Antike befassen sich Philosophen mit der Erreichung und Vollendung des Glücks. Die Bekanntesten unter ihnen waren Aristoteles und Platon. Sie erkannten, dass das Glück „das höchste Gut“ des Menschen ist und eine „Sehnsucht, die nicht altert“.
Am 4. Juli 1776 unterzeichneten die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika die Unabhängigkeitserklärung. Ein wichtiger Artikel der Erklärung ist das Streben nach Glück (the pursuit of happiness), welches ein unveräußerliches Recht ist, das unter anderem besagt, dass man gleichberechtigt vor dem Gesetzt ist. Hierbei ist zu erkennen, dass das Glück sich seit je her einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft aufweist.
Die Ökonomie befasste sich erst relativ spät mit dem Glücksbegriff und dessen Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum.Als Folge daraus wendete er sich bereits 1972 von den herkömmlichen Wohlstandsindikatoren eines Landes ab und führte als oberstes Ziel der Nation das Bruttonationalglück ein. Fraglich ist, ob eine Ausrichtung der westlichen Industrienationen am Beispiel Bhutans förderlich ist und ob sich das politische Interesse an einem gewählten Glücksindex orientieren sollte.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in den Methoden der ökonomischen Glücksforschung und deren zentralen Ergebnissen mit Fokus auf den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück. Wesentliche Fragen sind dabei; Sind reiche Menschen glücklicher als arme Menschen? Macht Geld glücklich? Um diese Problematik zu klären, bedarf es zu nächst einer Auseinandersetzung mit den Grundbegriffen „Glück“ und „Hedonismus“, welche im nächsten Kapitel definiert werden. Im selbigen Kapitel werden die Hauptdisziplinen der Glücksforschung und deren Besonderheiten erläutert. Anschließend werden ausführlich die einzelnen Messmethoden der Glücksforschung und deren Problematiken vorgestellt. Im Anschluss folgen ausgewählte Ergebnisse der ökonomischen Glücksforschung, die den Zusammenhang zwischen Einkommen und subjektiven Wohlbefinden verdeutlichen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Easterlin Paradox und dessen aktueller Akzeptanz in der Wissenschaft. Anhand der auftretenden Effekte wie Tretmühlen des Glücks wird die Korrelation zwischen Glück und Einkommen erklärt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem politischen Ausblick ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung
- 2.1. Definition des Begriffs Glück
- 2.2. Erklärung des Hedonismus
- 3. Methoden der ökonomischen Glücksforschung
- 4. Ergebnisse der ökonomischen Glücksforschung insbesondere den Zusammenhang Einkommen und Glück
- 4.1. Das Easterlin-Paradox
- 4.1.1. Beschreibung
- 4.1.2. Aktuelle Meinung zu Easterlins Thesen
- 4.2. Tretmühlen des Glückes
- 4.2.1. Statustretmühle
- 4.2.2. Gewöhnungseffekt
- 4.3. Glückindizes als Alternative zu herkömmlichen Wohlstandsindikatoren
- 4.1. Das Easterlin-Paradox
- 5. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Methoden der ökonomischen Glücksforschung und deren zentrale Ergebnisse, insbesondere den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück. Sie beleuchtet die Frage, ob reicher Menschen glücklicher sind und ob Geld tatsächlich zum Glück beiträgt.
- Definition des Glücksbegriffs und des Hedonismus
- Methoden der ökonomischen Glücksforschung (Umfragen, Brain Imaging etc.)
- Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück, inklusive des Easterlin-Paradoxons
- Der Einfluss von Gewöhnungseffekten und Statuswettbewerb auf das Glücksempfinden
- Glückindizes als alternative Wohlstandsindikatoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die lange Beschäftigung der Philosophie mit dem Glück, beginnend mit Aristoteles und Platon, und verweist auf die „Verfolgung des Glücks“ in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Sie führt den relativ späten Einstieg der Ökonomie in die Glücksforschung an, wobei Bhutan als Vorreiter mit seinem Bruttonationalglück genannt wird. Die Arbeit fokussiert auf die Methoden der ökonomischen Glücksforschung und deren Ergebnisse bezüglich des Zusammenhangs von Einkommen und Glück, wobei die Fragen nach dem Glück von Reichen im Vergleich zu Armen und dem Einfluss von Geld auf das Glück im Mittelpunkt stehen. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit, beginnend mit Definitionen grundlegender Begriffe und der Beschreibung der Methoden, gefolgt von der Darstellung zentraler Forschungsergebnisse und dem Easterlin-Paradoxon, sowie abschließend einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
2. Begriffserklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Glück“ und seiner unterschiedlichen Verwendung in wissenschaftlichen und alltäglichen Kontexten. Es werden verschiedene Perspektiven auf Glück präsentiert, von Aristoteles' Definition als höchstes Gut bis hin zu Layards vereinfachter Erklärung als positives Gefühl. Ruckriegels Unterscheidung zwischen emotionalem und kognitivem Wohlbefinden wird erläutert, ebenso wie Freys skeptische Position hinsichtlich einer eindeutigen Definition. Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung zeigt die vielfältigen Aspekte, die die Bevölkerung mit Glück verbindet, wobei Gesundheit, Familie und Freude an kleinen Dingen im Vordergrund stehen. Abschließend wird eine Arbeitsdefinition von Glück als die Gesamtheit extrinsischer und intrinsischer Einflüsse auf das individuelle Wohlbefinden vorgestellt.
3. Methoden der ökonomischen Glücksforschung: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Textfragment fehlt) würde die verschiedenen Methoden der ökonomischen Glücksforschung detailliert beschreiben und analysieren. Dies würde wahrscheinlich repräsentative Umfragen, die Experience Sampling Methode, die Day Reconstruction Methode, Brain Imaging und weitere Verfahren umfassen. Es würde sich zudem mit den Herausforderungen und Verzerrungen bei der Messung von Glück befassen und die Vergleichbarkeit von Daten aus verschiedenen Ländern untersuchen.
4. Ergebnisse der ökonomischen Glücksforschung insbesondere den Zusammenhang Einkommen und Glück: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Textfragment nur teilweise enthalten ist) würde die empirischen Ergebnisse der ökonomischen Glücksforschung präsentieren, mit besonderem Fokus auf den Zusammenhang zwischen Einkommen und subjektivem Wohlbefinden. Es würde sich intensiv mit dem Easterlin-Paradoxon auseinandersetzen, das die überraschende Beobachtung beschreibt, dass die Steigerung des Einkommens in reichen Ländern nicht zwangsläufig zu größerem Glück führt. Weitere analysierte Themen wären wahrscheinlich die „Tretmühlen des Glücks“, wie der Statustretmühle und der Gewöhnungseffekt, die erklären, warum höhere Einkommen nicht immer zu dauerhaftem Glück führen. Das Kapitel würde auch alternative Wohlstandsindikatoren neben dem Bruttoinlandsprodukt diskutieren.
Schlüsselwörter
Glück, Hedonismus, ökonomische Glücksforschung, Einkommen, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, Easterlin-Paradoxon, Tretmühlen des Glücks, Glückindizes, subjektives Wohlbefinden, methodische Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur ökonomischen Glücksforschung
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit zur ökonomischen Glücksforschung. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück, insbesondere dem Easterlin-Paradoxon und den „Tretmühlen des Glücks“.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Methoden der ökonomischen Glücksforschung, die Definition von Glück und Hedonismus, den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück (inkl. Easterlin-Paradoxon), den Einfluss von Gewöhnungseffekten und Statuswettbewerb auf das Glück, sowie Glückindizes als alternative Wohlstandsindikatoren.
Was ist das Easterlin-Paradoxon?
Das Easterlin-Paradoxon beschreibt die Beobachtung, dass in wohlhabenden Ländern eine Steigerung des Einkommens nicht zwangsläufig zu größerem Glück führt. Die Arbeit analysiert dieses Paradoxon detailliert.
Was sind die „Tretmühlen des Glücks“?
Die „Tretmühlen des Glücks“ bezeichnen Faktoren, die verhindern, dass höhere Einkommen zu dauerhaftem Glück führen. Dazu gehören beispielsweise die Statustretmühle (ständiger Vergleich mit anderen) und der Gewöhnungseffekt (Anpassung an ein höheres Einkommensniveau).
Welche Methoden werden in der ökonomischen Glücksforschung verwendet?
Der Text erwähnt verschiedene Methoden, die in der ökonomischen Glücksforschung eingesetzt werden, darunter repräsentative Umfragen, die Experience Sampling Methode, die Day Reconstruction Methode und Brain Imaging. Eine detaillierte Beschreibung dieser Methoden findet sich im (im Auszug fehlenden) Kapitel 3.
Wie wird Glück in der Arbeit definiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen von Glück, von philosophischen Ansätzen (Aristoteles) bis hin zu ökonomischen Perspektiven. Es wird eine Arbeitsdefinition von Glück als Gesamtheit extrinsischer und intrinsischer Einflüsse auf das individuelle Wohlbefinden vorgestellt.
Welche Rolle spielen Glückindizes?
Die Arbeit betrachtet Glückindizes als alternative Wohlstandsindikatoren zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), um ein umfassenderes Bild des Wohlbefindens einer Gesellschaft zu erhalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Glück, Hedonismus, ökonomische Glücksforschung, Einkommen, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, Easterlin-Paradoxon, Tretmühlen des Glücks, Glückindizes, subjektives Wohlbefinden, methodische Herausforderungen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der Text enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Argumentationslinien der jeweiligen Kapitel skizzieren.
- Citar trabajo
- Julian Brinschwitz (Autor), 2019, Methoden und Ergebnisse der ökonomischen Glücksforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536280