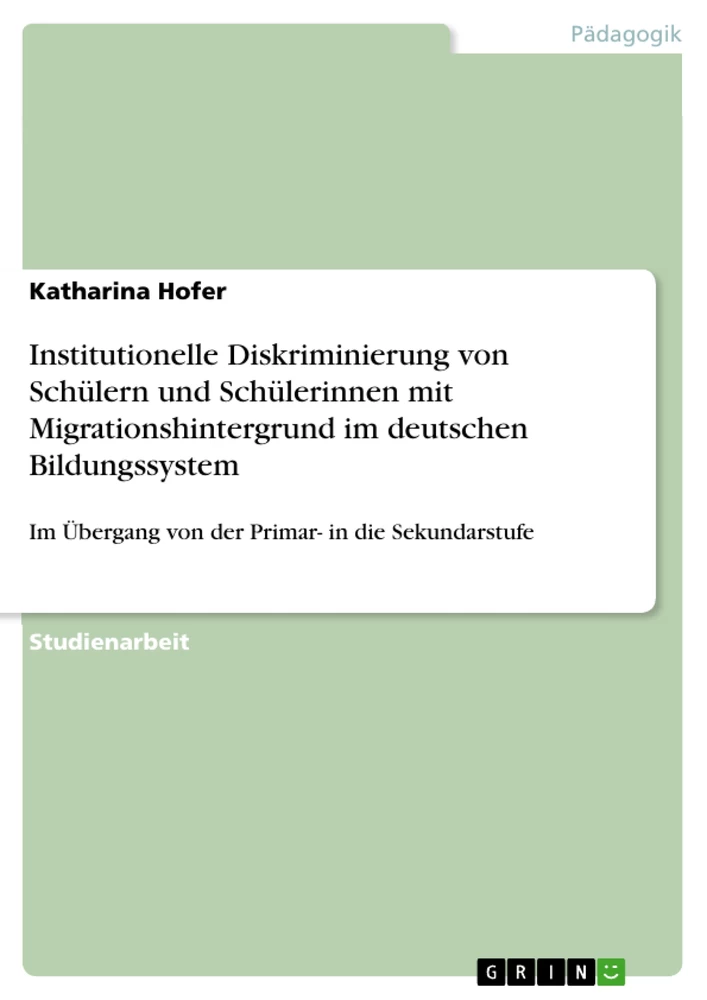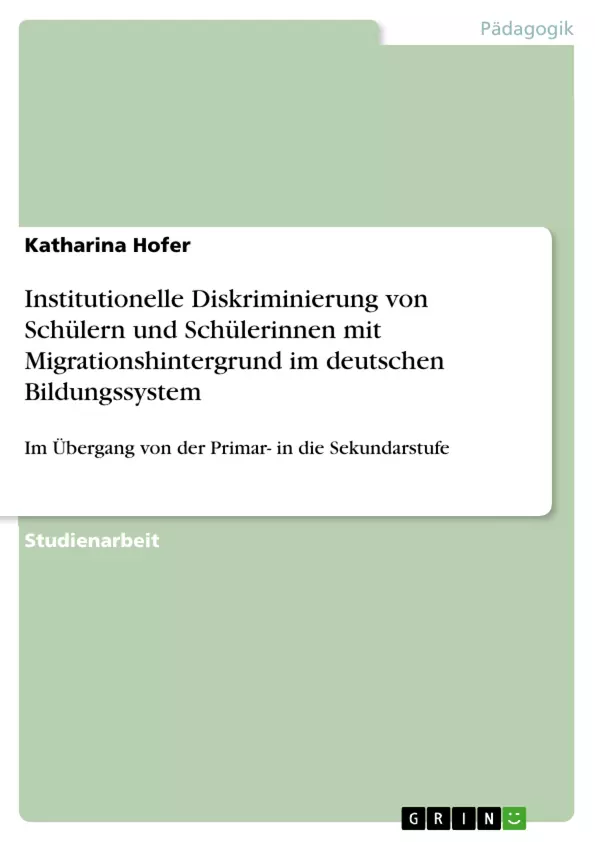Seit 2000 werden die internationalen und nationalen PISA-Studien von der OECD zur Ermittlung der Kompetenzen Fünfzehnjähriger in den zentralen Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften durchgeführt. Durch die Ergebnisse der PISA-Studien sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu einem zentralen Thema der bildungspolitischen Debatte geworden. Bis heute gilt weiterhin: „Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besuchen seltener eine Kita und sind an Hauptschulen über- und an Gymnasien unterpräsentiert.“ Verschiedene Schulleistungsuntersuchungen der letzten Jahre zeigen außerdem, dass die Leistungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund weiterhin deutlich hinter denen von Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund liegen. Gleiches lässt sich in der beruflichen Bildung und im Studium beobachten. Der Bundesdurchschnitt zeigt, dass 33,6 Prozent der Kinder an Grundschulen einen Migrationshintergrund haben.
Hier gilt zu erwähnen, dass der Anteil zwischen den Bundesländern stark variiert. Sprachliche und kulturelle Vielfalt in Deutschland sind demzufolge als fester Bestandteil der Gesellschaft anzunehmen. Diese offensichtlichen Leistungsunterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und denen ohne Migrationshintergrund lassen sich unter anderem durch ungleiche Bildungschancen, vielmehr durch eine Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erklären.
In der folgenden Arbeit soll vor Allem die Begriffskombination der „Institutionellen Diskriminierung“ im deutschen Bildungssystem, in besonderer Beachtung des Übergangs von Primar- in die Sekundarstufe, untersucht werden. Unter welcher institutionellen Benachteiligung und/oder Diskriminierung leiden Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, insbesondere beim Übergang von Primar- in die Sekundarstufe?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Institutionelle Diskriminierung.
- Begriffsabgrenzung: Institutioneller Rassismus.
- Begriffserklärung: Institutionelle Diskriminierung.
- Direkte und indirekte institutionelle Diskriminierung
- Institutionelle Diskriminierung in der Schule – Bildungsbenachteiligung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund
- Struktureller Aufbau des deutschen Schulsystems – „Übergänge“
- Entscheidungsstelle: Übergang von Primar- in die Sekundarstufe
- Chancenungleichheit durch Selektion
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der „Institutionellen Diskriminierung“ im deutschen Bildungssystem, insbesondere im Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe, zu untersuchen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, unter welcher institutionellen Benachteiligung und/oder Diskriminierung Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund leiden, insbesondere in diesem Übergangsbereich.
- Begriffsabgrenzung von „Institutioneller Diskriminierung“ und „Institutionellem Rassismus“
- Entstehung und Definition von „Institutioneller Diskriminierung“
- Analyse von „Direkter“ und „Indirekter Diskriminierung“
- Strukturelle Merkmale des deutschen Schulsystems und der „Übergänge“
- Institutionelle Diskriminierung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund im Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bildungsbenachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem ein und beleuchtet die Ergebnisse der PISA-Studien sowie die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Die Arbeit fokussiert auf die „Institutionelle Diskriminierung“ und deren Relevanz im Kontext des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe.
Das Kapitel „Institutionelle Diskriminierung“ befasst sich zunächst mit der Entstehung des Begriffs „Institutioneller Rassismus“ und setzt diesen in Relation zur „Institutionellen Diskriminierung“. Es werden die Entstehung, die Definition und die verschiedenen Formen der „Institutionellen Diskriminierung“ erläutert.
Im Kapitel „Institutionelle Diskriminierung in der Schule – Bildungsbenachteiligung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund“ wird der strukturelle Aufbau des deutschen Schulsystems und der „Übergänge“ im Bildungssystem beleuchtet. Im Fokus steht die Entscheidungsstelle des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe und die damit verbundene Chancenungleichheit durch Selektion. Hier wird die institutionelle Diskriminierung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe genauer untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der „Institutionellen Diskriminierung“ und „Institutionellem Rassismus“, die im Kontext der Bildungsbenachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem, insbesondere im Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe, relevant sind. Weitere wichtige Aspekte sind der strukturelle Aufbau des Bildungssystems, die Entscheidungsstelle des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe und die Chancenungleichheit durch Selektion.
- Quote paper
- Katharina Hofer (Author), 2020, Institutionelle Diskriminierung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536688