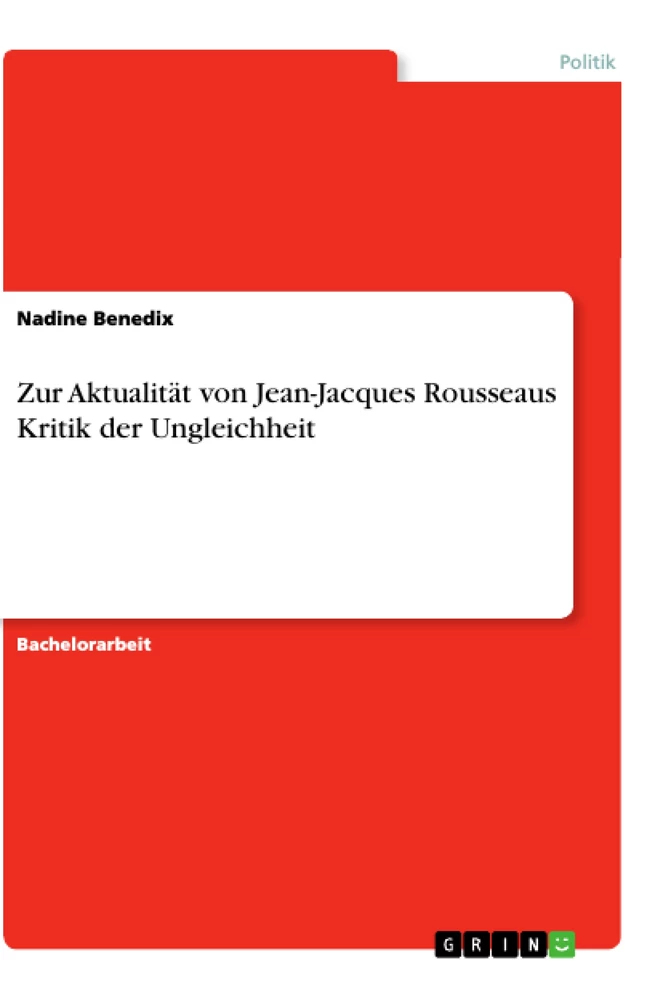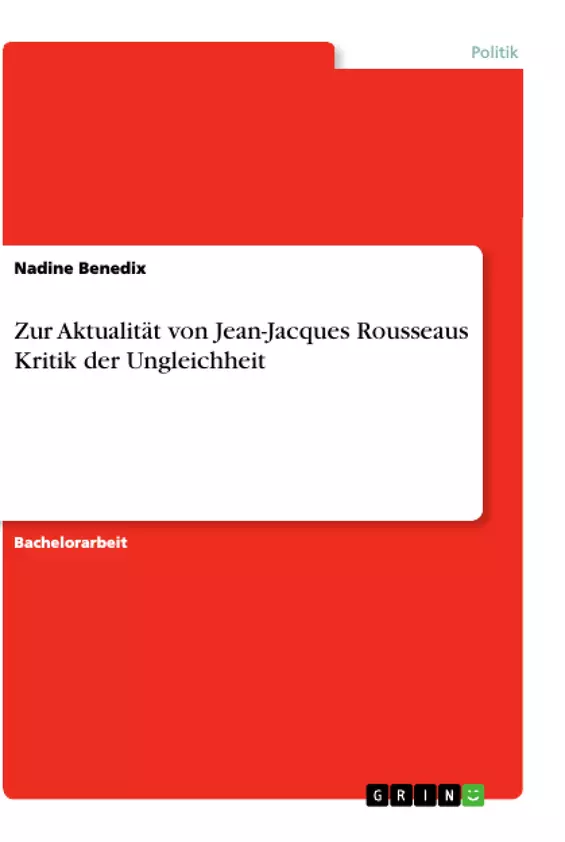Die vorliegende Bachelorarbeit stellt die Kritik Rousseaus zur Entstehung und den Folgen ökonomischer Ungleichheit dar, um sie anschließend mit zeitgenössischen Studien und Kritiken ökonomischer Ungleichheit zu vergleichen. Durch einen solchen Vergleich wird geprüft, inwiefern Rousseaus Thesen zur ökonomischen und politischen Ungleichheit auch im 21. Jahrhundert noch über Relevanz verfügen.
In seinem Werk "Das Kapital im 21. Jahrhundert" zeichnet Piketty 2014 exakte Dynamiken von Kapitalakkumulation im 20. und 21. Jahrhundert nach und kommt schließlich zu dem Schluss, dass eine Besteuerung des Kapitals nötig sei, um die wachsende ökonomische Ungleichheit einzudämmen. Warum aber ist es nötig den steigenden Anteil einiger weniger Vermögen am Gesamtkapital einer Volkswirtschaft zu beschränken? Im Werk des französischen Philosophen und Aufklärers Jean-Jacques Rousseau findet sich eine mögliche, sehr frühe Antwort auf diese Frage. Große Unterschiede der Reichtumsverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft wirken sich negativ auf den Zusammenhalt dieser aus und bewirken im Umkehrschluss ein politisches Ungleichgewicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ökonomische Ungleichheit - Ein Phänomen in Demokratien des 21. Jahrhunderts?
- Extreme Ungleichheit in den Vereinigten Staaten
- Wachsende Ungleichheit in Europa
- Weshalb die Ungleichheit in Industriestaaten steigt: Einblicke in Kapitalstrukturen des 21. Jahrhundert
- Das politisches Denken Jean Jacques Rousseaus und seine Kritik der Ungleichheit
- Rousseaus politische Philosophie und die moderne Demokratie
- Rousseaus Kritik der Ungleichheit
- Amour propre als Quelle der Ungleichheit
- Unter welchen Umständen führt die amour propre zu Ungleichheit?
- Voraussetzungen für politische Gleichheit innerhalb einer Gesellschaft
- Beschränkung der politischen Gleichheit durch ökonomische Ungleichheit
- Rolle des Mitleids
- Auswirkungen ökonomischer Ungleichheit im 21. Jahrhundert
- Eingeschränkte Freiheit in westlichen Demokratien?
- Politische Entscheidungen entsprechen nicht dem Mehrheitswillen
- Politische Ohnmacht der weniger Wohlhabenden
- „Frustrierte“ Gesellschaften durch ökonomische Ungleichheit
- Verlust von Vertrauen
- „Austritt aus dem Gesellschaftsvertrag“ als Konsequenz?
- Mangelnde Partizipation weniger wohlhabender Bevölkerungsgruppen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Aktualität von Rousseaus Kritik der Ungleichheit. Ziel ist es, die Kritik Rousseaus zur Entstehung und zu den Folgen ökonomischer Ungleichheit darzustellen und sie anschließend mit zeitgenössischen Studien und Kritiken ökonomischer Ungleichheit zu vergleichen. Durch einen solchen Vergleich soll geprüft werden, inwiefern Rousseaus Thesen zur ökonomischen und politischen Ungleichheit auch in Demokratien des 21. Jahrhunderts noch relevant sind.
- Rousseaus Kritik der Ungleichheit
- Die Rolle der amour propre als Quelle der Ungleichheit
- Die Auswirkungen ökonomischer Ungleichheit auf politische Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt
- Der Vergleich von Rousseaus Thesen mit aktuellen Studien und Beobachtungen zu wachsender ökonomischer Ungleichheit
- Die Relevanz von Rousseaus Kritik für das Verständnis politischer Prozesse in modernen Demokratien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung des Problems wachsender ökonomischer Ungleichheit in OECD-Staaten. Basierend auf Daten von Piketty und dem US Census Bureau wird die Entwicklung der Vermögens- und Einkommensverteilung in den letzten Jahrzehnten beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich der politischen Philosophie von Jean-Jacques Rousseau und seiner Kritik der Ungleichheit. Dabei wird insbesondere die Rolle der amour propre als Quelle der Ungleichheit und die Auswirkungen von ökonomischer Ungleichheit auf die politische Freiheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrachtet.
Das dritte Kapitel stellt die Kritik Rousseaus der Ungleichheit aktuellen Studien und Beobachtungen gegenüber. Studien von Bartels und Gilens belegen, dass der weniger wohlhabende Teil der Bevölkerung keinen Einfluss auf politische Vertreter hat. Darüber hinaus wird untersucht, wie ökonomische Ungleichheit zu einem Gefühl des Unwohlseins in einer Gesellschaft führen kann und welche Auswirkungen dies auf das Vertrauen in das politische System hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen ökonomische Ungleichheit, politische Gleichheit, Rousseau, Amour propre, politische Philosophie, moderne Demokratie, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Vertrauen, Partizipation, Wohlbefinden, OECD-Staaten, Piketty, Bartels, Gilens, Pickett und Wilkinson.
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern ist Rousseaus Kritik der Ungleichheit heute noch aktuell?
Rousseaus Thesen erklären, wie ökonomische Unterschiede den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen und zu politischer Ohnmacht führen – Phänomene, die auch im 21. Jahrhundert beobachtet werden.
Was versteht Rousseau unter „Amour propre“?
Die Amour propre ist die Eigenliebe oder Eitelkeit, die im Vergleich mit anderen entsteht und laut Rousseau eine zentrale Quelle gesellschaftlicher Ungleichheit ist.
Welchen Zusammenhang sieht die Arbeit zwischen Reichtum und politischer Freiheit?
Große ökonomische Ungleichheit beschränkt die politische Gleichheit, da finanzstarke Gruppen mehr Einfluss auf politische Entscheidungen haben als der Durchschnittsbürger.
Welche modernen Autoren werden zum Vergleich herangezogen?
Die Arbeit nutzt Studien von Thomas Piketty („Das Kapital im 21. Jahrhundert“) sowie Untersuchungen von Bartels, Gilens, Pickett und Wilkinson.
Was bedeutet der „Austritt aus dem Gesellschaftsvertrag“ als Konsequenz?
Damit ist die mangelnde politische Partizipation und der Vertrauensverlust weniger wohlhabender Bevölkerungsgruppen in das demokratische System gemeint.
- Citation du texte
- Nadine Benedix (Auteur), 2017, Zur Aktualität von Jean-Jacques Rousseaus Kritik der Ungleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536738