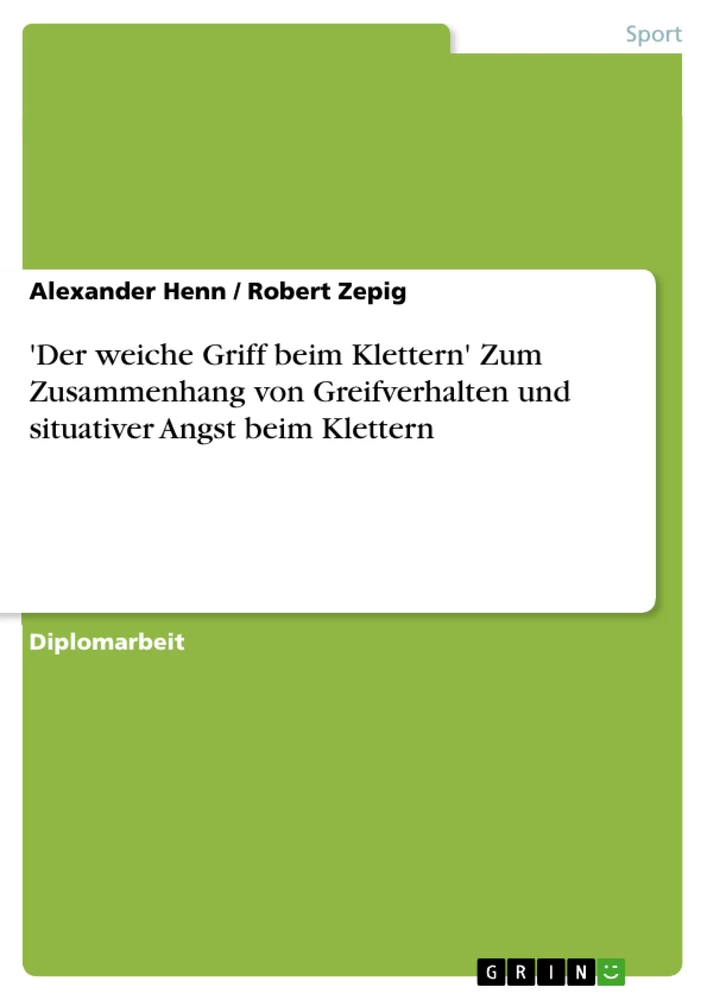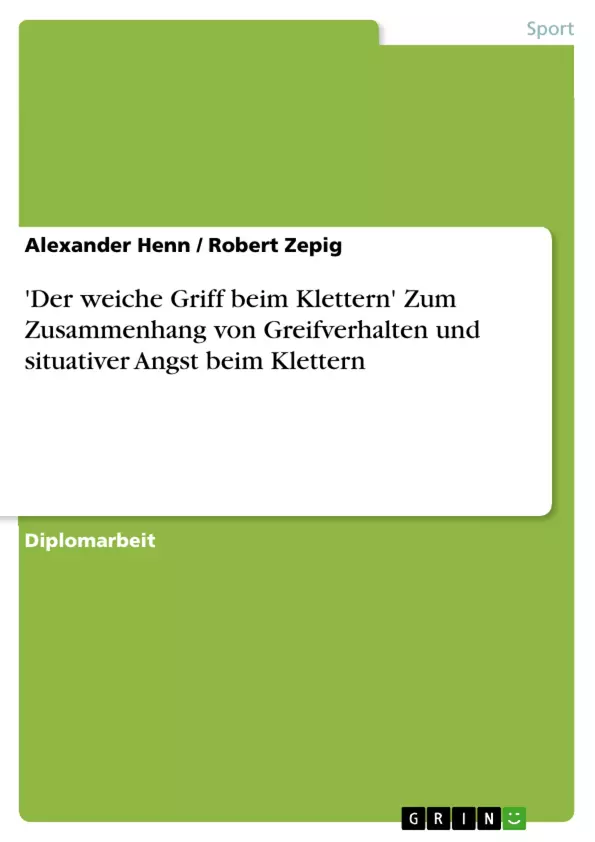„Nicht jeder eignet sich zum Klettern; ein paar kräftige Beine und eine gesunde Lunge reichen noch lang nicht aus, (…), weil (…) der gediegene Kletterer eine strenge, nicht immer angenehme Schule durchmachen muss bis er es zum selbstständigen Felsmann „ohne Furcht und Tadel“ bringt.“(Nieberl, 1911)
Klettern ist, im Vergleich zu den klassischen Sportarten wie Leichtathletik, Fußball oder Schwimmen, eine von der Sportwissenschaft relativ selten betrachtete Sportart. Diese Arbeit stellt einen Schritt zur wissenschaftlichen Betrachtung des Sportkletterns dar. Mit Hilfe dieser Arbeit soll ein Effekt, der derzeit im Sportklettern als gegebene Tatsache präsent ist, wissenschaftlich gemessen, ausgewertet und beurteilt werden. Dieser Effekt wird im Klettersport als „weiches Greifen“ bezeichnet. Die Untersuchung beschäftigt sich dabei mit dem angewendeten Greifverhalten in Abhängigkeit von situativer Angst und der Kletterhöhe. Eine Messung von Griffkräften an Klettersteinen sowie eine Messung der situativen Angst sollen klären, ob das Phänomen des „weichen Greifens“ tatsächlich eine Beeinträchtigung der Griffkräfte darstellt. Weiterhin soll mit dieser Arbeit auf den Zusammenhang von Körper und Geist eingegangen werden, dem in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung zugemessen wurde und auch im Klettersport eine wichtige Rolle einnimmt. Die Psyche spielt eine wesentliche Rolle im Klettersport, da es eine Sportart mit erhöhtem Risiko ist. Die Arbeit soll des weiteren einen Beitrag leisten, als Beobachter, das Greifverhalten eines Sportkletterers zu verstehen oder nachzuvollziehen und eventuell Rückschlüsse auf leistungshemmende Faktoren sowie das Greifverhalten machen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHES RAHMENKONZEPT
- 2.1 Einleitender Teil
- 2.2 Handlungstheoretische Grundlagen
- 2.3.1 Handlungssituation und Situationsdefinition
- 2.3.2 Die Handlungsphasen
- 2.3.2.1 Die Antizipationsphase
- 2.3.2.2 Die Realisationsphase
- 2.3.2.3 Die Interpretationsphase
- 2.3.3 Die Regulationsebenen
- 2.3.4 Zusammenfassendes zu handlungstheoretischen Grundlagen
- 2.4 Emotionen und Kognitionen als handlungsbestimmende Faktoren
- 2.4.1 Faktor Emotion
- 2.4.2 Faktor Kognition
- 2.4.3 Zusammenfassendes zu Emotion und Kognition
- 2.5 Die Emotion und das Phänomen „Angst“
- 2.5.1 Definitionsansätze zum Angstbegriff
- 2.5.2 Zusammenfassendes zum Angstbegriff
- 2.6 Theorien zur Emotion Angst
- 2.6.1 Der kognitive Ansatz des Handlungsgeschehens
- 2.6.2 Der psychoanalytische Angsttheorieansatz
- 2.6.3 Das Modell der Eigenschafts-Zustandsangst nach Spielberger
- 2.6.4 Der Theorieansatz nach Hackfort
- 2.7 Kennzeichen und Funktion der Angst im Klettersport
- 2.7.1 Kennzeichen der Angst aus subjektiver und objektiver Sicht
- 2.7.2 Angst und Ihre Funktion im Klettersport
- 2.7.3 Zusammenfassendes zu Auswirkungen und Funktion der Angst im Klettersport
- 2.8 Der Klettersport
- 2.8.1 Geschichtlicher Hintergrund zum Klettersport
- 2.8.2 Leistungsbestimmende Faktoren im Klettersport
- 2.8.3 Nutzungszonen einer Indoor-Kletterwand im Klettersport
- 2.8.4 Zusammenhang zwischen Erfahrung im Klettersport und Schwierigkeitsgrad
- 2.8.5 Entstehung von Angst im Klettersport
- 2.8.6 Verhaltensmuster nach Auftreten von Angst im Klettersport
- 2.8.7 Anatomische Gesichtspunkte
- 2.8.8 Die Muskulatur
- 2.8.9 Die Muskelphysiologie
- 2.8.10 Ein Ansatz zum „Weichen Griff“ im Klettersport
- 2.8.11 Zusammenfassendes zum Klettersport
- 3 PROBLEMSTELLUNG
- 3.1 Problemfeld „,weiches Greifen“
- 3.2 Überlegungen zum Problemfeld und Bildung abgeleiteter Hypothesen
- 4 UNTERSUCHUNGSMETHODIK
- 4.1 Untersuchungsdesign
- 4.2 Untersuchungsverfahren
- 4.3 Messmethodik und Darstellung der Untersuchungsinstrumente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Greifverhalten und situativer Angst beim Klettern. Ziel ist es, das Phänomen des „weichen Griffes“ im Klettersport im Hinblick auf seine möglichen Ursachen und Auswirkungen zu analysieren. Dabei werden die Handlungstheorie und verschiedene psychologische Theorien zur Emotion Angst herangezogen, um ein theoretisches Rahmenkonzept für die Untersuchung zu schaffen.
- Handlungstheorie und die Rolle der Emotion Angst im Handlungsprozess
- Analyse von Angst im Klettersport: Kennzeichen, Funktion und Auswirkungen
- Einflussfaktoren auf die Griffkraft beim Klettern: trait-Angst, state-Angst, Klettererfahrung und Maximalkraft
- Zusammenhang zwischen Greifverhalten und situativer Angst im Klettersport
- Entwicklung eines theoretischen Modells zum „weichen Griff“ im Klettersport
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Diplomarbeit ein und stellt die Relevanz des „weichen Griffes“ im Klettersport heraus. Kapitel 2 legt das theoretische Rahmenkonzept für die Untersuchung dar, indem es Handlungstheoretische Grundlagen, Emotion und Kognition sowie die Emotion Angst im Detail beleuchtet. Zudem wird der Klettersport als Sportart beleuchtet, wobei die Entstehung von Angst, Verhaltensmuster und anatomische Gesichtspunkte im Fokus stehen. Kapitel 3 formuliert die Problemstellung der Arbeit und leitet die zentralen Hypothesen ab. Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Untersuchung, einschließlich des Untersuchungsdesigns, der Untersuchungsverfahren und der Messmethodik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem „weichen Griff“ im Klettersport, der mit situativer Angst in Verbindung gebracht wird. Im Fokus stehen die Handlungstheorie, Emotionen und Kognitionen, insbesondere die Emotion Angst. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von trait-Angst, state-Angst, Klettererfahrung und Maximalkraft auf die Griffkraft im Klettersport. Weiterhin wird die Entstehung von Angst im Klettersport, die Funktion der Angst und verschiedene Verhaltensmuster analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „weichen Griff“ beim Klettern?
Der „weiche Griff“ beschreibt ein Phänomen, bei dem die Griffkraft eines Kletterers aufgrund von situativer Angst oder psychischer Belastung nachlässt, was die Kletterleistung beeinträchtigt.
Wie beeinflusst Angst die Kletterleistung?
Angst wirkt sich sowohl auf kognitiver als auch auf physiologischer Ebene aus. Sie kann zu verkrampften Bewegungen, verringertem Fokus und eben dem Nachlassen der Haltekraft führen.
Welche Rolle spielt die Kletterhöhe bei der Entstehung von Angst?
Die Kletterhöhe ist ein wesentlicher Faktor für die Auslösung von situativer Angst, da das subjektive Risikoempfinden mit zunehmender Höhe oft steigt.
Was ist der Unterschied zwischen Trait-Angst und State-Angst beim Sport?
Trait-Angst ist eine generelle Persönlichkeitseigenschaft (Ängstlichkeit), während State-Angst der aktuelle, vorübergehende Angstzustand in einer spezifischen Situation (z.B. in der Wand) ist.
Wie hängen Körper und Geist beim Klettern zusammen?
Klettern ist eine Sportart mit erhöhtem Risiko, bei der die Psyche die physische Umsetzung (Muskelphysiologie) direkt steuert. Emotionen und Kognitionen sind daher maßgebliche Faktoren für den Erfolg.
- Quote paper
- Diplomsportwissenschaftler Alexander Henn (Author), Robert Zepig (Author), 2005, 'Der weiche Griff beim Klettern' Zum Zusammenhang von Greifverhalten und situativer Angst beim Klettern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53674