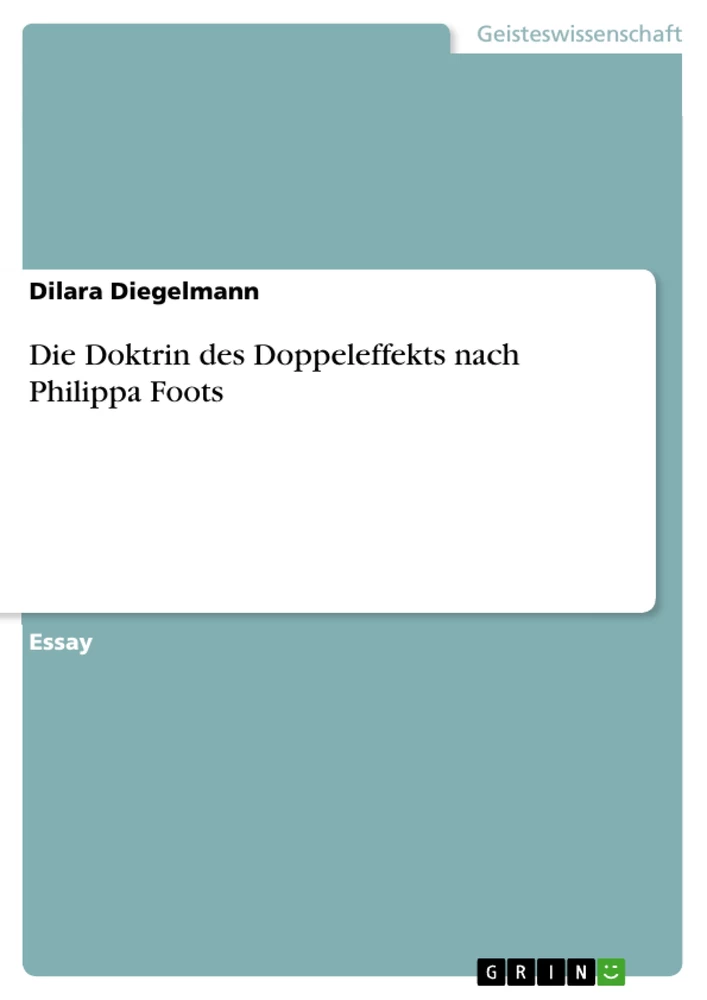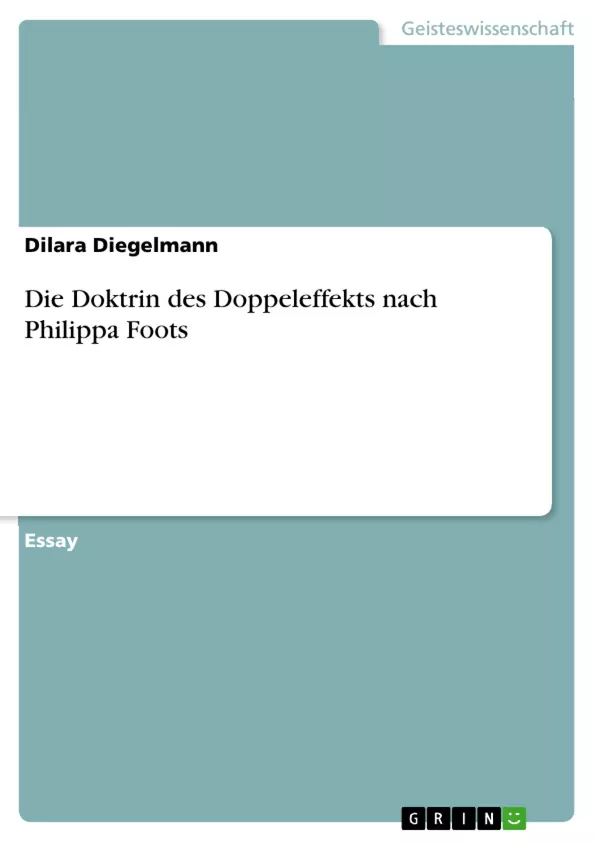Dieses Essay beschäftigt sich mit der Frage worin die Doktrin des Doppeleffekts besteht und welche Schwierigkeiten sich bei der Anwendung dieser Doktrin laut Foot ergeben.
Das Prinzip der Doppelwirkung (engl. „the doctrine of the double effect“) ist ein ethischer Grundsatz der im Falle eines moralischen Dilemmas Anwendung findet. Historisch hat sich vor allem die katholische Kirche auf dieses Prinzip berufen. Zugrunde liegt das Problem, dass es zwar in allen Bevölkerungsschichten weitgehend anerkannte ethische Grundregeln gibt, beispielsweise „Du sollst nicht töten.“, diese sich jedoch in bestimmten Situationen widersprechen. In gewissen Extremfällen ist es unumgänglich, dass entweder die eine oder die andere moralische Pflicht verletzt wird. Die Doktrin soll an dieser Stelle als Orientierungshilfe dienen. Sie relativiert ethische Grundregeln. Laut dieses Prinzips ist selbst eine strenge ethische Regel (wie die des Tötungsverbots) nicht absolut, sondern kann unter bestimmten Umständen gebrochen werden.
Grundlage ist die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Folgen einer Handlung. Einerseits kann eine Folge der Beweggrund der Handlung sein, das was man direkt beabsichtigt. Andererseits können auch Folgen auftreten, die man zwar als Resultat der Handlung vorhersieht, aber nicht erreichen möchte, unbeabsichtigte Nebeneffekte. Bentham nennt Letztere eine „oblique intention“, das heißt indirekte Intention im Gegensatz zur direkten Intention. Folglich kann eine Handlung moralisch gerechtfertigt sein, sofern alle negativen Konsequenzen lediglich unbeabsichtigte Nebeneffekte sind. Man kann sich durchaus zuvor der schlechten Nebeneffekte bewusst sein, solange sie jedoch nicht selbst intendiert sind, rechtfertigt die beabsichtigte gute Folge sie.
An dieser Stelle sei gesagt, dass in dem Artikel mehrmals darauf hingewiesen wird, dass auch die Mittel intendiert sind. Foot schreibt zunächst „He intends in the strictest sense both those things that he aims at as ends and those that he aims at as means to his ends” . Kurz darauf bezieht sie sich auf Bentham: „Bentham spoke of ‘oblique intention,’ contrasting it with the ‘direct intention’ of ends and means” . Die Doktrin ist daher nicht gleichzusetzen mit „der Zweck heiligt die Mittel“. Der negative Nebeneffekt muss eindeutig ein Resultat aus der Handlung sein und nicht die Handlung an sich. Ein schlechtes Mittel für einen guten Zweck zu nutzen ist nicht erlaubt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Prinzip der Doppelwirkung
- Fallbeispiele
- Das Trolley-Problem und der Richter
- Das Medikament und das Serum
- Der dicke Mann im Höhleneingang
- Wo ist die Doktrin sinnvoll?
- Welche Schwierigkeiten ergeben sich?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert das ethische Prinzip der Doppelwirkung (‚the doctrine of the double effect‘) in verschiedenen moralischen Dilemmata. Er untersucht, wie dieses Prinzip angewendet werden kann, um in komplexen Situationen ethisch verantwortungsvoll zu handeln und welche Grenzen und Schwierigkeiten sich dabei ergeben.
- Die Bedeutung und Anwendung des Prinzips der Doppelwirkung in ethischen Dilemmata
- Analyse verschiedener Fallbeispiele, die die moralische Komplexität des Prinzips aufzeigen
- Bewertung der Grenzen und Anwendungsbereiche des Prinzips der Doppelwirkung
- Diskussion der ethischen Implikationen des Prinzips im Kontext von Menschenwürde und moralischen Grundprinzipien
- Kritische Betrachtung des Prinzips in Bezug auf mögliche Missbräuche und Instrumentalisierungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Prinzip der Doppelwirkung: Der Text stellt zunächst das Prinzip der Doppelwirkung vor, welches im Falle eines moralischen Dilemmas Anwendung findet. Es wird erläutert, dass dieses Prinzip aus der katholischen Kirche stammt und die Unterscheidung zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen einer Handlung in den Mittelpunkt stellt.
Fallbeispiele: Der Text beleuchtet verschiedene Fallbeispiele, um die Anwendung des Prinzips der Doppelwirkung zu demonstrieren. Dazu gehören das Trolley-Problem, das Medikament und das Serum sowie der dicke Mann im Höhleneingang.
Wo ist die Doktrin sinnvoll?: Der Text setzt sich mit der Frage auseinander, in welchen Situationen das Prinzip der Doppelwirkung sinnvoll angewendet werden kann. Dabei werden die Notwendigkeit von universell gültigen Maximen, die Entwicklung der Gesellschaft und die Bedeutung der persönlichen Intention diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Prinzip der Doppelwirkung, ethische Dilemmata, moralische Pflicht, beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen, Trolley-Problem, Medikament und Serum, der dicke Mann im Höhleneingang, Menschenwürde, Utilitarismus, Instrumentalisierung.
- Quote paper
- Dilara Diegelmann (Author), 2016, Die Doktrin des Doppeleffekts nach Philippa Foots, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537192