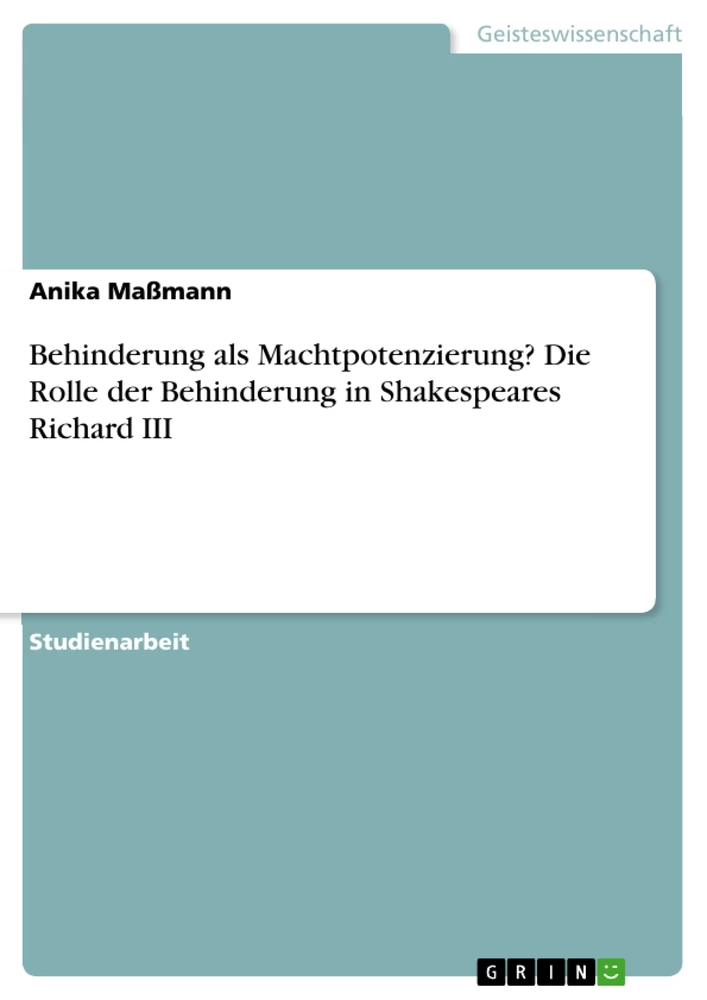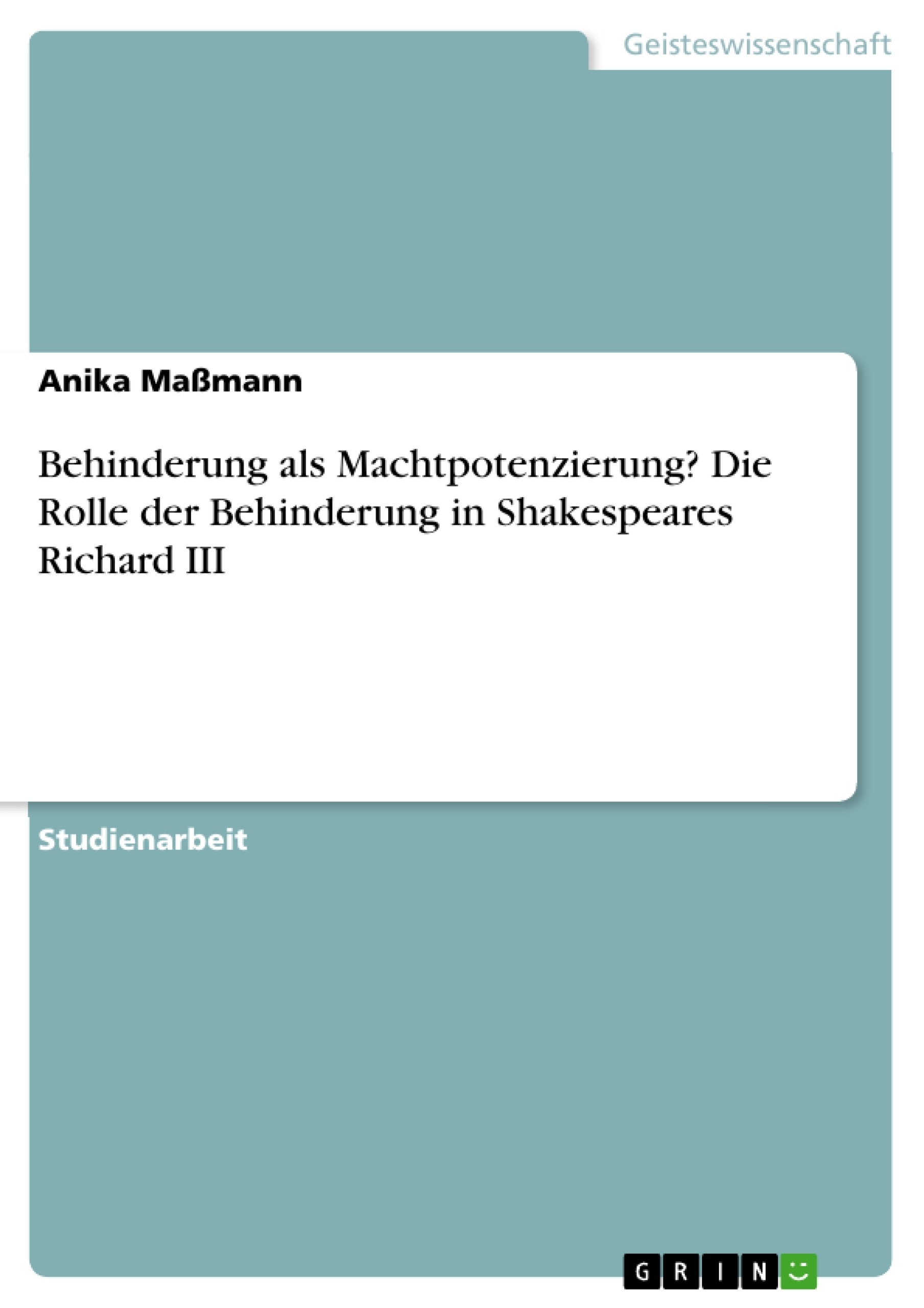Shakespeares Richard III ist in die Literaturgeschichte eingegangen als ein Bösewicht par excellence. Ohne Rücksicht auf Familienbande, skrupellos und unmoralisch erschleicht er sich seinen Weg auf den englischen Thron. Dass er missgestaltet ist, scheint dabei kein Problem für ihn darzustellen. Im Gegenteil kann man bei einer genaueren Lektüre sogar feststellen, wie
Richard seine Körperlichkeit gezielt dafür nutzt, seine Ziele durchzusetzen. Diese Arbeit soll daher der Frage nachgehen, inwiefern Richards Behinderung als Machtpotenzierung gelesen werden kann.
Dazu wird zunächst der aktuelle Forschungsstand zur Symbolik Richards Körper erläutert. Im Folgenden wird auf die unterschiedlichen Beschreibungen dieses Körpers im Stück eingegangen, damit im vierten Kapitel geklärt werden kann, ob wir
im Falle Richards von einer Behinderung oder einer Deformation sprechen. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich schließlich mit der Wissenschaft der Physiognomie, welche in der Renaissance äußerst beliebt war, und deren Annahme, dass man von der Äußerlichkeit eines Menschen auf seine Innerlichkeit schließen kann. In diesem Kapitel wird dann auch explizit die veränderliche
Semiotik von Richards Köper erläutert und als Beispiel die Verführung Annes angeführt. All diese Vorschritte sollen dazu dienen, im sechsten Kapitel die Forschungsfrage abschließend beantworten zu können.
Als Textgrundlage dient dieser Arbeit die deutsche Übersetzung von Marius Mayenburg, welche um einige Szenen im Vergleich zum Original gekürzt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand: Was wird durch Richards Behinderung symbolisiert?
- 3. Beschreibungen Richards Körper
- 4. Behinderung, Deformation, Stigma
- 4.1 Physiognomie als Spiegel der Moral
- 4.2 Veränderbarkeit der Körpersemiotik
- 4.3 Verführung Annes
- 5. Behinderung als Machtpotenzierung?
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Shakespeares Richard III, um die Rolle seiner Behinderung als Machtpotenzierung zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Interpretation von Richards Körper im Kontext der damaligen Zeit und den verschiedenen Ansichten der Forschung.
- Symbolische Bedeutung von Richards Körper
- Untersuchung der Beschreibungen von Richards Körper im Stück
- Bedeutung der Physiognomie in der Renaissance
- Veränderbarkeit der Körpersemiotik im Stück
- Analyse von Richards Macht und Manipulationstaktiken
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einleitung in die Thematik der Behinderung in Shakespeares Richard III und stellt die Forschungsfrage nach der möglichen Machtpotenzierung durch Richards Behinderung. Das zweite Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und verschiedene Ansichten zur Symbolik von Richards Körper. Das dritte Kapitel analysiert die verschiedenen Beschreibungen von Richards Körper im Stück, sowohl durch andere Figuren als auch durch Richard selbst. Das vierte Kapitel diskutiert den Zusammenhang von Behinderung, Deformation und Stigma in der damaligen Zeit sowie die Bedeutung der Physiognomie als Spiegel der Moral. Das fünfte Kapitel erläutert die veränderliche Semiotik von Richards Körper und zeigt die Verführung Annes als Beispiel.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Behinderung, Machtpotenzierung, Körpersemiotik, Physiognomie, Deformation, Stigma, Shakespeare, Richard III, Renaissance, Missgestaltete Körper, Theatergeschichte, Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Richards Behinderung in Shakespeares Stück interpretiert?
Richards Missgestaltetheit wird nicht nur als Makel gesehen, sondern als Instrument, das er gezielt einsetzt, um seine Machtansprüche durchzusetzen und andere zu manipulieren.
Was bedeutet „Physiognomie“ im Kontext der Renaissance?
Physiognomie war die Lehre, dass man vom äußeren Erscheinungsbild eines Menschen direkt auf seinen moralischen Charakter und sein Inneres schließen kann.
Ist Richard III. behindert oder deformiert?
Die Arbeit diskutiert die Begriffe Behinderung, Deformation und Stigma und untersucht, wie diese Zuschreibungen Richards Handeln und die Wahrnehmung durch seine Umwelt prägen.
Wie nutzt Richard seinen Körper zur Verführung?
Ein zentrales Beispiel ist die Verführung von Lady Anne, bei der Richard seine körperliche Erscheinung und die damit verbundene Semiotik variabel einsetzt, um Mitleid oder Bewunderung zu erzeugen.
Kann Behinderung als Machtpotenzierung gelesen werden?
Ja, die These der Arbeit lautet, dass Richard seine Behinderung als strategischen Vorteil nutzt, um Unterschätzung zu provozieren und seine skrupellosen Ziele zu erreichen.
- Citation du texte
- Anika Maßmann (Auteur), 2018, Behinderung als Machtpotenzierung? Die Rolle der Behinderung in Shakespeares Richard III, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537358