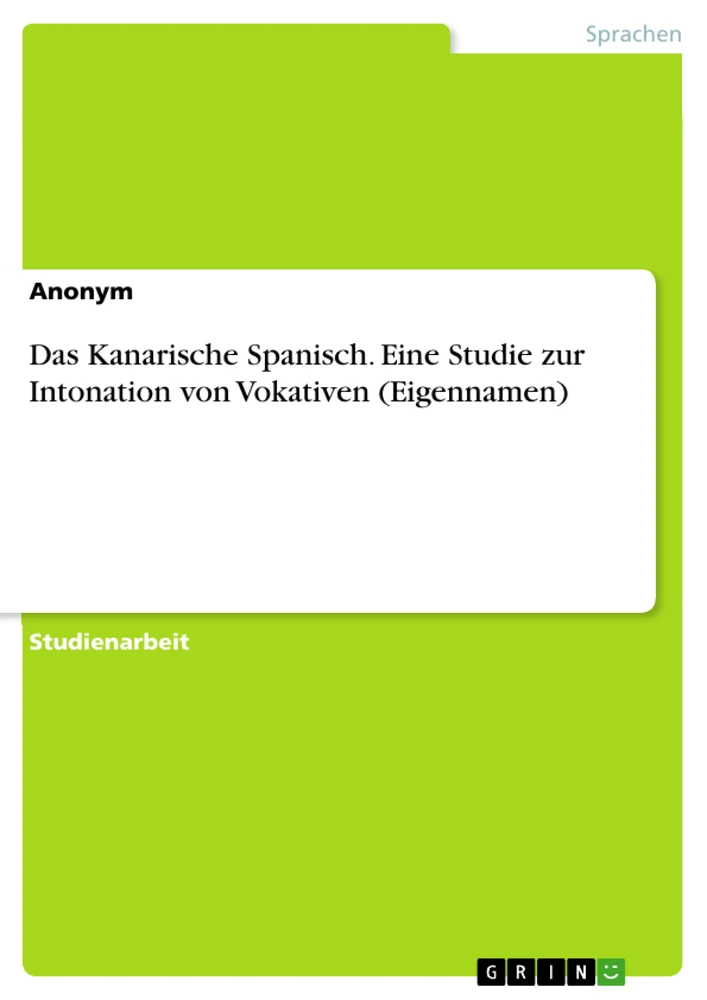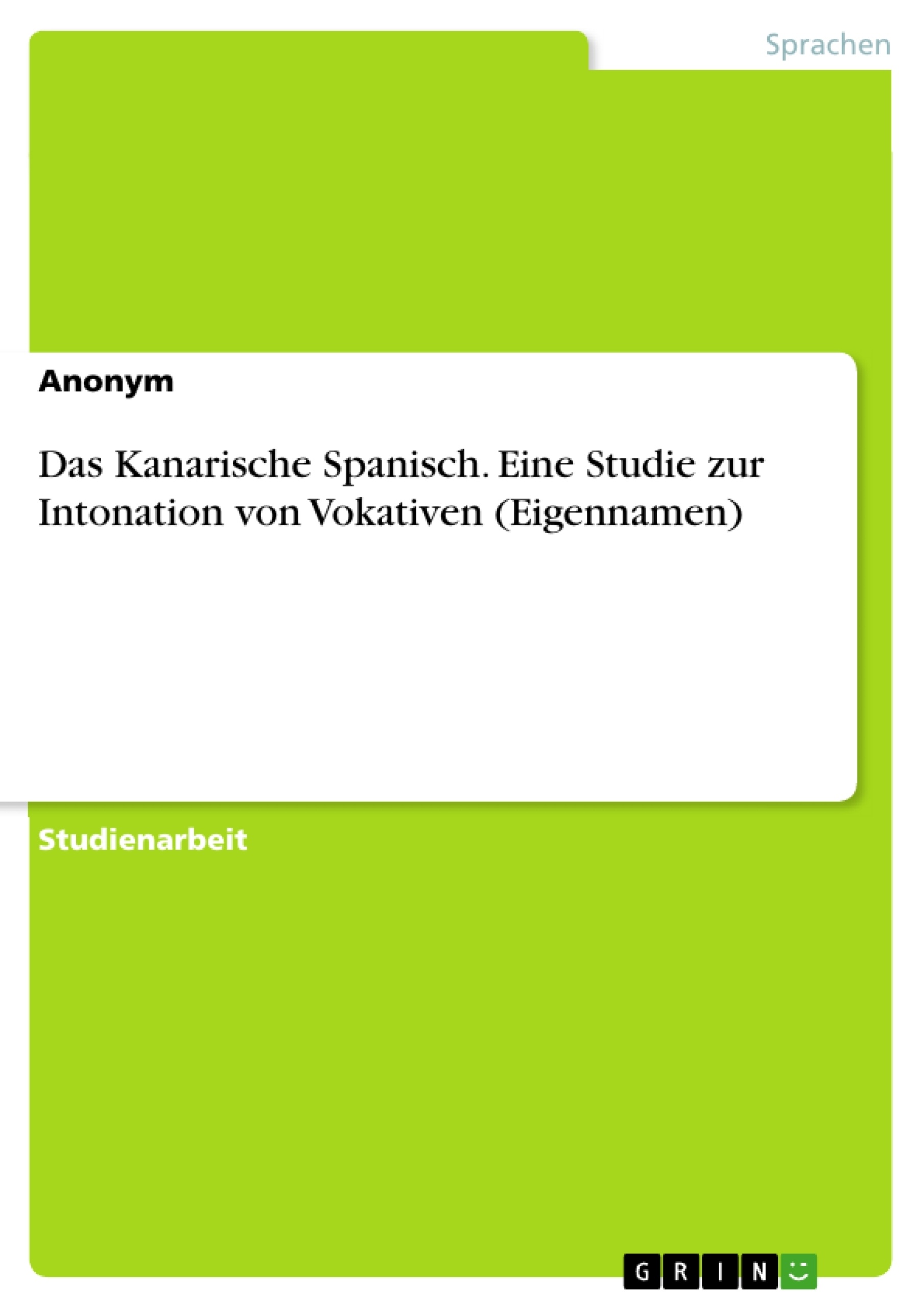„Intonation… refers to the use of suprasegmental phonetic features to convey ‚postlexical‘ or sentence-level pragmatic meanings in a linguistically structured way“ (Ladd 2008). Kurz gesagt, die Intonation gehört neben der suprasegmentalen Ebene zu den kommunikativ bedeutsamen Kodierungssystemen der Sprache. Der Begriff wird oft als die „Gesamtheit der prosodischen Eigenschaften lautsprachlicher Äußerungen (Silben, Wörter, Phrasen), die nicht an den Einzellaut gebunden sind […]“ definiert (Bußmann 1983). Da intonatorische Merkmale die segmentierbaren Einzellaute überlagern, werden sie auch als suprasegmentale Merkmale genannt (Bußmann 1983).
Bei der Beschreibung signifikanter Phänomene der Sprache spielen drei Ebenen eine Rolle. Eine davon ist die Akzentstruktur bzw. Betonung, die in artikulatorisch-phonetischer Hinsicht durch Druckanstieg auf einer Silbe bewirkt wird (Bußmann 1983). Dabei ist zwischen Wortakzent (vgl. z.B. Káffee vs. Café), Satzglied oder Phrasenakzent (im neuen Háus) und Satzakzent zu unterscheiden, der weitgehend von der kommunikativen Absicht des Sprechers, abhängt und als Normalakzent, emphatischer oder kontrastiver Akzent realisiert werden kann (Bußmann 1983). Die zweite Ebene ist die Pausenstruktur, die jedoch unabhängig vom Akzent und dem Tonhöhenverlauf beschrieben werden kann (Bußmann 1983). Als dritte Ebene wird die Tonhöhenstruktur bezeichnet, die vom Melodieverlauf bei der Silbe mit dem Satzakzent abhängt (Bußmann 1983). Bleibt die Stimmführung auf einer Tonsilbe unverändert, so wird von weiterführendem Tonmuster gesprochen, das die Unfertigkeit des begonnenen Satzes kennzeichnet (Bußmann 1983).
Je nach Tonhöhenverlauf am Ende des Satzes wird zwischen fallendem und steigendem Tonmuster unterschieden. Die Intonation kann einen Satzmodus (nein vs. Nein?) unterscheiden. Vor allem ist hier die fallende und steigende Melodie entscheidend. Sowohl die Einstellung des Sprechers, als auch wichtige Elemente einer Äußerung können anhand der Intonation ausgedrückt werden (Bußmann 1983).
Während in der Schriftsprache die Satzart der Intonation mittels Satzzeichen wie Frage-, Ausrufezeichen genauer bestimmt wird, richtet sich in der mündlichen Kommunikation der Fokus auf die Stimmführung des jeweiligen Sprechers.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Grundlagen
- 2 Methode
- 3 Ergebnisse
- 4 Diskussion
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Intonation von Vokativen (Eigennamen) im Kanarischen Spanisch. Die Studie analysiert die Tonhöhenmuster und die damit verbundenen kommunikativen Funktionen.
- Definition und Bedeutung von Intonation
- Vokative und ihre Funktionen in der Kommunikation
- Unterscheidung von Vokativtypen (sanft, verstärkt, über Distanz)
- Nuklearkonfigurationen von Vokativen im Kanarischen Spanisch
- Bedeutung der Intonation für die Interpretation von Vokativen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 definiert den Begriff der Intonation und beleuchtet seine Bedeutung in der Sprachkommunikation. Darüber hinaus werden Vokative und ihre Funktionen, wie die Aufmerksamkeitssteuerung und die Identifizierung des Adressaten, erläutert. Kapitel 2 beschreibt die Methode der Studie, die auf der Analyse von Tonhöhenmustern in verschiedenen Vokativtypen beruht. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 3 vorgestellt und beinhalten die Beschreibung der Nuklearkonfigurationen von Vokativen im Kanarischen Spanisch.
Schlüsselwörter
Intonation, Vokative, Eigennamen, Kanarisches Spanisch, Nuklearkonfiguration, Tonhöhenmuster, kommunikative Funktionen, Aufmerksamkeitssteuerung, Identifizierung, Sprachkommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Intonation in der Sprachwissenschaft?
Intonation bezeichnet den Einsatz suprasegmentaler Merkmale wie Tonhöhe und Melodieverlauf, um pragmatische Bedeutungen auf Satzebene zu vermitteln.
Was ist ein Vokativ?
Ein Vokativ ist eine Anredeform (oft ein Eigenname), die dazu dient, die Aufmerksamkeit eines Adressaten zu gewinnen oder ihn zu identifizieren.
Welche Vokativtypen werden im Kanarischen Spanisch unterschieden?
Die Studie unterscheidet zwischen sanften Vokativen, verstärkten Vokativen und Vokativen, die über eine Distanz hinweg gerufen werden.
Wie beeinflusst die Tonhöhe die Bedeutung einer Äußerung?
Durch steigende oder fallende Tonmuster kann zwischen verschiedenen Satzmodi (z. B. Aussage vs. Frage) oder der emotionalen Einstellung des Sprechers unterschieden werden.
Was sind suprasegmentale Merkmale?
Das sind Eigenschaften der Sprache wie Akzent, Pause und Tonhöhe, die über den einzelnen Lauten (Segmenten) liegen und die Bedeutung mitbestimmen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Das Kanarische Spanisch. Eine Studie zur Intonation von Vokativen (Eigennamen), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537381