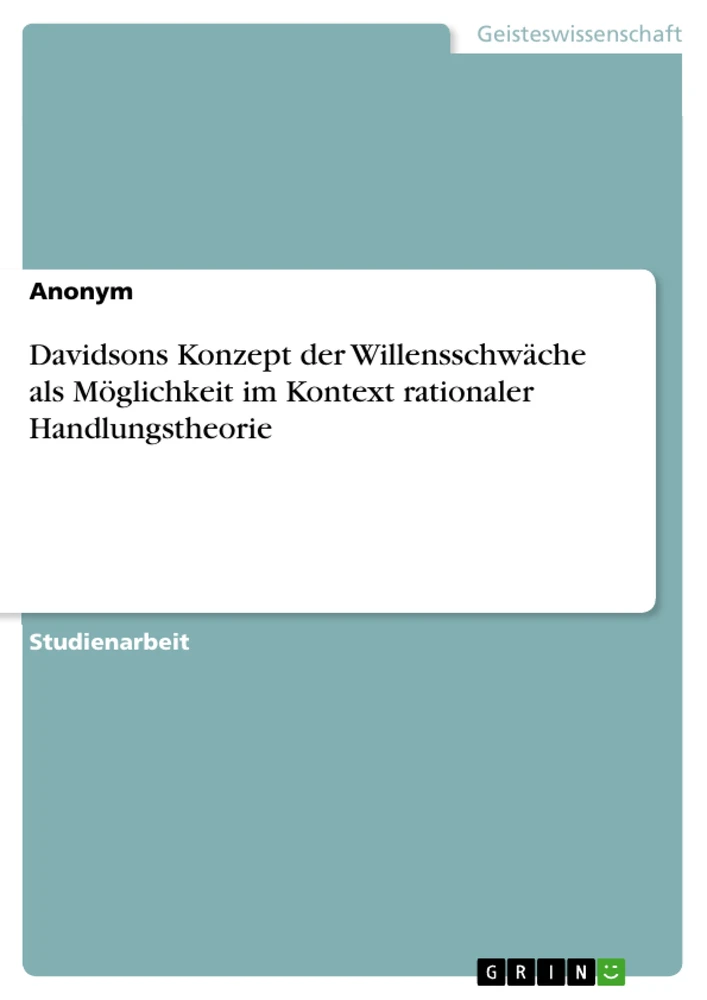Willensschwäche, ein Problem menschlicher Handlung, dessen Existenz oder auch Nicht-Existenz großen Diskussionsbedarf unter den Philosophen auslöst. Doch ist Willensschwäche nicht allgegenwärtig? Das Leben als Student scheint mit unendlichen Versuchungen durchsetzt. Wieder besseren Wissen werden wichtige Arbeiten nicht fertiggestellt oder Klausuren geschoben, um gemütlich die neue Lieblingsserie fertig zu schauen. Trotz dem Vorsatz mehr Sport zu treiben und gesünder zu essen, um in den anhaltenden Fitnesstrend einzusteigen, siegt die Gemütlichkeit. Rationalität vs. Irrationalität. Diese Problematik scheint es schon seit der Antike zu geben. Der Terminus "Willensschwäche" wird zwar in der antiken Diskussion nicht konkret benannt. Platon spricht in dieser Thematik jedoch von einem Nachgeben der Lust/Unlust, während Aristoteles von "akrasia" spricht.
Inhaltsverzeichnis
- Eine Diskussion über die Möglichkeit von Willensschwäche
- Willensschwäche zwischen Rationalität und Irrationalität
- Die Antike - Eine Versuchung zwischen Urteil und Handlung
- Die Moderne – Eine Überlegung zwischen Urteil und Handlung
- Die willensschwache Handlung im Kontext philosophischer Handlungstheorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik der Willensschwäche im Kontext philosophischer Handlungstheorien. Sie untersucht, ob und wie das Konzept der Willensschwäche, also die bewusste Handlung gegen besseres Wissen, mit rationalen Handlungstheorien vereinbar ist.
- Die Entwicklung des Begriffs der Willensschwäche in der Philosophie, insbesondere in der Antike (Platon, Aristoteles) und der Moderne
- Die Bedeutung des Wissens und der Rationalität für die Handlungsentscheidung
- Die Rolle der Emotionen und der Versuchung bei der Willensschwäche
- Die Analyse von Davidsons Konzept der Willensschwäche im Kontext rationaler Handlungstheorie
- Die Kritik an Davidsons Theorie und alternative Ansätze zur Erklärung von Willensschwäche
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Begriffs der Willensschwäche in der Philosophie. Es werden die Standpunkte von Platon und Aristoteles zum Thema "Willensschwäche" vorgestellt. Dabei wird insbesondere auf Platons Argumentation eingegangen, dass der Mensch niemals wissentlich das Falsche tut. Aristoteles hingegen differenziert zwischen verschiedenen Arten von Wissen und zeigt auf, wie psychische Ursachen Einfluss auf die Handlungsentscheidung nehmen können. Kapitel 2 befasst sich mit dem Problem der Willensschwäche im Kontext moderner Handlungstheorien. Es wird die Arbeit von Richard M. Hare als Einstieg verwendet, um anschließend auf Davidsons Konzept der Willensschwäche im Kontext rationaler Handlungstheorie einzugehen.
Schlüsselwörter
Willensschwäche, Akrasia, Handlungstheorie, Rationalität, Irrationalität, Wissen, Emotionen, Versuchung, Platon, Aristoteles, Davidson, Hare
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Willensschwäche (Akrasia) in der Philosophie?
Willensschwäche beschreibt das Phänomen, dass ein Mensch wider besseres Wissen eine Handlung vollzieht, die er selbst als weniger gut bewertet.
Wie erklärte Platon das Problem der Willensschwäche?
Platon bestritt die Existenz echter Willensschwäche; er glaubte, dass niemand wissentlich das Falsche tut – wer falsch handelt, leidet lediglich unter Unwissenheit.
Was war Aristoteles' Ansicht zur Akrasia?
Aristoteles differenzierte zwischen verschiedenen Arten von Wissen und erklärte, dass Emotionen oder Begierden das aktuelle Urteilsvermögen zeitweise außer Kraft setzen können.
Wie passt Willensschwäche in Davidsons rationale Handlungstheorie?
Donald Davidson analysiert, wie eine Handlung gleichzeitig intentional (absichtlich) und irrational (gegen das beste Urteil) sein kann, ohne den Rahmen der Rationalität völlig zu verlassen.
Ist Willensschwäche ein Zeichen von mangelnder Intelligenz?
Nein, in der philosophischen Diskussion geht es um den Konflikt zwischen Urteil und Handlung, der alle Menschen trotz vorhandener Einsicht betreffen kann.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Davidsons Konzept der Willensschwäche als Möglichkeit im Kontext rationaler Handlungstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537665