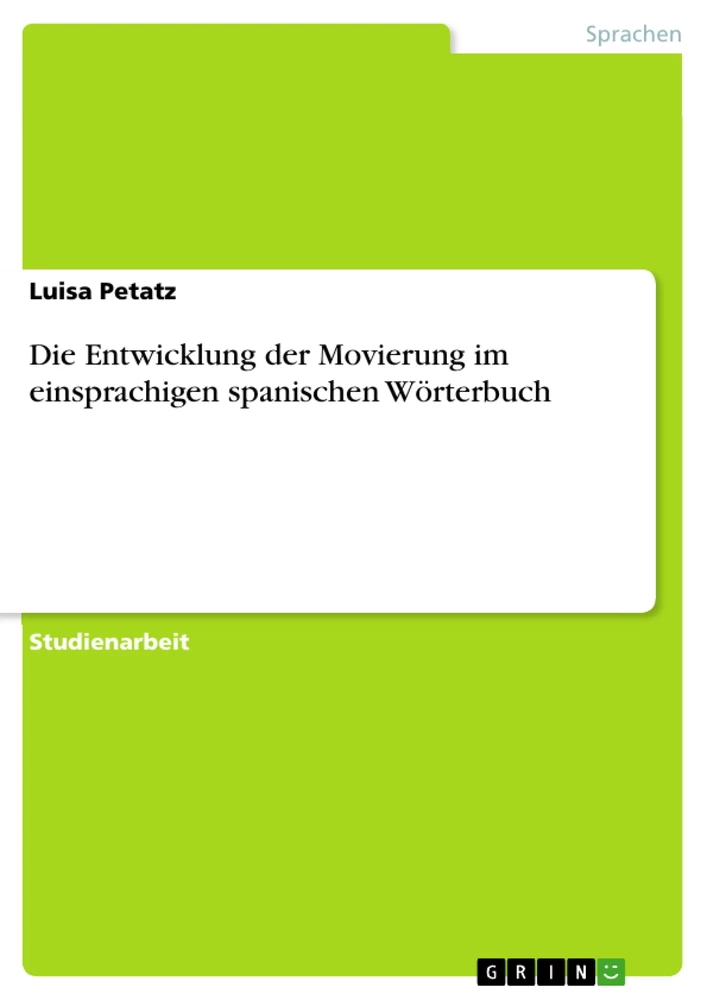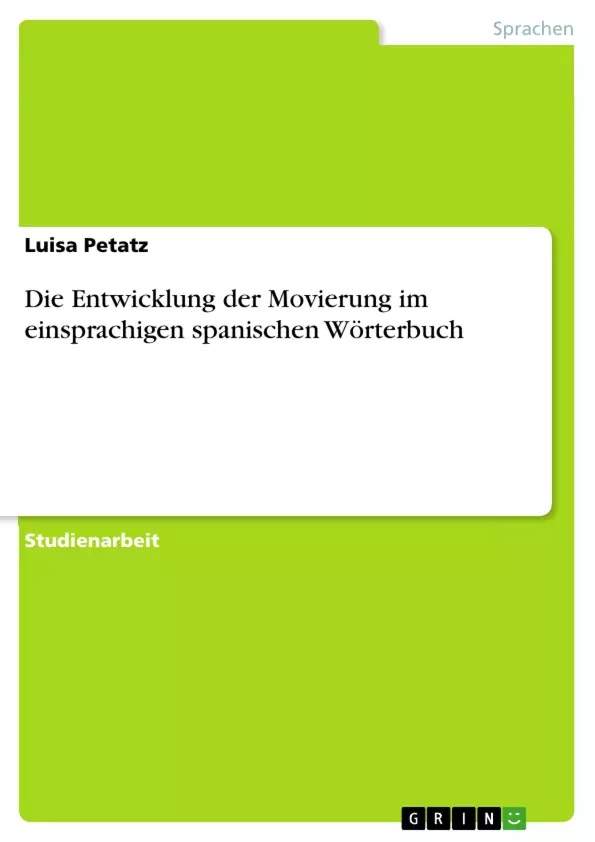In der Arbeit wird anhand Beispiele die Entwicklung der Movierung in drei verschiedenen, zeitlich aufeinanderfolgenden Wörterbüchern untersucht. Zu Beginn wird dafür der Begriff der Genusmarkierung erklärt und zwei Arten dessen kurz vorgestellt, um später auf die Entwicklung zurückzukommen.
Frauen wurden früher und werden auch heute noch als das schwächere Geschlecht angesehen. Sie müssen mehr Leistung erbringen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen wie Männer. Dies schlägt sich auch auf die Sprache und deren Grammatik nieder.
Nach dem Tod des spanischen Diktators Francisco Franco und der darauffolgenden Demokratisierungswelle in den 1970er Jahren entwickelten sich Schritt für Schritt in Spanien Frauenrechtsbewegungen, die für die Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts in der Gesellschaft und der Politik kämpfen. Egal ob Wahlrecht, Zugang zum Studium oder das Recht auf Ehescheidungen: wenn damit schon gekämpft werden muss, dann steht die (feministische) Linguistik hinten an.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Genusmarkierung
- 2.1 Definition
- 2.2 Movierung als Form der Genusmarkierung
- 3. Genuszuweisung
- 4. Die Entwicklung der Movierung im einsprachigen spanischen Wörterbuch
- 4.1 Personen- und Tierbezeichnungen
- 4.2 Berufsbezeichnungen
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Movierung im spanischen Wörterbuch anhand von drei verschiedenen, zeitlich aufeinanderfolgenden Wörterbüchern. Dabei wird der Fokus auf die Genusmarkierung und deren Veränderungen im Laufe der Zeit gelegt.
- Die Definition und Bedeutung der Genusmarkierung
- Die Rolle der Movierung als Form der Genusmarkierung
- Die Entwicklung der Movierung bei Personen- und Tierbezeichnungen
- Die Entwicklung der Movierung bei Berufsbezeichnungen
- Die Bedeutung der Movierung für die sprachliche Gleichstellung der Geschlechter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen und gesellschaftlichen Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Entwicklung von Frauenrechtsbewegungen in Spanien. Kapitel 2 behandelt die Genusmarkierung im Spanischen und erläutert den Unterschied zwischen Genus und Sexus. Kapitel 3 befasst sich mit der Genuszuweisung und den Regeln, die diese bestimmen. Kapitel 4 untersucht die Entwicklung der Movierung im einsprachigen spanischen Wörterbuch, insbesondere bei Personen- und Tierbezeichnungen sowie Berufsbezeichnungen.
Schlüsselwörter
Genusmarkierung, Movierung, spanische Sprache, Frauenrechte, Gleichstellung, Wörterbuch, feministische Linguistik, androzentrische Sprache, Berufsbezeichnungen, Personenbezeichnungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Movierung" in der spanischen Sprache?
Movierung bezeichnet die Ableitung weiblicher Formen von maskulinen Bezeichnungen (z.B. bei Berufen), um das Geschlecht sichtbar zu machen.
Wie hat sich die Movierung in spanischen Wörterbüchern entwickelt?
Die Arbeit untersucht drei aufeinanderfolgende Wörterbücher und zeigt, wie weibliche Berufsbezeichnungen zunehmend eigenständig aufgenommen wurden.
Welchen Einfluss hatte das Ende der Franco-Diktatur?
Die Demokratisierung in den 1970ern ermöglichte Frauenrechtsbewegungen, die auch Einfluss auf die Sprache und die feministische Linguistik nahmen.
Was ist der Unterschied zwischen Genus und Sexus?
Genus ist das grammatische Geschlecht eines Wortes, während Sexus das biologische Geschlecht der bezeichneten Person meint.
Was kritisiert die feministische Linguistik an alten Wörterbüchern?
Sie kritisiert die androzentrische (männerzentrierte) Sprache, in der Frauen oft unsichtbar bleiben oder nur als Anhängsel des Mannes erscheinen.
Gibt es Unterschiede zwischen Tier- und Berufsbezeichnungen?
Ja, die Arbeit analysiert separat, wie die Movierung bei Tieren im Vergleich zu menschlichen Berufsrollen in den Lexika umgesetzt wird.
- Citation du texte
- Luisa Petatz (Auteur), 2020, Die Entwicklung der Movierung im einsprachigen spanischen Wörterbuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537756