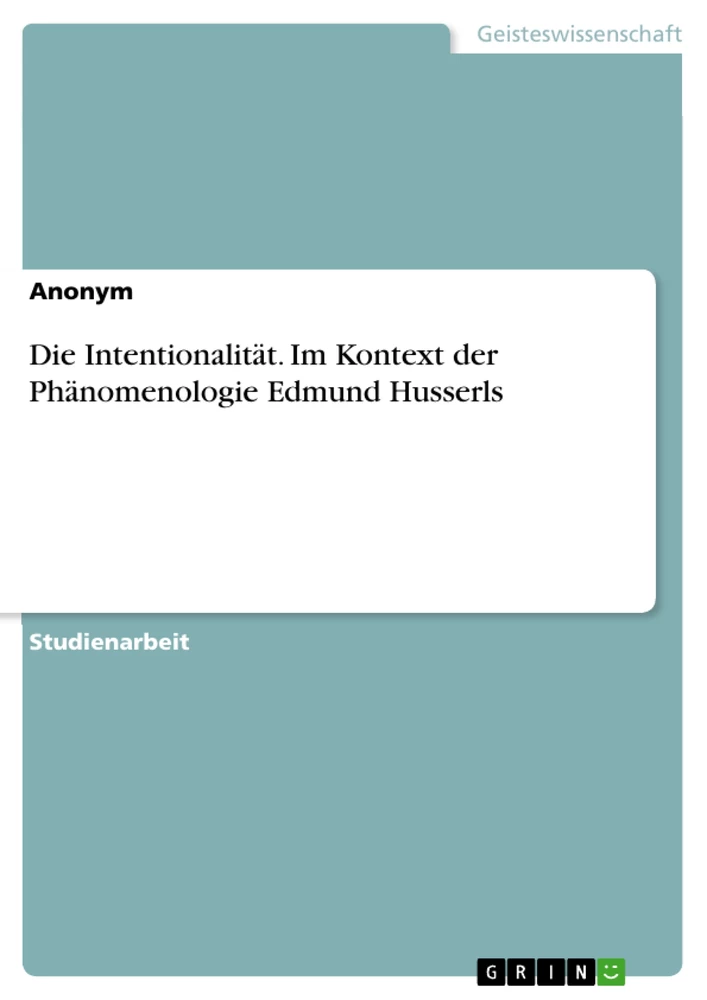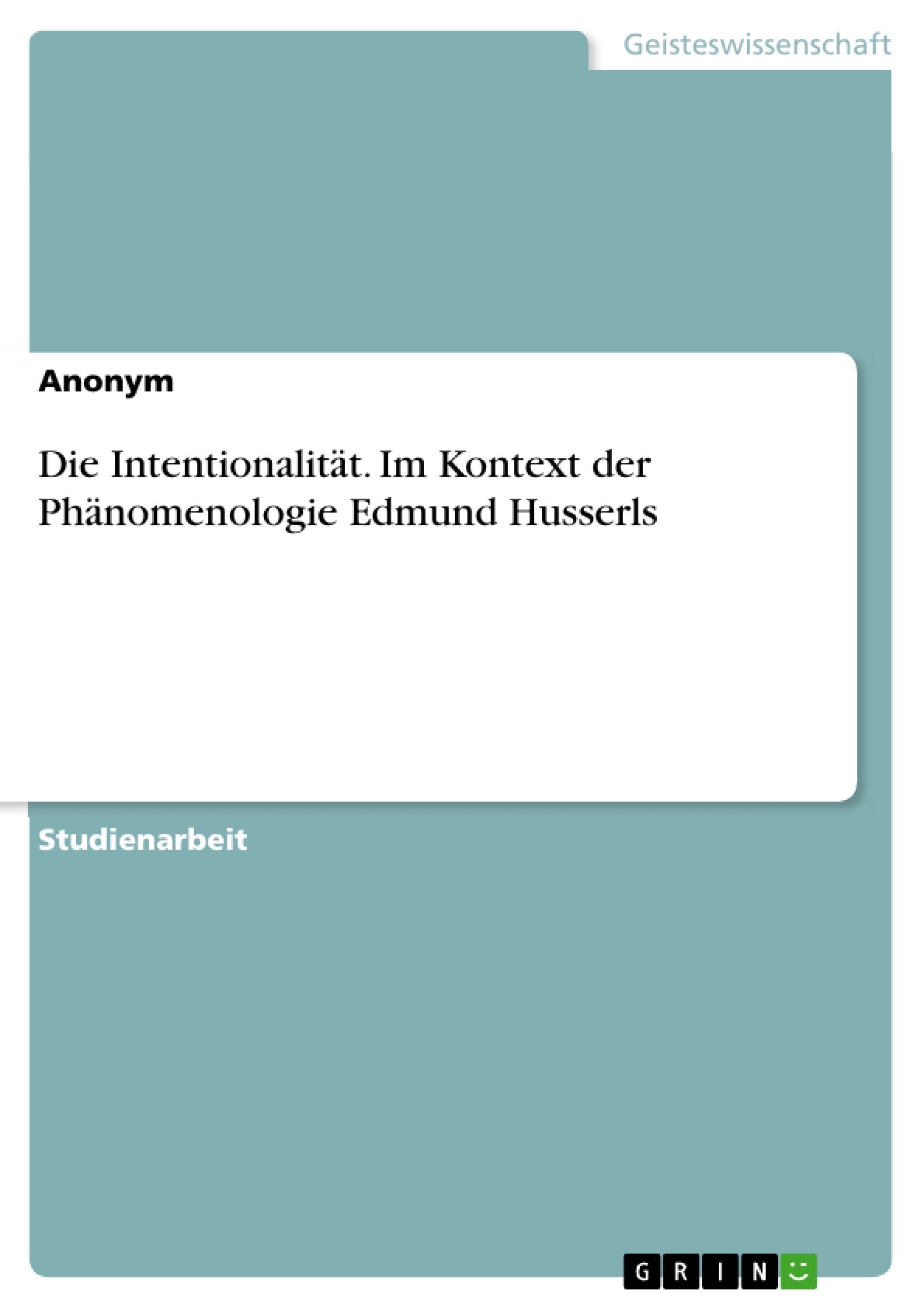Husserl sagt selbst, dass das phänomenologische Hauptthema die Intentionalität sei. Aufgrund dieser Aussage wird in dieser Arbeit näher untersucht, was Husserl unter Intentionalität versteht. Daher widmet sich diese Arbeit der Aufgabe, die Intentionalität in Husserls Phänomenologie genauer zu durchleuchten.
Es wird aufgezeigt, wovon die Phänomenologie handelt und wie sich dieser Begriff geschichtlich weiterentwickelt hat. Anschließend wird konkret auf Husserls Begriff der Phänomenologie eingegangen. Außerdem befasst sich die Arbeit mit Brentanos Verständnis von Intentionalität, da Husserl ein Schüler Brentanos war und den Begriff der Intentionalität von seinem damaligen Lehrer übernommen hat. Husserl war zwar eng mit Brentanos Theorien der Intentionalität vertraut, doch kritisierte und modifizierte er diese später.
Dann wird der Fokus dieser Arbeit skizziert - Husserls eigenes Konzept der Intentionalität. Dabei spielen die Aspekte der natürlichen Einstellung und ihre Einklammerung (Epoché), des phänomenologischen Residuums und der beiden Begriffe Noema und Noesis eine signifikante Rolle. Am Ende dieser Arbeit wird ein kurzes Fazit gezogen, welches alle genannten Punkte Revue passieren lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Phänomenologie vor und bei Edmund Husserl
- Das Konzept der Phänomenologie und ihre Geschichte
- Die Phänomenologie bei Husserl
- Die Intentionalität bei Franz Brentano
- Die Intentionalität bei Husserl
- Allgemeines zum Konzept der Intentionalität bei Husserl
- Natürliche Einstellung und ihre Einklammerung (Epoché)
- Das „reine“ Bewusstsein als das phänomenologische Residuum
- Noema und Noesis
- Die Schichten des Noemas
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der intensiven Untersuchung der Intentionalität im Kontext der Phänomenologie Edmund Husserls. Ziel ist es, das von Husserl entwickelte Konzept der Intentionalität zu beleuchten und dessen Bedeutung für seine Philosophie aufzuzeigen.
- Das Konzept der Phänomenologie und seine Geschichte
- Die Rolle von Franz Brentano in der Entwicklung der Intentionalität
- Husserls eigene Konzeption der Intentionalität
- Die Bedeutung der natürlichen Einstellung und der Epoché
- Das reine Bewusstsein als Grundlage phänomenologischer Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Arbeit stellt das Thema Intentionalität in Husserls Phänomenologie vor und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
- Die Phänomenologie vor und bei Edmund Husserl: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Phänomenologie in seiner historischen Entwicklung und untersucht Husserls eigenständigen Ansatz.
- Die Intentionalität bei Franz Brentano: Der Abschnitt fokussiert auf Brentanos Verständnis von Intentionalität als wichtige Grundlage für Husserls Werk.
- Die Intentionalität bei Husserl: Dieses Kapitel behandelt Husserls eigene Konzeption der Intentionalität, einschließlich der natürlichen Einstellung, der Epoché und des reinen Bewusstseins.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit sind: Phänomenologie, Intentionalität, Edmund Husserl, Franz Brentano, natürliche Einstellung, Epoché, reines Bewusstsein, Noema, Noesis.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Edmund Husserl unter Intentionalität?
Intentionalität ist das Hauptthema der Husserlschen Phänomenologie und beschreibt die Eigenschaft von Bewusstseinserlebnissen, sich immer auf etwas zu beziehen (das „Bewusstsein von etwas“).
Welche Rolle spielte Franz Brentano für Husserls Theorien?
Husserl war ein Schüler Brentanos und übernahm von ihm den Begriff der Intentionalität, modifizierte und kritisierte diesen jedoch später im Rahmen seiner eigenen phänomenologischen Forschung.
Was bedeutet der Begriff „Epoché“?
Die Epoché bezeichnet das „Einklammern“ der natürlichen Einstellung. Dabei wird das Urteil über die Existenz der Außenwelt zurückgestellt, um sich rein auf die Phänomene des Bewusstseins zu konzentrieren.
Was ist der Unterschied zwischen Noema und Noesis?
Noesis bezeichnet den Akt des Bewusstseins (das Meinen), während Noema den Inhalt oder den Gegenstand des Bewusstseins beschreibt (das Gemeinte), so wie er im Erlebnis erscheint.
Was versteht man unter dem phänomenologischen Residuum?
Das phänomenologische Residuum ist das „reine Bewusstsein“, das übrig bleibt, nachdem die natürliche Welt durch die Epoché methodisch ausgeklammert wurde.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Intentionalität. Im Kontext der Phänomenologie Edmund Husserls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537862