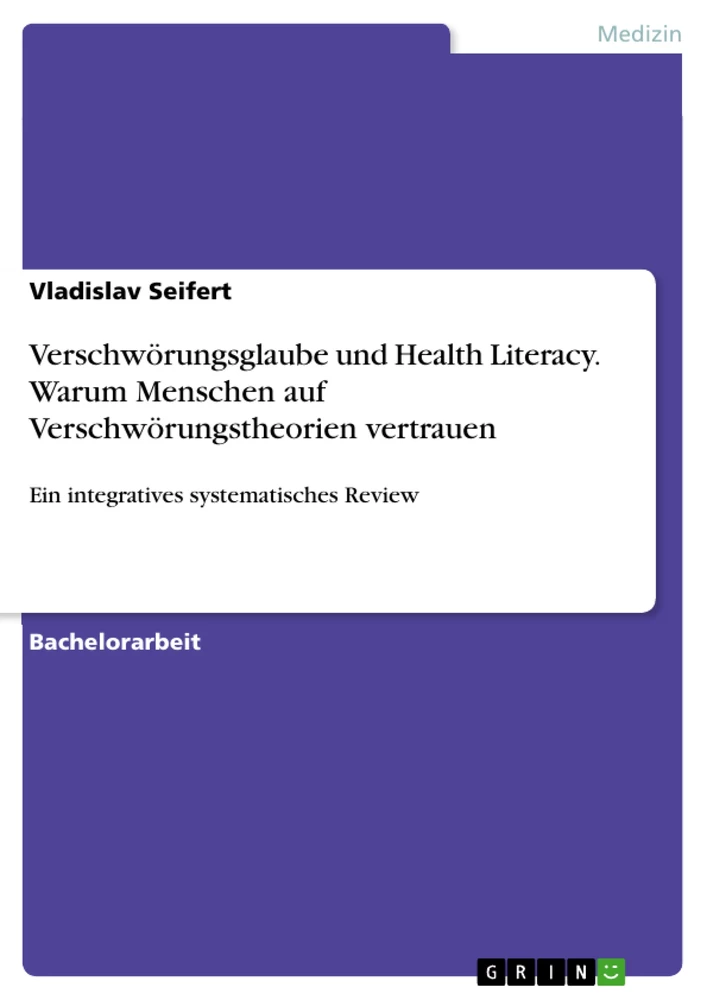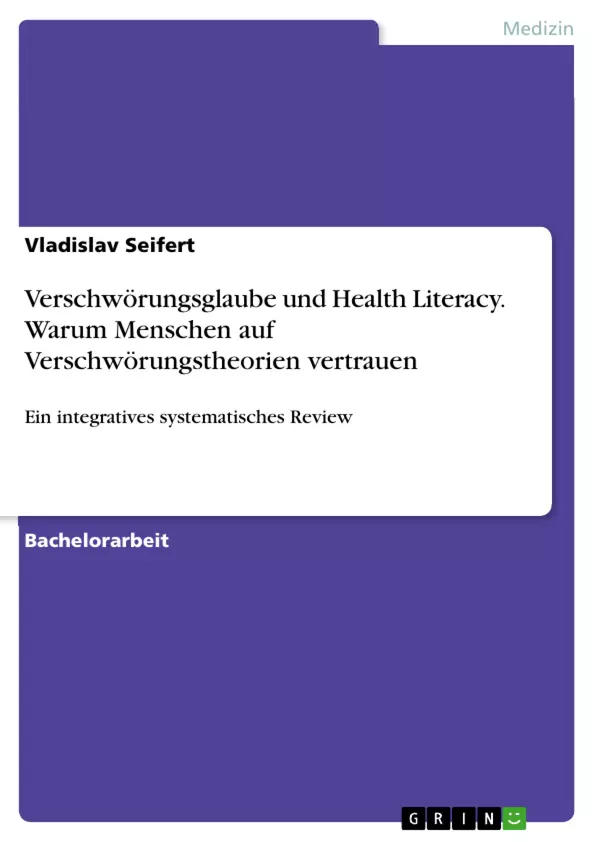Der Glaube an Verschwörungstheorien ist weit verbreitet. Besonders in Krisenzeiten, wie der Verbreitung eines globalen Virus, bedienen sich Menschen dieses Glaubens. Wieso glauben Menschen daran und welche Möglichkeiten bieten sich uns mit Informationen und Ereignissen umzugehen die unsere Gesundheit bedrohen, beziehungsweise betreffen? Diese Arbeit befasst sich mit einer hochaktuellen Thematik und versucht sich dieser unvoreingenommen zu nähern.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Anfang des Jahres 2019 eine Liste der zehn größten Risiken für die globale Gesundheit vorgestellt. Neben Luftverschmutzung und Klimawandel zählt die WHO HIV/AIDS zu den Gesundheitsrisiken. Noch immer sterben jährlich ca. eine Millionen Menschen an HIV/AIDS, rund 37 Millionen sind schätzungsweise mit HIV infiziert. Die WHO würdigt einerseits die Erfolge bei der Bekämpfung von HIV. Sie stellt jedoch auch fest, dass die Zahl der Neuerkrankungen trotz der Möglichkeit einer Präexpositionsprophylaxe, immer noch hoch ist.
Weiterhin zählt die WHO Impfverweigerung zu den größten Risiken. So ist im Jahr 2018 ein starker Anstieg der Zahl der Maserninfektionen in der EU zu verzeichnen gewesen. Dies wird auf die niedrige Impfrate zurückgeführt. Die Ursachen für die Impfverweigerung werden als komplex dargestellt und mangelndes Vertrauen als einer der Gründe angeführt. Im April 2019 hat die EU-Kommission eine bessere Aufklärung über Impfungen gefordert. Jyrki Katainen, EU-Vizepräsidenten für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit, hat in seiner Erklärung Falschinformationen hinsichtlich Impfens den Kampf angesagt.
Im Zusammenhang mit Falschinformationen wird der Glaube an Verschwörungstheorien als einer der Verweigerungsgründe diskutiert. Neben anderen Argumenten, drehen sich diese um die Überzeugung, dass die Impfung eher schadet als nützt. Die Pharmaunternehmen seien nicht an der Heilung interessiert sondern an Gewinnmaximierung durch Krankheitsverbreitung. Ebenso werden in der Forschung zur Inanspruchnahme der HIV-Präexpositionsprophylaxe Verschwörungstheorien untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Methodik
- 2.1 Suchstrategie
- 2.2 Ein- und Ausschlusskriterien ........
- 3. Ergebnisse der Literaturrecherche...
- 4.1 Definition zentraler Begriffe und Konzepte
- 4.2 Gesundheit.
- Gesundheitsoutcomes
- 5. Verschwörungsglaube.
- 5.1 Begriffsklärung und Definition
- 5.2 Verbreitungsgrad
- 5.3 Psychosoziale Betrachtung des Verschwörungsglaubens.
- 5.4 Philosophische Betrachtung des Verschwörungsglaubens.
- 5.5 ,,Yesterday's tools\" und Nutzen des Verschwörungsglaubens..
- 5.6 Verschwörungsglaube und Gesundheit(sverhalten)......
- 6. Das Konzept der Health Literacy
- 6.1 Vorstellung und Definition des Health Literacy Konzeptes.
- 6.2 Ausprägung der Health Literacy in Deutschland.
- 6.3 Forschungsstand zur Konzeptualisierung von Health Literacy.
- 6.4 Health Literacy und Gesundheit(sverhalten)..\li>
- 7. Diskussion der Ergebnisse und Methoden
- 7.1 Verschwörungsglaube und Gesundheit.
- 7.2 Health Literacy und Gesundheit.
- 7.3 Health Literacy als „Gegenmodell“ zum Verschwörungsglauben
- 7.4 Methodendiskussion und Limitation
- 8. Schlussfolgerung und Implikationen für die Praxis
- Definition und Analyse von Health Literacy
- Definition und Analyse des Verschwörungsglaubens
- Zusammenhang zwischen Health Literacy und Gesundheitsoutcomes
- Zusammenhang zwischen Verschwörungsglaube und Gesundheitsoutcomes
- Potenzial von Health Literacy als Gegenmodell zum Verschwörungsglaube
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Health Literacy und dem Glauben an Verschwörungstheorien, um zu untersuchen, ob Health Literacy als Gegenmodell zum Verschwörungsglauben fungieren kann. Die zentrale Fragestellung ist, ob Health Literacy eine schützende Funktion gegen den Glauben an Verschwörungstheorien hat und damit positive Auswirkungen auf Gesundheitsoutcomes hat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas im Kontext von aktuellen Gesundheitsrisiken wie HIV/AIDS und Impfverweigerung dar. Es wird auf die Bedeutung von Gesundheitsinformationen und die steigende Nutzung des Internets als Informationsquelle hingewiesen. Das erste Kapitel befasst sich mit der Methodik des integrativen, systematischen Literaturreviews und beschreibt die Suchstrategie, Suchbegriffe sowie Ein- und Ausschlusskriterien. Das zweite Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Recherche und die Definition zentraler Begriffe und Konzepte wie Gesundheit und Gesundheitsoutcomes. Das dritte Kapitel fokussiert auf den Begriff des "Verschwörungsglaubens" und analysiert seine Definition, Verbreitung, psychosoziale und philosophische Aspekte sowie den Zusammenhang mit Gesundheitsverhalten.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der "Health Literacy" und definiert den Begriff, stellt seine Ausprägung in Deutschland dar und analysiert den aktuellen Forschungsstand. Der Zusammenhang zwischen Health Literacy und Gesundheitsverhalten wird ebenfalls beleuchtet. Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Forschungsarbeit und bewertet die Relevanz der Fragestellung und der Zielsetzung. Es werden die Zusammenhänge zwischen Verschwörungsglaube und Gesundheit sowie zwischen Health Literacy und Gesundheit analysiert. Health Literacy wird als "Gegenmodell" zum Verschwörungsglauben betrachtet. Das sechste Kapitel bewertet die Methodik der Arbeit und diskutiert Limitationen.
Schlüsselwörter
Health Literacy, Verschwörungsglaube, Gesundheitsoutcomes, Gesundheitsverhalten, Informationsverarbeitung, Informationsquellen, Vertrauen, Misstrauen, Impfverweigerung, Präventionsverhalten, chronische Erkrankungen, systematische Literaturübersicht.
Häufig gestellte Fragen
Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien?
Menschen greifen oft in Krisenzeiten auf Verschwörungsglauben zurück, um komplexe Ereignisse, die ihre Gesundheit oder Sicherheit bedrohen, psychosozial zu verarbeiten.
Was ist „Health Literacy“?
Health Literacy (Gesundheitskompetenz) beschreibt die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und für eigene Entscheidungen anzuwenden.
Kann Health Literacy vor Verschwörungsglauben schützen?
Die Arbeit untersucht die These, dass eine hohe Gesundheitskompetenz als Gegenmodell zum Verschwörungsglauben fungiert und eine schützende Funktion gegen Falschinformationen hat.
Welche Rolle spielt Verschwörungsglaube bei der Impfverweigerung?
Verschwörungstheorien (z.B. über Profitgier der Pharmaindustrie) werden als einer der Gründe für mangelndes Vertrauen und sinkende Impfraten diskutiert.
Wie verbreitet ist Gesundheitskompetenz in Deutschland?
Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Ausprägung der Health Literacy in Deutschland basierend auf dem aktuellen Forschungsstand.
Welche gesundheitlichen Risiken werden in der Arbeit thematisiert?
Neben der Impfverweigerung werden insbesondere HIV/AIDS und die Inanspruchnahme von Präventionsmaßnahmen im Kontext von Falschinformationen analysiert.
- Citation du texte
- Vladislav Seifert (Auteur), 2019, Verschwörungsglaube und Health Literacy. Warum Menschen auf Verschwörungstheorien vertrauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538412