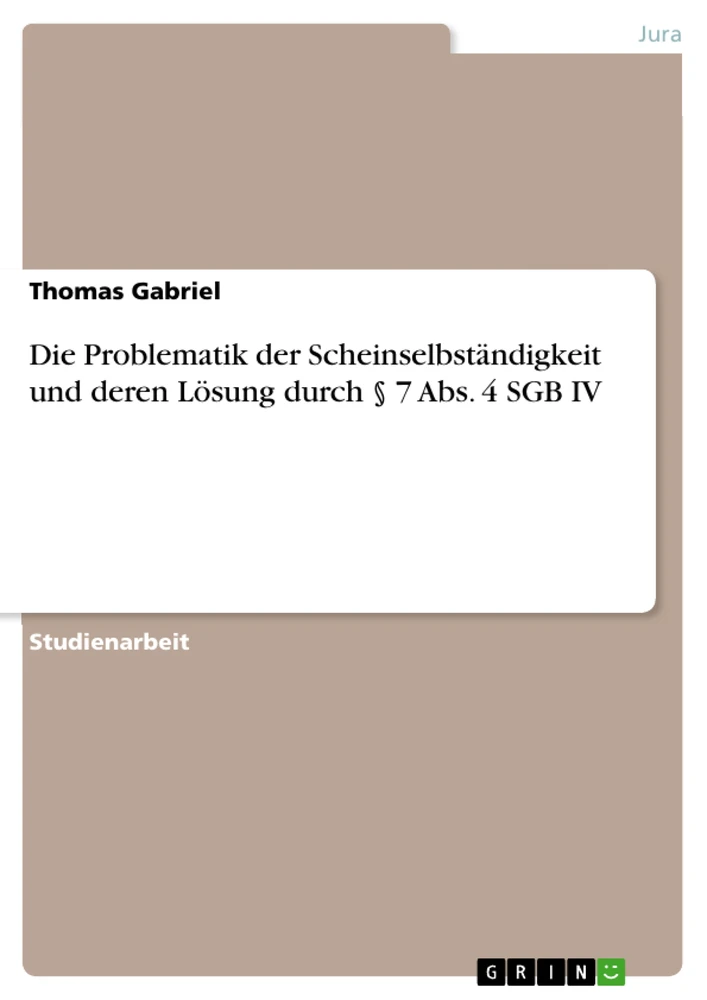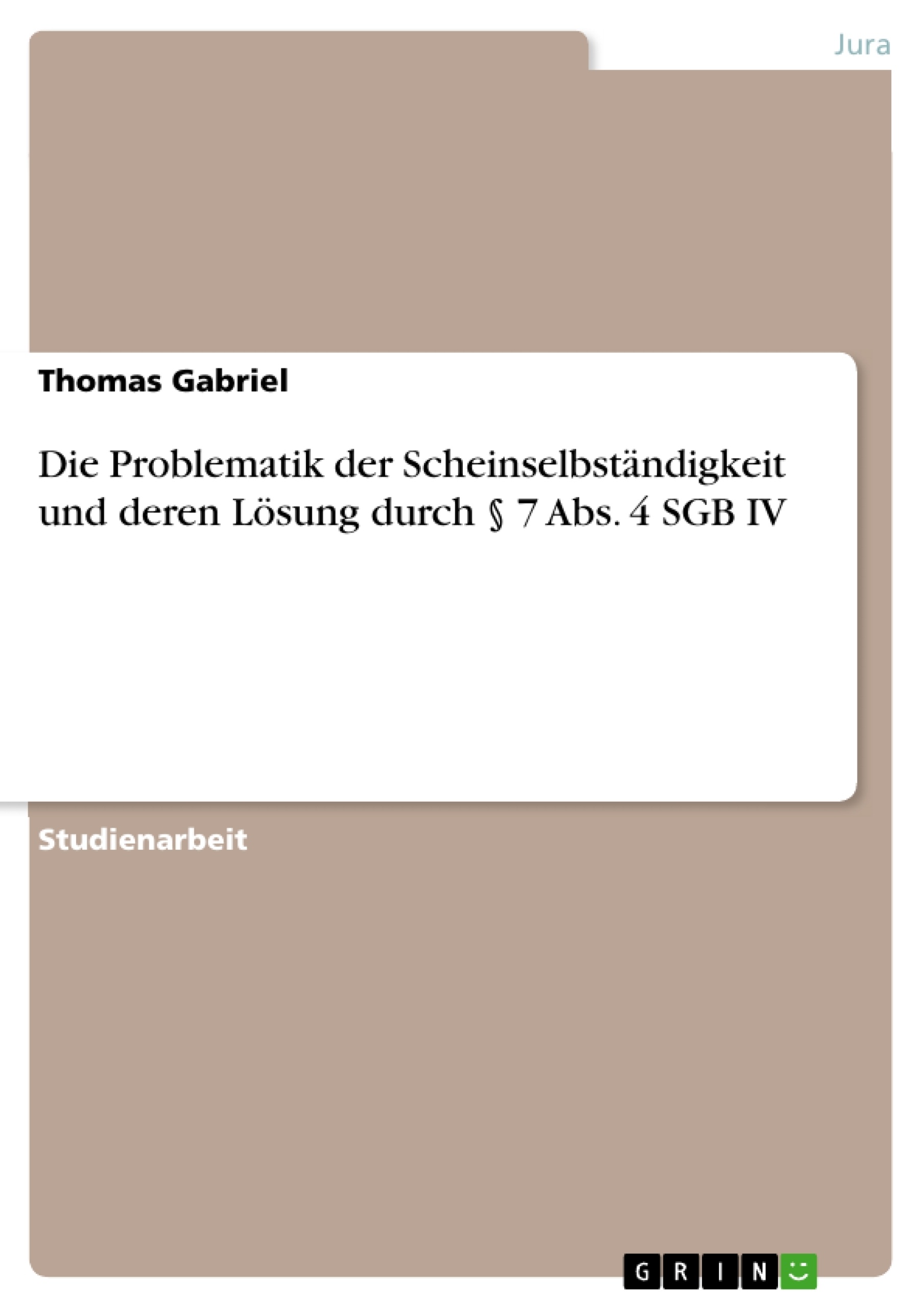In meiner praktischen Tätigkeit bei einer höheren Gewerbebehörde wurde ich häufig durch Anfragen unterer Gewerbebehörden mit dem Problem der Scheinselbständigkeit konfrontiert. Dabei konnte ich feststellen, daß in den Gewerbebehörden teilweise große Unsicherheit im Umgang mit dem Thema Scheinselbständigkeit besteht. Andererseits sind den Gewerbebehörden bei der Bekämpfung der Scheinselbständigkeit ohnehin nahezu völlig die Hände gebunden.
Eine Möglichkeit, Scheinselbständigkeit zu erkennen und ihr entgegen zu wirken, sah der Gesetzgeber in der Einführung des § 14 Abs. 5 Nr. 7 GewO, wonach die untere Gewerbebehörde einen Durchschlag der Gewerbeanzeige dem Sozialversicherungsträger zuzuleiten hat. Der bloßen Gewerbeanzeige kann der Sozialversicherungsträger aber lediglich die Art der Gewerbetätigkeit, den Gewerbestandort, die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer und persönliche Angaben des Gewerbetreibenden entnehmen (§ 14 Abs. 4 GewO) und hieraus wohl noch lange nicht auf eine Scheinselbständigkeit des Betroffenen schließen. Jedoch die Gemeinden und die unteren Gewerbebehörden erkennen oftmals bereits bei der Entgegennahme der Gewerbeanzeige nach § 14 GewO Indizien, die für eine Selbständigkeit nur zum Schein sprechen, so z. B. bei einem angeblich selbständigen Betreuer einer Spielhalle, der an die Weisungen des Betreibers hinsichtlich der Öffnungszeiten der Spielhalle fest gebunden ist und einen gleichbleibenden Monatslohn erhält. Da aber einerseits der Gewerbebehörde lediglich drei Werktage zur Prüfung der Gewerbeanzeige bleiben (dann hat sie die Gewerbeanzeige zu bestätigen („Gewerbeschein“) und andererseits die Gewerbebehörde nach Nr. 6.2. GewAnzVwV lediglich den Empfang der mangelfreien Gewerbeanzeige zu bescheinigen hat, hat sie für eine Überprüfung des Gewerbetreibenden hinsichtlich dessen tatsächlicher Selbständigkeit zu wenig Zeit und ist hierfür auch personell, rechtlich und tatsächlich unzuständig. Ungeachtet dessen wird aber von den Gewerbebehörden auch erwartet, daß sie klar feststellen können, ob eine gewerbliche Tätigkeit tatsächlich selbständig und nicht scheinselbständig ausgeübt wird, so z. B. bei der Prüfung, ob ein Erwerbstätiger, derselbständigHandwerksleistungen erbringt, über eine Eintragung in der Handwerksrolle verfügt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkung
- II. Begriff der Scheinselbständigkeit
- III. Ursprung der Scheinselbständigkeit
- IV. Ursachen der Scheinselbständigkeit
- V. Probleme der Scheinselbständigkeit
- VI. Sozialrechtliche Situation vom 01.07.1977 bis zum 31.12.1998
- VII. „Reformbewegung“ bis zum 31.12.1998
- VIII. Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998
- IX. Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999
- X. kritische Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beleuchtet die Problematik der Scheinselbständigkeit und untersucht deren rechtliche Relevanz, insbesondere im Kontext des § 7 Abs. 4 SGB IV. Ziel ist es, die Begrifflichkeit zu klären, die Ursachen und Probleme zu analysieren und die historische Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen nachzuzeichnen. Die Arbeit verzichtet auf eine umfassende Darstellung des § 7 Abs. 4 SGB IV, konzentriert sich jedoch auf dessen Bedeutung im Umgang mit Scheinselbständigkeit.
- Begriff und Abgrenzung der Scheinselbständigkeit
- Ursachen und Auswirkungen von Scheinselbständigkeit
- Historische Entwicklung der Rechtslage zur Scheinselbständigkeit
- Rollen der Gewerbebehörden bei der Erkennung von Scheinselbständigkeit
- Bewertung der rechtlichen Regelungen zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkung: Diese Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Erfahrungen des Autors mit der Problematik der Scheinselbständigkeit in seiner Tätigkeit bei einer höheren Gewerbebehörde. Es wird die Unsicherheit der Behörden im Umgang mit dem Thema und die begrenzten Möglichkeiten zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit hervorgehoben. Die Einführung des § 14 Abs. 5 Nr. 7 GewO wird als ein Ansatz zur Verbesserung der Situation erwähnt, jedoch werden die Grenzen dieser Regelung im Hinblick auf die Möglichkeiten der Gewerbebehörden zur effektiven Prüfung von Gewerbeanzeigen aufgezeigt. Die Arbeit soll Licht in das durch politische Schlagworte geprägte Dunkel um die Scheinselbständigkeit bringen.
II. Begriff der Scheinselbständigkeit: Dieses Kapitel würde den Kernbegriff der Scheinselbständigkeit definieren und von anderen verwandten Konzepten abgrenzen. Es würde die juristische Definition und die Kriterien zur Unterscheidung zwischen tatsächlicher Selbständigkeit und Scheinselbständigkeit beleuchten.
III. Ursprung der Scheinselbständigkeit: Hier würde die historische Entwicklung des Phänomens Scheinselbständigkeit analysiert werden, möglicherweise unter Bezugnahme auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die zur Entstehung und Verbreitung dieses Problems beigetragen haben.
IV. Ursachen der Scheinselbständigkeit: Dieser Abschnitt würde die verschiedenen Gründe für die Entstehung von Scheinselbständigkeit untersuchen. Mögliche Ursachen könnten in wirtschaftlichen Anreizen, Gesetzeslücken oder auch in den Beziehungen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern liegen.
V. Probleme der Scheinselbständigkeit: Hier würden die negativen Folgen von Scheinselbständigkeit für die beteiligten Personen (Arbeitnehmer/Selbständige), die Sozialversicherung und den Staat beleuchtet werden. Dies könnte die ungerechtfertigte Umgehung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, Wettbewerbsverzerrungen und den Verlust von Arbeitnehmerschutz umfassen.
VI. Sozialrechtliche Situation vom 01.07.1977 bis zum 31.12.1998: Dieser Abschnitt würde die rechtliche Situation bezüglich Scheinselbständigkeit in diesem Zeitraum detailliert darstellen. Er würde die bestehenden Rechtsvorschriften und ihre praktische Anwendung analysieren und mögliche Defizite aufzeigen.
VII. „Reformbewegung“ bis zum 31.12.1998: Hier würde die Entwicklung von Reformansätzen und -versuchen zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit vor dem Jahr 1999 beschrieben werden. Dies könnte politische Diskussionen, Gesetzesinitiativen und die Herausforderungen bei deren Umsetzung beinhalten.
VIII. Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998: Dieses Kapitel würde die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Problematik der Scheinselbständigkeit untersuchen und analysieren, wie es versuchte, die bestehenden Lücken zu schließen.
IX. Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999: Dieser Abschnitt würde den Fokus auf das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit legen und dessen Einfluss auf die rechtliche Behandlung von Scheinselbständigkeit analysieren. Es würde die beabsichtigten Ziele und die tatsächlichen Ergebnisse beleuchten.
Schlüsselwörter
Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungsrecht, § 7 Abs. 4 SGB IV, Gewerbeordnung, Abhängigkeit, Selbständigkeit, Arbeitnehmerrechte, Sozialversicherung, Rechtsprechung, Reform, Gesetzgebung.
FAQ: Seminararbeit zur Scheinselbständigkeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Scheinselbständigkeit. Sie beleuchtet die rechtliche Relevanz, insbesondere im Kontext des § 7 Abs. 4 SGB IV, analysiert Ursachen und Probleme und zeichnet die historische Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen nach.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung der Scheinselbständigkeit, die Analyse ihrer Ursachen und Auswirkungen, die historische Entwicklung der Rechtslage, die Rolle der Gewerbebehörden bei der Erkennung und die Bewertung der rechtlichen Regelungen zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist in zehn Kapitel gegliedert: Vorbemerkung, Begriff der Scheinselbständigkeit, Ursprung der Scheinselbständigkeit, Ursachen der Scheinselbständigkeit, Probleme der Scheinselbständigkeit, Sozialrechtliche Situation von 1977 bis 1998, „Reformbewegung“ bis 1998, Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998, Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999 und eine kritische Stellungnahme.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Begriff der Scheinselbständigkeit zu klären, die Ursachen und Probleme zu analysieren und die historische Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen nachzuzeichnen. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung des § 7 Abs. 4 SGB IV im Umgang mit Scheinselbständigkeit.
Welche Rolle spielt § 7 Abs. 4 SGB IV in der Seminararbeit?
§ 7 Abs. 4 SGB IV steht im Mittelpunkt der rechtlichen Betrachtung. Die Arbeit untersucht dessen Bedeutung im Kontext der Scheinselbständigkeit, ohne jedoch eine umfassende Darstellung des Paragraphen selbst zu liefern.
Wie wird die historische Entwicklung der Scheinselbständigkeit dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Rechtslage zur Scheinselbständigkeit von 1977 bis 1999, inklusive der "Reformbewegung" vor 1999 und den Auswirkungen der Gesetze zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Förderung der Selbständigkeit.
Welche Rolle spielen die Gewerbebehörden?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Gewerbebehörden bei der Erkennung von Scheinselbständigkeit und deren Möglichkeiten und Grenzen bei der Prüfung von Gewerbeanzeigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Scheinselbständigkeit, Sozialversicherungsrecht, § 7 Abs. 4 SGB IV, Gewerbeordnung, Abhängigkeit, Selbständigkeit, Arbeitnehmerrechte, Sozialversicherung, Rechtsprechung, Reform, Gesetzgebung.
Welche Vorbemerkung macht die Seminararbeit?
Die Vorbemerkung beschreibt die Erfahrungen des Autors mit der Problematik der Scheinselbständigkeit in seiner Tätigkeit bei einer höheren Gewerbebehörde und hebt die Unsicherheit der Behörden im Umgang mit dem Thema und die begrenzten Möglichkeiten zur Bekämpfung hervor. Die Einführung des § 14 Abs. 5 Nr. 7 GewO wird als Ansatz zur Verbesserung erwähnt.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Seminararbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die jeweiligen Inhalte kurz und prägnant beschreibt und den Fokus und die Schwerpunkte der einzelnen Abschnitte erläutert.
- Citation du texte
- Thomas Gabriel (Auteur), 2000, Die Problematik der Scheinselbständigkeit und deren Lösung durch § 7 Abs. 4 SGB IV, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53843