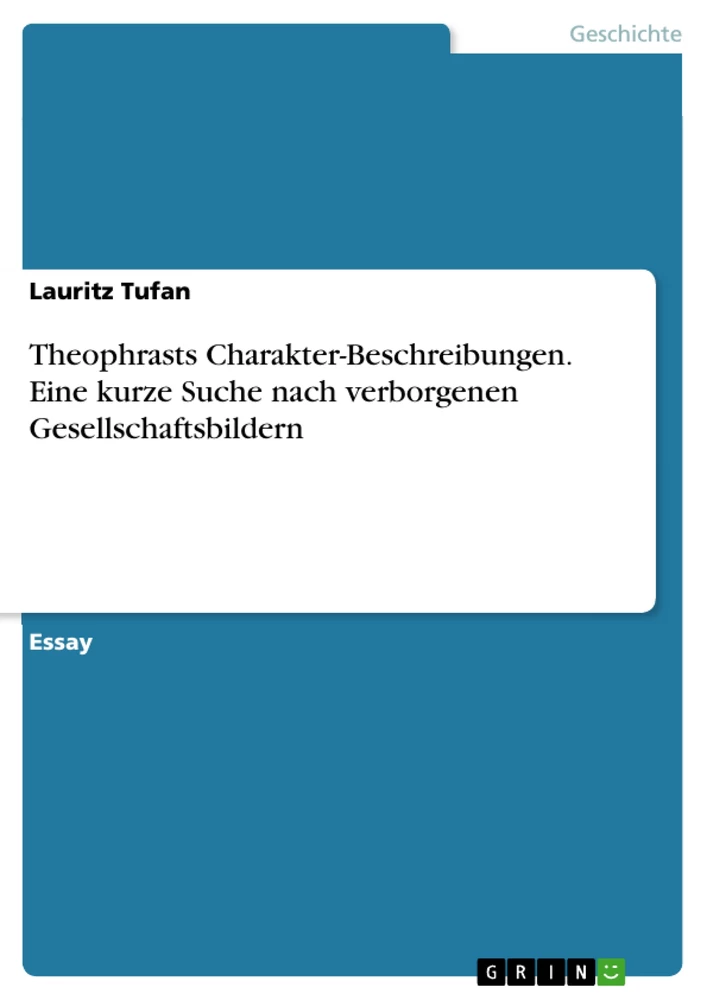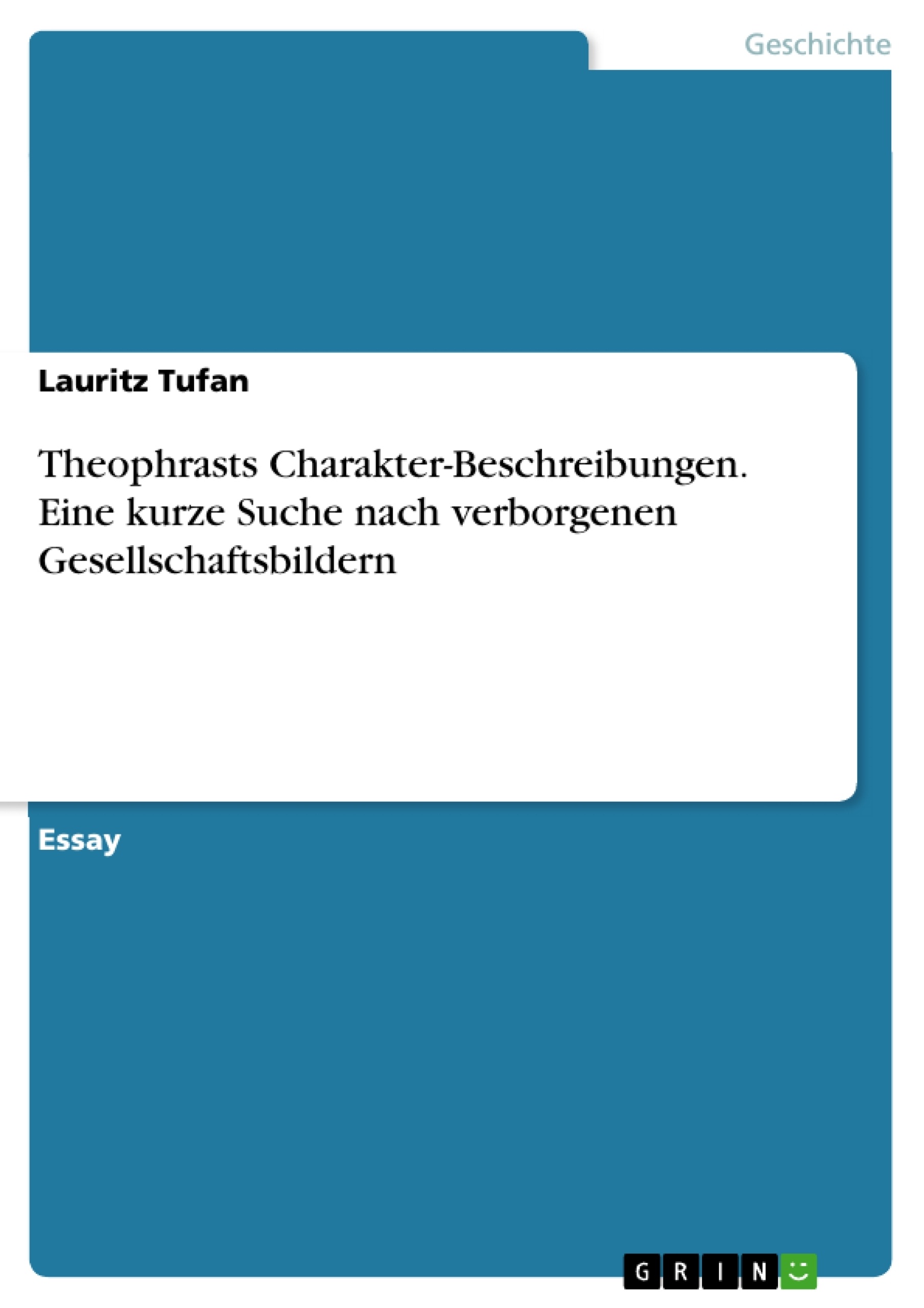Dieser Essay soll anhand Charakter-Beschreibungen Theophrasts deren sozialgeschichtlichen Quellenwert analysieren und die verborgene Kritik und Gesellschaftsbilder der Bürger Athens in der klassischen Zeit aufdecken. Insbesondere der Aspekt der gesellschaftlichen Unterdrückung durch zum Beispiel Sklaverei und der Funktion der Aufteilung in Gruppierungen soll hierbei untersucht werden.
Die 'Charaktere' des griechischen Schriftstellers Theophrast zeigen bestimmte Eigenschaften herausstechender Charakterbilder, die sinnbildlich als Spiegel der attischen Gesellschaft fungieren. Die Frage, die in diesem Essay beantwortet werden soll, lautet, inwiefern Theophrasts Quelle als sozialgeschichtliche Quelle geeignet ist. Einige der Charakterbilder verweisen auf eine gezielte Gesellschaftskritik Theophrasts, welche beispielhaft durch die Überspitzte Darstellung der Charaktere das Bild einer teils verbrecherischen und egoistischen Gemeinschaft zeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Quellen
- Die Darstellung der Charaktere
- Der Abergläubische
- Der Kleinliche
- Der Geizige
- Der Eitle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den sozialgeschichtlichen Quellenwert von Theophrasts Charakteren. Die zentrale Frage ist, inwieweit diese Charakterbeschreibungen einen Einblick in die athenische Gesellschaft der klassischen Zeit bieten und welche Gesellschaftskritik darin verborgen ist. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Charaktere, um die dargestellte soziale Wirklichkeit zu beleuchten.
- Analyse des sozialgeschichtlichen Quellenwerts von Theophrasts Charakteren
- Aufdeckung der Gesellschaftskritik in den Charakterbeschreibungen
- Untersuchung der Darstellung von Armut und Unterdrückung (z.B. Sklaverei)
- Bedeutung der sozialen Gruppierungen und deren Funktion
- Vergleich der Charaktere mit Beobachtungen aus anderen Quellen (Aristophanes)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfrage: Inwiefern sind Theophrasts Charaktere als sozialgeschichtliche Quellen geeignet? Es wird die These aufgestellt, dass die überspitzten Darstellungen der Charaktere eine Gesellschaftskritik beinhalten und ein Bild einer teils verbrecherischen und egoistischen Gemeinschaft zeichnen. Die ausgewählten Charaktere (Abergläubischer, Kleinlicher, Geiziger, Eitler) werden vorgestellt und der Bezug zu der These von Winfried Schmitz über die Armut in Athen hergestellt. Die Einleitung legt den Fokus der Analyse auf die Aufdeckung der verborgenen Kritik und Gesellschaftsbilder in den Charakterbeschreibungen.
Aufbau der Quellen: Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau der Quellen bei Theophrast. Es wird die steckbriefartige Struktur der Charakterbeschreibungen hervorgehoben, die aus einer einleitenden These und einer detaillierten Beschreibung des Verhaltens bestehen. Die einleitenden Angaben werden als subjektiver und anklagender, die Beschreibungen selbst hingegen als objektiv und detailliert beschrieben. Der objektive Beobachter Theophrast steht im Gegensatz zu den subjektiven, anklagenden einleitenden Angaben.
Die Darstellung der Charaktere: Dieses Kapitel analysiert einzelne Charaktere. Es wird die Darstellung des "Abergläubischen" mit seiner übertriebenen Religiosität und der damit verbundenen Kritik an übernatürlichen und übertriebenen religiösen Praktiken untersucht. Die Analyse des "Kleinlichen" beleuchtet dessen extreme Sparsamkeit und Ordnungszwang auf Kosten anderer, insbesondere seiner Sklaven. Der "Geizige" wird im Vergleich zum "Kleinlichen" differenziert. Während beide sparsam sind, zeigt der Geizige einen ausgeprägten Egoismus und entmenschlicht seine Sklaven durch karge Mahlzeiten und schwere Arbeit, wobei sein Egoismus sich sogar auf sein Umfeld ausweitet. Die Analyse betont die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem "Kleinlichen" und dem "Geizigen" und ihren Bezug zu den beschriebenen Lebensumständen armer Athener, einschließlich möglicher Folgen wie Diebstahl.
Schlüsselwörter
Theophrast, Charaktere, Athen, klassische Zeit, Sozialgeschichte, Gesellschaftskritik, Armut, Sklaverei, Religion, Aberglaube, Kleinlichkeit, Geiz, Egoismus, Patriarchat, Oikos.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Theophrasts Charakteren als sozialgeschichtliche Quellen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Charakterbeschreibungen des Theophrast als sozialgeschichtliche Quellen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Quellenwerts und der darin enthaltenen Gesellschaftskritik bezüglich der athenischen Gesellschaft der klassischen Zeit.
Welche Charaktere werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Charaktere: den Abergläubischen, den Kleinlichen, den Geizigen und den Eitlen. Diese Charaktere werden im Detail untersucht, um die dargestellte soziale Wirklichkeit zu beleuchten und Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit sind Theophrasts Charaktere als sozialgeschichtliche Quellen geeignet? Die Arbeit untersucht, ob und wie die Charakterbeschreibungen einen Einblick in die athenische Gesellschaft bieten und welche Gesellschaftskritik darin verborgen ist.
Welche These wird aufgestellt?
Die Arbeit vertritt die These, dass die überspitzten Darstellungen der Charaktere eine implizite Gesellschaftskritik beinhalten und ein Bild einer teils verbrecherischen und egoistischen Gemeinschaft zeichnen. Der Bezug zu der These von Winfried Schmitz über die Armut in Athen wird hergestellt.
Wie ist der Aufbau der Quellen bei Theophrast?
Die Charakterbeschreibungen bei Theophrast haben eine steckbriefartige Struktur. Sie bestehen aus einer einleitenden These (subjektiv und anklagend) und einer detaillierten Beschreibung des Verhaltens (objektiv und detailliert). Der objektive Beobachter Theophrast steht im Gegensatz zu den subjektiven, anklagenden einleitenden Angaben.
Wie werden die Charaktere analysiert?
Die Analyse der Charaktere untersucht deren Verhalten und Motive im Kontext der athenischen Gesellschaft. Es wird beispielsweise die übertriebene Religiosität des Abergläubischen, die extreme Sparsamkeit des Kleinlichen und der ausgeprägte Egoismus des Geizigen analysiert. Die Analyse berücksichtigt dabei auch die Lebensumstände armer Athener und mögliche Folgen wie Diebstahl.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben der Analyse der einzelnen Charaktere werden auch weitere Themen behandelt, wie die Darstellung von Armut und Unterdrückung (z.B. Sklaverei), die Bedeutung sozialer Gruppierungen und deren Funktion, sowie ein Vergleich der Charaktere mit Beobachtungen aus anderen Quellen (z.B. Aristophanes).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Theophrast, Charaktere, Athen, klassische Zeit, Sozialgeschichte, Gesellschaftskritik, Armut, Sklaverei, Religion, Aberglaube, Kleinlichkeit, Geiz, Egoismus, Patriarchat, Oikos.
- Citar trabajo
- Lauritz Tufan (Autor), 2018, Theophrasts Charakter-Beschreibungen. Eine kurze Suche nach verborgenen Gesellschaftsbildern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538573