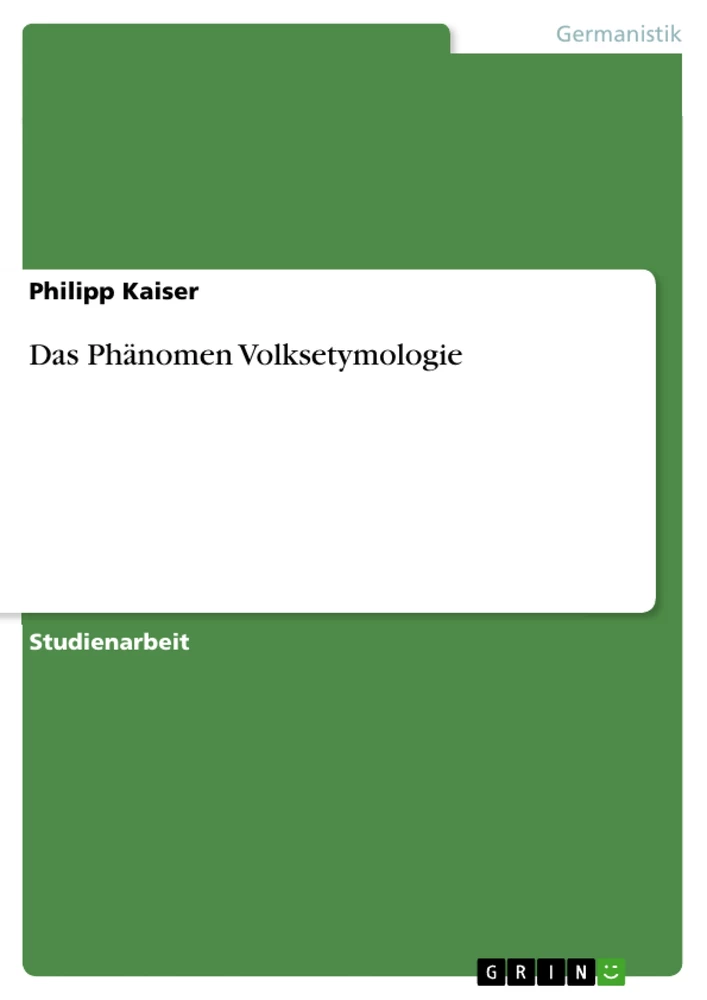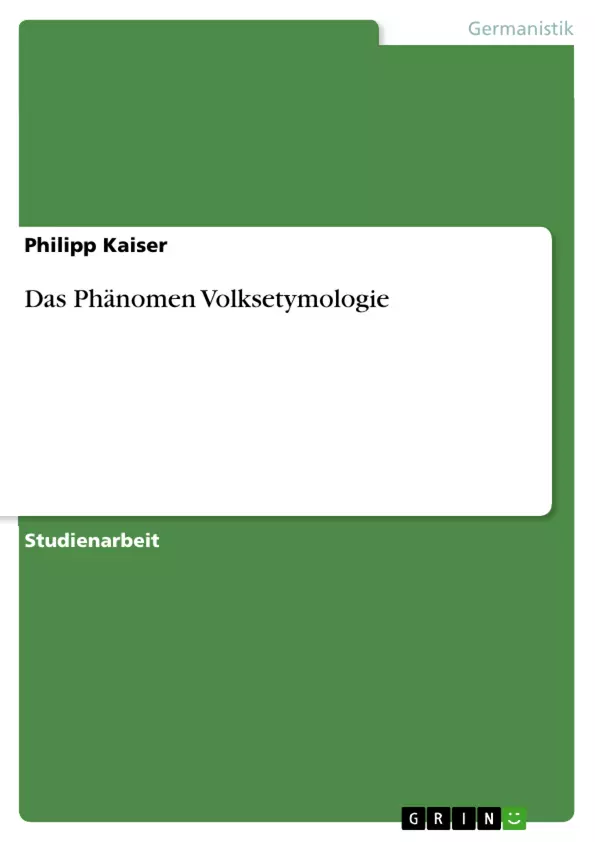Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die Begriffsbildung und dessen Abgrenzung und Definition geben. Zudem soll sie einen theoretischen Umriss der Entstehungsprozesse und -bedingungen für Volksetymologien liefern. Letztendlich soll der Terminus "Volksetymologie" unter Berücksichtigung der dargestellten Definition, seiner Abgrenzung und seiner Entstehungsprozesse und -bedingungen und in Hinblick auf seine kontrovers diskutierte Verwendung und Definition kritisch reflektiert werden.
"Es zieht wie Hechtsuppe" ist eine Redewendung der deutschen Sprache, dessen Bedeutung und Inhalt dem Sprachbenutzer klar und schlüssig ist. Was aber hat die "Hechtsuppe" in der Redewendung damit zu tun, dass den Sprachnutzer, der diese benutzt, eine starke Zugluft stört. Auch was ein "Maulwurf" ist, wie dieser aussieht, usw. weiß eigentlich jeder, aber warum er wirklich so heißt und woher der Begriff kommt ist für den Großteil der Sprachbenutzer unklar. Wie in den beiden einleitenden Beispielen klar wird, gibt es (Sprich-)Wörter, Phrasen und Redewendungen in der Verwendung der deutschen Sprache, die zwar jedem klar und geläufig sind, dessen Bestandteile und (vermeintliche) Herkunft für den Sprachbenutzer jedoch (teilweise) nur schwer einen Sinn ergeben. Man erwischt sich selber dabei diese Wörter irgendwie nach üblichen Wortbildungskriterien und
-ableitungen, nach vermeintlicher Logik und allgemeinem Sprach- und Weltwissen herzuleiten. Dies ist jedoch meistens ein unmögliches Unterfangen. Verantwortlich für die Entstehung solcher Wörter und Phrasen ist nämlich das Phänomen "Volksetymologie".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Phänomen Volksetymologie
- Begriffsfindung und -abgrenzung
- Die Entwicklung des Begriffs „Volksetymologie“
- Abgrenzung und Definition des Terminus Volksetymologie
- Entstehungsprozesse und Bedingungen für Volksetymologie
- Sekundäre Motivation
- Isolation
- Lautliche Ähnlichkeit
- Kritische Reflexion des Terminus Volksetymologie unter Berücksichtigung von Definition, Abgrenzung und Entstehungsprozessen und -bedingungen
- Begriffsfindung und -abgrenzung
- Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit hat zum Ziel, das Phänomen Volksetymologie umfassend zu beleuchten. Es soll ein Überblick über die Begriffsbildung und dessen Abgrenzung und Definition gegeben werden. Darüber hinaus wird ein theoretischer Rahmen für die Entstehungsprozesse und -bedingungen von Volksetymologie entwickelt. Schließlich soll der Terminus „Volksetymologie“ kritisch reflektiert werden, wobei Definition, Abgrenzung, Entstehungsprozesse und -bedingungen sowie die kontroverse Diskussion um seine Verwendung und Definition berücksichtigt werden.
- Begriffliche Entwicklung und Abgrenzung der Volksetymologie
- Theoretische Analyse der Entstehungsprozesse und -bedingungen von Volksetymologie
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Terminus „Volksetymologie“
- Historische Entwicklung des Begriffs „Volksetymologie“
- Kontroversen und verschiedene Perspektiven auf Volksetymologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Volksetymologie ein und präsentiert Beispiele aus der deutschen Sprache, die die Notwendigkeit einer genaueren Untersuchung dieses Phänomens verdeutlichen. Es wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt.
Kapitel 2 behandelt das Phänomen Volksetymologie im Detail. Es beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Volksetymologie“ und skizziert die Schwierigkeiten und Missverständnisse im Zusammenhang mit seiner Definition. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Volksetymologie im Laufe der Zeit vorgestellt und die Entstehungsprozesse und -bedingungen von Volksetymologie analysiert.
Schlüsselwörter
Volksetymologie, Begriffsentwicklung, Abgrenzung, Definition, Entstehungsprozesse, Sekundäre Motivation, Isolation, Lautliche Ähnlichkeit, kritische Reflexion, Sprachwissenschaft, Etymologie, Linguistik, Sprachwandel, Sprachgebrauch.
- Citation du texte
- Philipp Kaiser (Auteur), 2015, Das Phänomen Volksetymologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538668