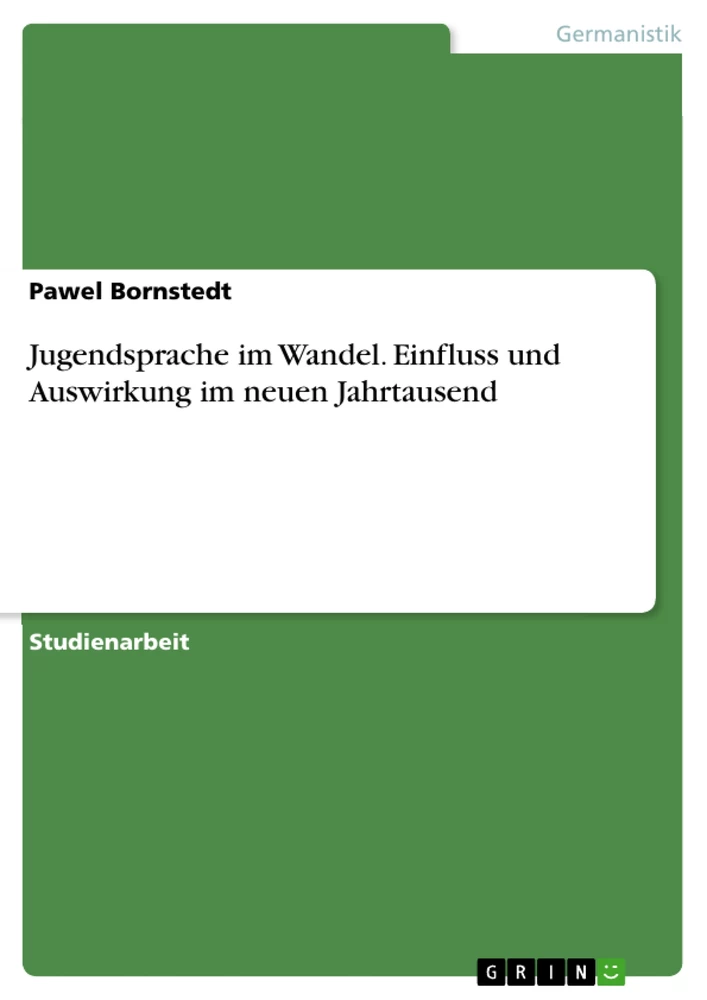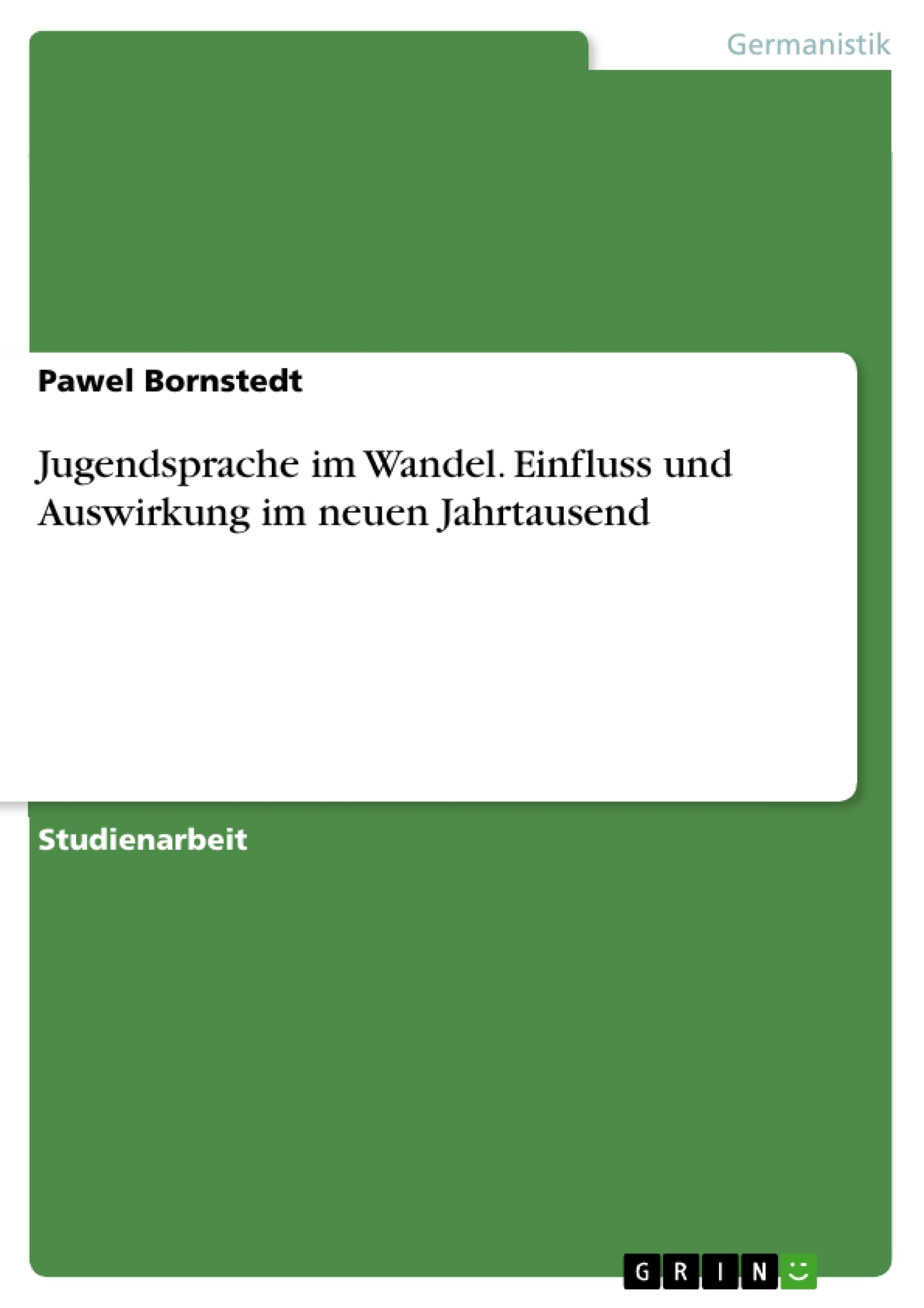Zugegeben, die Medienberichte über den sogenannten „Sprachverfall“ haben mittlerweile abgenommen, doch ganz ausgestorben sind sie immer noch nicht. Sprachkritikern wird dabei meist vorgeworfen, sie sähen bei den Jugendlichen die Ursache dafür. Meist wurde dabei der VDS (Verein Deutsche Sprache) als größter Kritiker dargestellt, jedoch hat selbst dieser die Argumente der Wissenschaft zur Kenntnis nehmen müssen. Diese spricht nämlich von einem wertneutralen Begriff des Sprachwandels. Bezüglich der Kohärenz mit der Jugendsprache lässt sich feststellen, dass diese als ein Motor des Sprachwandels betrachtet wird.
Insofern wird diese Arbeit an diesem öffentlichen Diskurs anknüpfen und die Frage klären, welche Faktoren auf die heutige Jugendsprache einwirken und an ausgewählten Aspekten die Tendenzen des Sprachwandels im 21. Jhd. schlussfolgern lassen. Die moderne Jugend ist dabei insofern außergewöhnlich, da sie sozusagen in die digitale Revolution hineingeboren wurde. Zur Verdeutlichung: Das iPhone wurde 2007 in Deutschland eingeführt. Die Kinder, die damals geboren wurden, werden in diesem Jahr 13, sprich Teenager. Von denen wiederum 97% solch ein Gerät besitzen und jeder zweite es bereits seit seiner Kindheit tat. Da neue Technik und Kulturwandel an sich schon relevante Teile des Motors für Sprachwandel sind, ist anzunehmen, dass sich, bedingt durch die digitale Revolution, der Sprachwandel umso deutlicher erkennen ließe.
Der Untersuchungsgegenstand, die Jugendsprache, ist komplex, weswegen sie zuerst im eigenen Kapitel analysiert wird und erläutert, inwiefern sie (für manche negative) Auswirkungen auf die Sprache haben soll. In diesem Zusammenhang werden darauffolgend jeweils die Faktoren der Digitalen Revolution, der Internationalisierung, des Wortschatzes und der Dialekte untersucht. Das Resultat wird abschließend im Fazit zusammengefasst und ein Ausblick formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Was ist Jugendsprache und was wird ihr vorgeworfen?
- III. Faktor Digitale Revolution
- 1
- 2
- IV. Faktor Internationalisierung
- V. Faktor Wortschatz
- VI. Faktor Dialekt
- VII. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die heutige Jugendsprache und analysiert dabei Tendenzen des Sprachwandels im 21. Jahrhundert. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der digitalen Revolution gewidmet, die als ein Schlüsselfaktor für den Wandel der Sprache betrachtet wird.
- Jugendsprache als Motor des Sprachwandels
- Die Rolle der digitalen Revolution
- Internationalisierung und ihre Auswirkungen auf die Sprache
- Wortschatzentwicklung und Sprachwandel
- Der Einfluss von Dialekten auf die Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachwandels ein und beleuchtet die öffentliche Debatte über den sogenannten „Sprachverfall“. Dabei wird die Jugendsprache als Motor des Sprachwandels betrachtet und die Bedeutung der digitalen Revolution für diesen Wandel hervorgehoben.
II. Was ist Jugendsprache und was wird ihr vorgeworfen?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Jugendsprache und analysiert die Kritik, die ihr häufig entgegengebracht wird. Dabei wird die Vielfältigkeit der Jugendsprache betont und die Tatsache, dass es keine einheitliche Jugendsprache gibt.
III. Faktor Digitale Revolution
Der Einfluss der digitalen Revolution auf die Jugendsprache steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Die rasante Entwicklung neuer Technologien und Kommunikationsformen hat die Sprache maßgeblich verändert.
IV. Faktor Internationalisierung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Internationalisierung für die Jugendsprache. Der zunehmende Kontakt mit anderen Sprachen und Kulturen hat einen Einfluss auf den Wortschatz und die Sprechweise junger Menschen.
V. Faktor Wortschatz
Das Kapitel untersucht die Entwicklung des Wortschatzes in der Jugendsprache. Dabei werden Veränderungen im Sprachgebrauch und die Entstehung neuer Wörter analysiert.
VI. Faktor Dialekt
Der Einfluss von Dialekten auf die Jugendsprache wird in diesem Kapitel beleuchtet. Dialektale Besonderheiten spielen eine wichtige Rolle für die sprachliche Entwicklung junger Menschen.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachwandel, Digitale Revolution, Internationalisierung, Wortschatz, Dialekt, Sprachkritik, Sprachverfall, Medien, Kommunikation, Technik, Kulturwandel.
Häufig gestellte Fragen
Ist Jugendsprache tatsächlich für einen „Sprachverfall“ verantwortlich?
Wissenschaftlich gesehen wird Jugendsprache eher als wertneutraler Motor des Sprachwandels betrachtet. Die Arbeit zeigt, dass Kritik am „Sprachverfall“ oft die natürliche Weiterentwicklung der Sprache durch neue Generationen übersieht.
Welchen Einfluss hat die digitale Revolution auf die Sprache Jugendlicher?
Durch Technologien wie das iPhone und soziale Medien hat sich der Sprachwandel beschleunigt. Neue Kommunikationsformen prägen den Wortschatz und die Art, wie Jugendliche Informationen austauschen.
Welche Rolle spielt die Internationalisierung in der Jugendsprache?
Der zunehmende Kontakt mit anderen Kulturen und Sprachen (insbesondere Englisch) führt zur Aufnahme neuer Wörter und Wendungen in den Alltagswortschatz junger Menschen.
Gibt es „die eine“ Jugendsprache?
Nein, die Arbeit betont die Vielfältigkeit der Jugendsprache. Sie ist kein einheitliches Gebilde, sondern variiert stark je nach Gruppe, Region und sozialem Umfeld.
Beeinflussen Dialekte die heutige Jugendsprache noch?
Ja, dialektale Besonderheiten spielen weiterhin eine wichtige Rolle und fließen oft in die spezifische Ausdrucksweise Jugendlicher ein, was zur regionalen Identitätsbildung beiträgt.
- Quote paper
- Pawel Bornstedt (Author), 2019, Jugendsprache im Wandel. Einfluss und Auswirkung im neuen Jahrtausend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538672