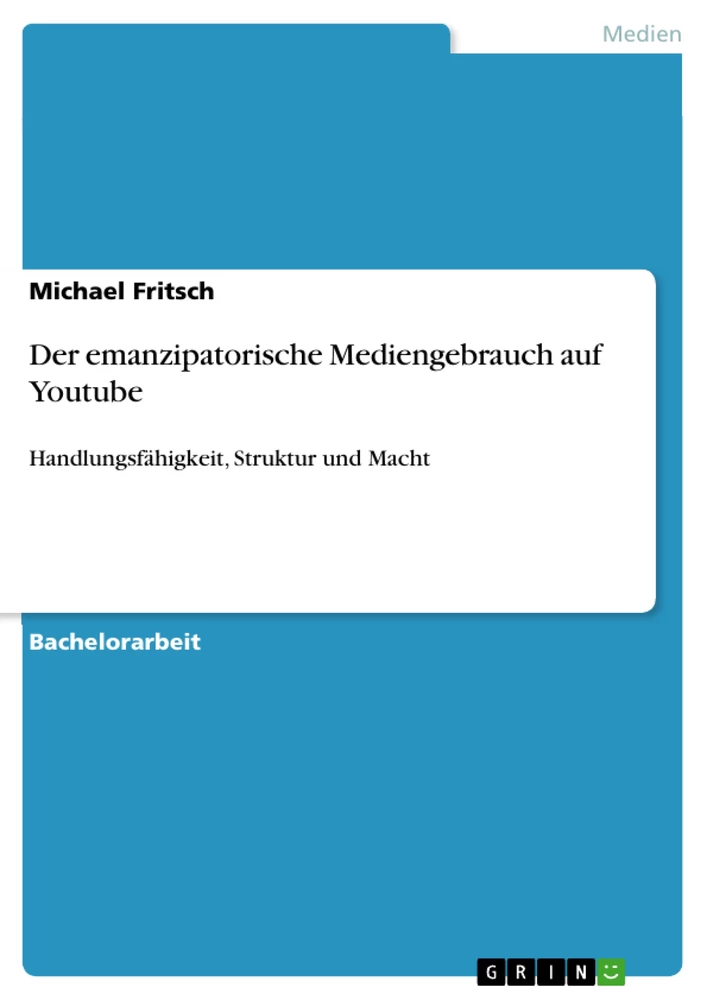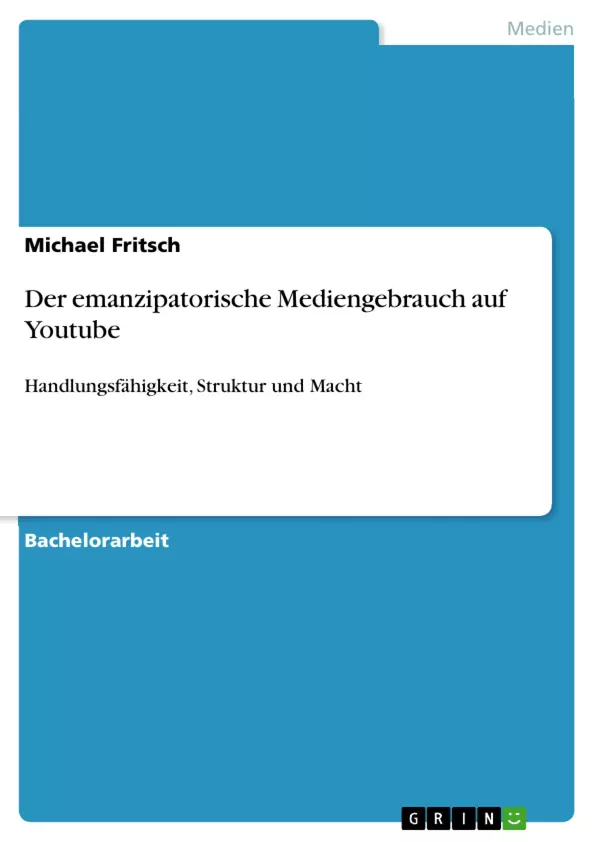Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang und dem Produzieren von Medien im Alltag. Die forschungsleitende Frage lautet, ob und inwiefern Hans Magnus Enzensbergers Konzept des emanzipatorischen Mediengebrauchs auf der sozialen Medienplattform YouTube umgesetzt werden kann. Bevor versucht wurde, diese Frage zu beantworten, wurde ein kurzer Abriss von Theorien, die sich mit der Handlungsfähigkeit von Subjekten befassen, verfasst. Folglich wurde die Architektur von sozialen Medien beleuchtet, Konzepte und Vorstellungen der new media studies eingeführt, um anschließend die Forschungsfrage zu beantworten.
Die Ubiquität der digitalen Technologien und das Aufkommen des Web 2.0 führen zu einer neuen Medienlandschaft. Die Mediensysteme mit ihrem professionellen Inhalt stellen nun kein Monopol mehr dar, sondern inkludieren diverse Kommunikationsplattformen und user-generated content.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Zu den Theorien
- 2.1) Enzensbergers Baukasten und das digitale Evangelium
- 2.2) Die Definition des emanzipatorischen Mediengebrauchs
- 2.3) Participatory culture und convergence media
- 2.4) De Certeaus Kunst des Handelns
- 2.5) Die semiologische Kriegsführung und Understanding Popular Culture
- 3.) Die Architektur der Medien
- 4.) Die Umsetzung des emanzipatorischen Mediengebrauchs
- 4.1.) Das zentralisierte Programm
- 4.2) Anteilnahme, Feedback und Interaktion
- 4.4) Spezialistentum oder Kollektivismus
- 4.5) Über die opaken Algorithmen
- 5.) Kontrolle durch Eigentum oder gesellschaftliche Kontrolle
- 6.) Das fehlende Klassenbewusstsein
- 7.) Zum Fazit (ein Portmanteau)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob und inwiefern Hans Magnus Enzensbergers Konzept des emanzipatorischen Mediengebrauchs auf der Social-Media-Plattform YouTube umgesetzt werden kann. Die Arbeit stellt die Frage, ob die von Enzensberger im späten 20. Jahrhundert postulierte Möglichkeit, elektronische Medien zu emanzipieren, im Kontext des 21. Jahrhunderts und der digitalen Ökonomie noch relevant ist.
- Die Relevanz und Aktualität von Enzensbergers Medientheorie im Kontext von YouTube.
- Die Analyse der Struktur und Funktionsweise von YouTube im Hinblick auf emanzipatorischen Mediengebrauch.
- Die Rolle von Machtverhältnissen und ökonomischen Interessen in der digitalen Medienlandschaft.
- Die Möglichkeiten und Grenzen des emanzipatorischen Mediengebrauchs auf YouTube.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des emanzipatorischen Mediengebrauchs ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Kapitel 2 analysiert verschiedene Theorien, die für das Verständnis des emanzipatorischen Mediengebrauchs relevant sind, darunter Enzensbergers Medientheorie, de Certeaus Handlungstheorie sowie die Konzepte der Participatory Culture und Convergence Media.
Kapitel 3 befasst sich mit der Architektur der Medien, wobei die Besonderheiten der digitalen Medienlandschaft im Vergleich zu traditionellen Medienformen hervorgehoben werden. Kapitel 4 analysiert die Umsetzung des emanzipatorischen Mediengebrauchs auf YouTube, wobei die Aspekte zentralisiertes Programm, Feedback und Interaktion sowie Spezialistentum und Kollektivismus näher beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Emanzipatorischer Mediengebrauch, YouTube, Social Media, Participatory Culture, Convergence Media, Enzensberger, de Certeau, Digitale Ökonomie, Machtverhältnisse, Ökonomische Interessen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "emanzipatorischer Mediengebrauch" nach Enzensberger?
Es beschreibt die Idee, dass Mediennutzer nicht nur passive Empfänger sind, sondern durch Interaktion, Feedback und eigene Produktion zu aktiven Gestaltern der Medienlandschaft werden.
Lässt sich dieses Konzept auf YouTube übertragen?
Die Arbeit untersucht, ob YouTube durch User-Generated Content eine Umsetzung von Enzensbergers Theorie darstellt oder ob ökonomische Interessen und Algorithmen die Emanzipation einschränken.
Welche Rolle spielen Algorithmen bei der Mediennutzung auf YouTube?
Die Arbeit beleuchtet "opaque Algorithmen" als Kontrollinstrumente, die den emanzipatorischen Spielraum der Nutzer beeinflussen können.
Was versteht man unter "Participatory Culture" im Kontext sozialer Medien?
Es bezeichnet eine Kultur, in der die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten verschwimmen und die aktive Teilhabe der Nutzer im Vordergrund steht.
Werden Machtverhältnisse durch YouTube wirklich demokratisiert?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob YouTube gesellschaftliche Kontrolle ermöglicht oder ob die Kontrolle weiterhin bei den Eigentümern der Plattform und deren wirtschaftlichen Interessen liegt.
- Citation du texte
- Michael Fritsch (Auteur), 2015, Der emanzipatorische Mediengebrauch auf Youtube, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538726