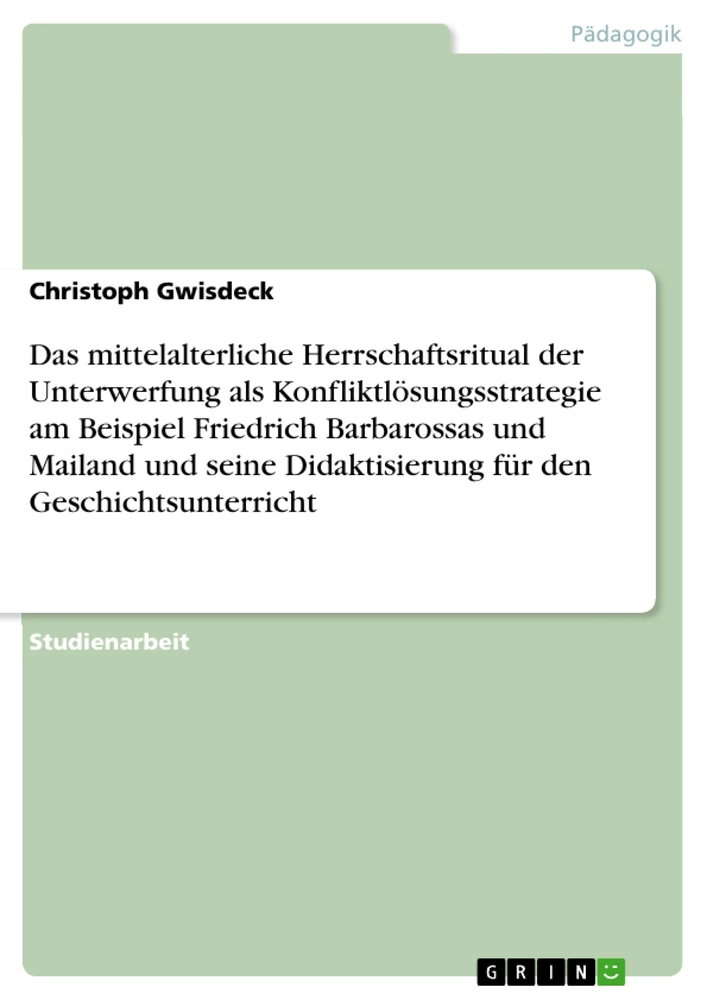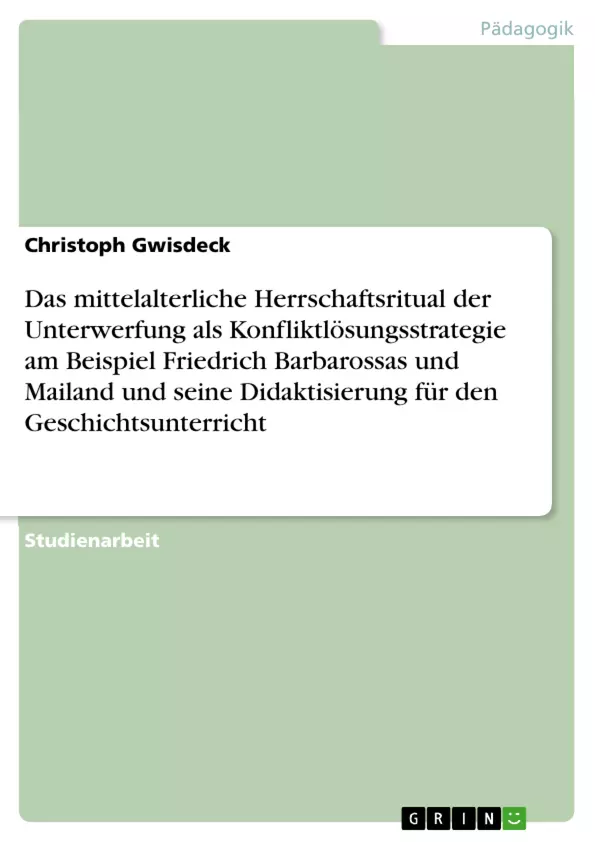Der in der vorliegenden Arbeit thematisierte Konflikt zwischen dem römisch-deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa und der lombardischen Kommune Mailand endete nach zwei deditiones, also Unterwerfungen, der Mailänder Bürger und der anschließenden Zerstörung der Kommune. Diese wiederholte Unterwerfung der Mailänder ist beispiellos. Innerhalb dieses Konfliktes kam es zu einer Vielzahl von rituellen Handlungen, die den Machtanspruch Friedrichs I und die Demonstration seiner Macht eindrucksvoll versinnbildlichten. Im Vordergrund stehen die beiden deditiones, die ihrerseits wiederum von rituellen Handlungen geprägt waren. Die Quellenlage für diesen Konflikt und insbesondere für das Ritual der Unterwerfung ist sehr günstig, sodass die Quellen sich in vielen Aspekten gleichen oder sich gegenseitig ergänzen.
Zwei zentrale Aspekte der mittelalterlichen Lebenswelt waren die Herrschaftsausübung der Kaiser, Könige und anderer Herrscher sowie die ritualisierten Handlungsformen, die besonders in der Herrschaftsausübung und –präsentation Ausdruck gefunden haben. Beide Aspekte werden innerhalb des Konflikts zwischen Friedrich I. und Mailand deutlich. Auf Basis der guten Quellenlage lassen sich der Konflikt und die Handlungen gut rekonstruieren, sodass sich die Auseinandersetzung mit den Themen für den Geschichtsunterricht besonders eignet.
Einer Einordnung des Themas in den Kernlehrplan folgt die Entwicklung eines Themas für den Geschichtsunterricht und der damit verbundenen Erstellung einer Leitfrage. Bei der Entwicklung des Themas und einer historischen Fragestellung für den Geschichtsunterricht habe ich mich sowohl an das Relevanzmodell von Dirk Urbach als auch an das Kapitel „Die Konstruktion eines Themas“ aus der Monographie von Jelko Peters gehalten. Dieses Kapitel endet mit einer möglichen Leitfrage für die Unterrichtseinheit. Daraufhin wird ein Lernarrangement entworfen, innerhalb dessen zunächst ein geschichtsdidaktischer Zugriff gewählt wird, der sich für das oben genannte Thema anbietet und mit dem sich die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen sollen. Im darauf folgenden Abschnitt werden die Voraussetzungen, die die Schüler für das Lernarrangement mitbringen müssen, erläutert, das Material zur Erarbeitung des Thema vorgestellt und die Lernpotentiale, die das Lernarrangement in sich trägt und die von den Schülern erreicht werden sollen, hervorgehoben. Anschließend werden die Ergebnisse der Arbeit in einem Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung des Themas in den Kernlehrplan
- 3. Thema und Fragestellung
- 4. Entwicklung eines Lernarrangements
- 4.1 Voraussetzungen für die Schüler
- 4.2 Materialien für das Lernarrangement
- 4.3 Lernpotenziale der Schüler
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Mailand, insbesondere die wiederholte Unterwerfung Mailands als Konfliktlösungsstrategie. Ziel ist die Entwicklung eines Lernarrangements für den Geschichtsunterricht, welches die mittelalterlichen Herrschaftsrituale und Konfliktlösungsmechanismen anhand dieses Beispiels didaktisch aufbereitet.
- Mittelalterliche Herrschaftsrituale
- Konfliktlösung im Mittelalter
- Die deditio als Konfliktlösungsstrategie
- Der Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Mailand
- Didaktische Aufbereitung historischer Themen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Mailand ein, der durch zwei Unterwerfungen der Mailänder Bürger gekennzeichnet war. Sie betont die reichhaltige Quellenlage und die Eignung des Themas für den Geschichtsunterricht. Die Arbeit gliedert sich in die Einordnung des Themas in den Kernlehrplan, die Entwicklung einer Leitfrage, den Entwurf eines Lernarrangements mit Beschreibung der Voraussetzungen für die Schüler, der Materialien und der Lernpotenziale, und schließt mit einem Fazit. Die Bedeutung ritualisierter Handlungen in der mittelalterlichen Herrschaftsausübung und -präsentation wird hervorgehoben, ebenso wie die Relevanz des Konflikts für die Untersuchung von Konfliktlösungsstrategien.
2. Einordnung des Themas in den Kernlehrplan: Dieses Kapitel ordnet das Thema „Ritual der Unterwerfung am Beispiel Kaiser Friedrich Barbarossas und Mailand“ in den Kernlehrplan Gymnasium (G8) für die Sekundarstufe I, Jahrgangstufen 5/6, ein. Es wird im Inhaltsfeld 4 „Europa im Mittelalter“ verortet, welches die Formen politischer Teilhabe im römisch-deutschen Reich umfasst. Der Konflikt zwischen Mailand und Barbarossa, mit der Unterdrückung des Strebens Mailands nach Autonomie, wird als Beispiel für Herrschaftsausübung, -demonstration und Konfliktlösungsstrategien des Kaisers dargestellt. Die detaillierten Quellenbeschreibungen der Unterwerfungen eignen sich als Einführung in die Arbeit mit Textquellen in der Sekundarstufe I.
3. Thema und Fragestellung: Dieses Kapitel unterstreicht die curriculare Relevanz des Themas. Es fokussiert auf herrschaftliche Rituale als zentralen Bestandteil mittelalterlicher Herrschaftsausübung und -präsentation, sowie auf politische Konflikte und Krisen zwischen Kaiser und anderen Herrschern. Es formuliert zentrale Fragen: Was sind Rituale und warum hatten sie im Mittelalter einen hohen Stellenwert? Wie präsentierte ein Kaiser seine Macht? Wie lösten Kaiser Konflikte? Warum wurde Mailand zweimal unterworfen? Wie sah eine solche Unterwerfung aus? Die Kapitel betonen die Wichtigkeit der rituellen Handlungen im Kontext der Machtdemonstration und -ausübung des Kaisers und verknüpfen dies mit der Analyse politischer Konflikte.
Schlüsselwörter
Friedrich Barbarossa, Mailand, Mittelalter, Herrschaftsritual, Unterwerfung (Deditio), Konfliktlösung, Geschichtsdidaktik, Lernarrangement, Machtdemonstration, politische Partizipation, Autonomie, römisch-deutsches Reich, Kernlehrplan.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Lernarrangement Kaiser Friedrich Barbarossa und Mailand
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument beschreibt die Entwicklung eines Lernarrangements für den Geschichtsunterricht zum Thema des Konflikts zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Mailand. Es konzentriert sich insbesondere auf die wiederholte Unterwerfung Mailands als Konfliktlösungsstrategie und die didaktische Aufbereitung mittelalterlicher Herrschaftsrituale und Konfliktlösungsmechanismen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Mittelalterliche Herrschaftsrituale, Konfliktlösung im Mittelalter, die „Deditio“ als Konfliktlösungsstrategie, den Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Mailand, die didaktische Aufbereitung historischer Themen für den Unterricht, Einordnung des Themas in den Kernlehrplan und die Entwicklung eines konkreten Lernarrangements inklusive benötigter Materialien und Lernpotenziale der Schüler.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, die Einordnung des Themas in den Kernlehrplan, die Definition der Thematik und Fragestellung, die detaillierte Beschreibung des entwickelten Lernarrangements (inklusive Voraussetzungen, Materialien und Lernpotenziale) und ein abschließendes Fazit. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Für welche Jahrgangsstufe ist das Lernarrangement konzipiert?
Das Lernarrangement ist für die Sekundarstufe I, Jahrgangstufen 5/6, des Gymnasiums (G8) konzipiert und ordnet sich in das Inhaltsfeld 4 „Europa im Mittelalter“ des Kernlehrplans ein.
Welche zentralen Fragen werden im Dokument behandelt?
Zentrale Fragen sind: Was sind Rituale und warum hatten sie im Mittelalter einen hohen Stellenwert? Wie präsentierte ein Kaiser seine Macht? Wie lösten Kaiser Konflikte? Warum wurde Mailand zweimal unterworfen? Wie sah eine solche Unterwerfung aus?
Welche Quellen werden genutzt?
Das Dokument erwähnt eine reichhaltige Quellenlage zum Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Mailand, die sich insbesondere für die Arbeit mit Textquellen in der Sekundarstufe I eignet. Konkrete Quellenangaben werden jedoch nicht im Detail aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument am besten?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Barbarossa, Mailand, Mittelalter, Herrschaftsritual, Unterwerfung (Deditio), Konfliktlösung, Geschichtsdidaktik, Lernarrangement, Machtdemonstration, politische Partizipation, Autonomie, römisch-deutsches Reich, Kernlehrplan.
Welches Fazit zieht das Dokument?
Das Fazit wird im Dokument nicht explizit zusammengefasst. Es ist jedoch ersichtlich, dass das Dokument ein didaktisch aufbereitetes Lernarrangement zum Thema des Konflikts zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Mailand liefert, das die mittelalterlichen Herrschaftsrituale und Konfliktlösungsmechanismen im Unterricht thematisiert.
- Quote paper
- Christoph Gwisdeck (Author), 2017, Das mittelalterliche Herrschaftsritual der Unterwerfung als Konfliktlösungsstrategie am Beispiel Friedrich Barbarossas und Mailand und seine Didaktisierung für den Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538751