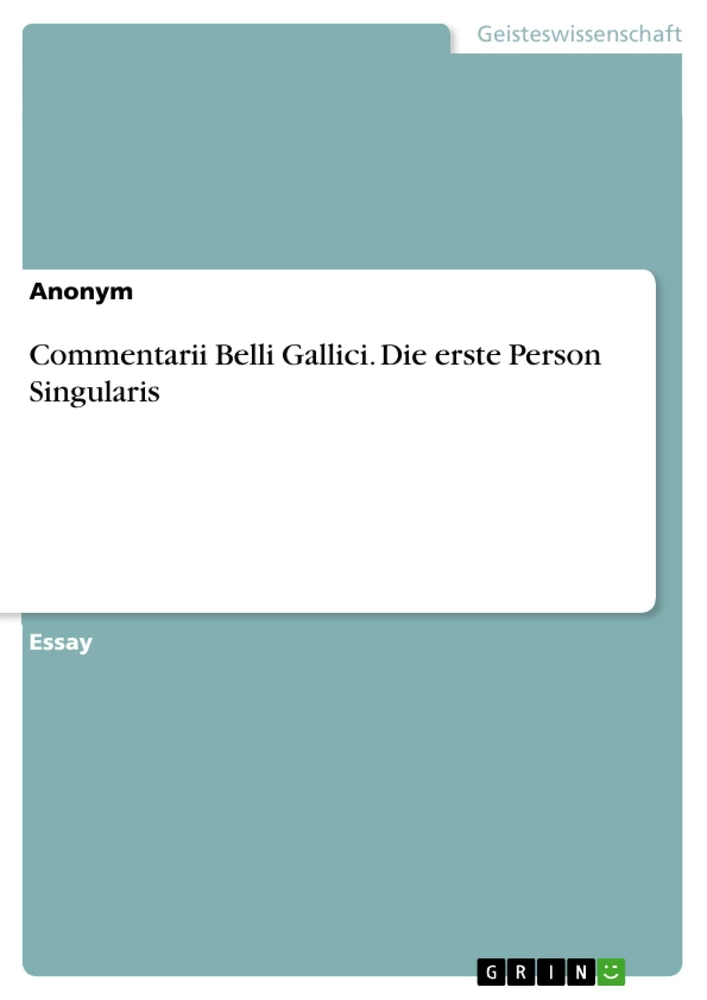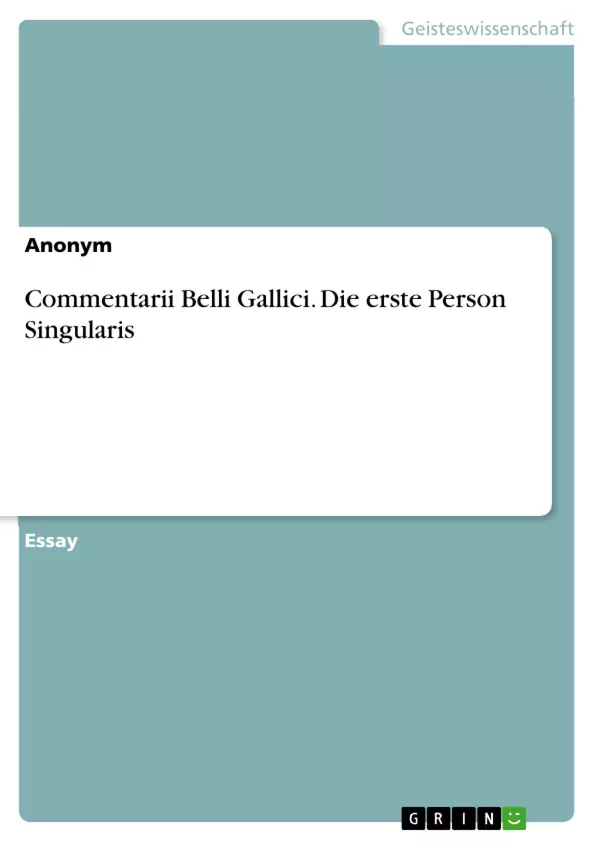C. Julius Caesar schreibt als sein eigener Historiker, als ein Mann, der über den Gegenstand gut informierter ist und diesen Gegenstand aus kühler Distanz heraus darstellt.
Dafür verwendet er in den Commentarii überwiegend die dritte Person Singularis, wenn er von sich spricht - selbst Cicero sprach in einem bruchstückhaft erhaltenen Commentarius von sich in der dritten Person. Dies soll im folgenden Text untersucht werden.
J. E. Reijgwart argumentiert, dass es wirkt, als ob nicht Caesar persönlich spricht und schreibt, sondern vielmehr, als ob ein "Unbekannter" zwischen dem Autor und der historischen Figur Caesar eingeschoben wird, der die Rolle des Erzählers übernimmt. Die Erzählperspektive im Bellum Gallicum erscheint ambivalent, da sowohl heterodiegetische als auch homodiegetische Elemente des Erzählens vorhanden sind. Dies bedeutet, dass der Erzähler zuweilen mit der Handlungsperson Caesar identisch ist, sich dann aber wieder von ihr unterscheidet.
Obwohl Caesar seine subjektiven Gefühle und Werturteile zurückhält, um einen objektiven Erzählton beizubehalten, schreibt er dennoch als Miterlebender, der aktiv am Geschehen teilnimmt. Caesar verwandelt den Leser in mehr als nur einen passiven Beobachter der Ereignisse, sondern in einen aktiven Teilnehmer, indem er die Geschehnisse sowohl aus der Perspektive eines Miterlebenden als auch in historischer Genauigkeit darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Die erste Person Singularis in den Commentarii Belli Gallici
- Der „Unbekannte” Erzähler
- Caesar und Thukydides
- Caesar und Xenophon
- Vergleich mit Scaurus und Rutilius Rufus
- Caesar und die Konstruktion des Erzählers
- Caesar und der Leser
- Caesar und die objektive Größe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Verwendung der ersten Person Singularis in Caesars Commentarii Belli Gallici und untersucht die Rolle des Erzählers. Die Analyse befasst sich mit Caesars Darstellungsform im Vergleich zu anderen historischen Schriften und beleuchtet die Intention hinter der Verwendung des "unbekannten" Erzählers.
- Die Verwendung der ersten Person Singularis in Caesars Werk
- Der Einfluss von Thukydides und Xenophon auf Caesars Darstellungsform
- Die Konstruktion des "unbekannten" Erzählers und seine Funktion
- Die Intentionen hinter Caesars Wahl der Darstellungsform
- Die Wirkung des Erzählens auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer Untersuchung der ersten Person Singularis in Caesars Commentarii Belli Gallici und stellt fest, dass Caesar die dritte Person Singularis bevorzugt, um über sich selbst zu sprechen. Dies führt zu der Annahme, dass ein "unbekannter" Erzähler in das Geschehen eingeschoben wird.
- Die Analyse beleuchtet die Ambivalenz des Erzählens im Bellum Gallicum, das sowohl heterodiegetische als auch homodiegetische Elemente aufweist. Caesar drückt zwar sein subjektives Gefühl und Urteil zurück, um einen objektiven Erzählton zu bewahren, jedoch lässt er dennoch als Miterlebender seine Gefühle durchblicken.
- Der Text vergleicht Caesars Darstellungsform mit denjenigen von Thukydides und Xenophon. Beide Autoren verwenden die dritte Person Singularis, jedoch zeigt sich bei ihnen deutlich die Identität des Autors als Handlungsperson. Caesar hingegen behält den Erzähler als "unbekanntes" Element.
- Der Text führt den Leser zu der Erkenntnis, dass der Erzähler in Caesars Werk ein "Schatten" bleibt, dessen Identität zwar philologisch erschließbar ist, aber niemals explizit genannt wird. Dies erzeugt den Effekt, dass der Leser direkt an den Planungen, Entscheidungen und Gedanken Caesars teilhat.
- Der Text analysiert Caesars Verwendung des Namens "Caesar" und zeigt, wie er dadurch die Trennung zwischen dem Prokonsul und dem privaten Individuum Caesar unterstreicht. Der Prokonsul Caesar wird zu einer objektiven Größe, die sich vom privaten Individuum abhebt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes sind die erste Person Singularis, die dritte Person Singularis, der "unbekannte" Erzähler, die Darstellungsform in Caesars Commentarii Belli Gallici, die Analyse historischer Schriften, die Rolle des Autors und die Wirkung des Erzählens auf den Leser.
Häufig gestellte Fragen
Warum schreibt Caesar in der dritten Person über sich selbst?
Durch die Verwendung der dritten Person ("Caesar tat dies") erzeugt er einen objektiven Erzählton und distanziert den Prokonsul als historische Figur vom privaten Autor.
Was ist der "unbekannte Erzähler" in den Commentarii?
Es wirkt, als ob eine neutrale Instanz zwischen dem Autor und dem Geschehen steht, was dem Leser das Gefühl gibt, Zeuge einer sachlichen historischen Dokumentation zu sein.
Wie unterscheidet sich Caesars Stil von Xenophon oder Thukydides?
Während auch diese die dritte Person nutzten, bleibt Caesars Erzähler ein "Schatten", der den Leser direkter in die strategischen Planungen und Gedanken einbindet.
Ist Caesars Darstellung im Bellum Gallicum wirklich objektiv?
Obwohl er Werturteile zurückhält, ist die Erzählperspektive ambivalent; er schreibt als Miterlebender, der den Leser zum aktiven Teilnehmer der Ereignisse macht.
Was bedeutet "heterodiegetisches Erzählen" bei Caesar?
Es bedeutet, dass der Erzähler scheinbar außerhalb der Handlung steht, obwohl er in Wahrheit mit der Hauptperson identisch ist, was die Distanz künstlich vergrößert.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2012, Commentarii Belli Gallici. Die erste Person Singularis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538767