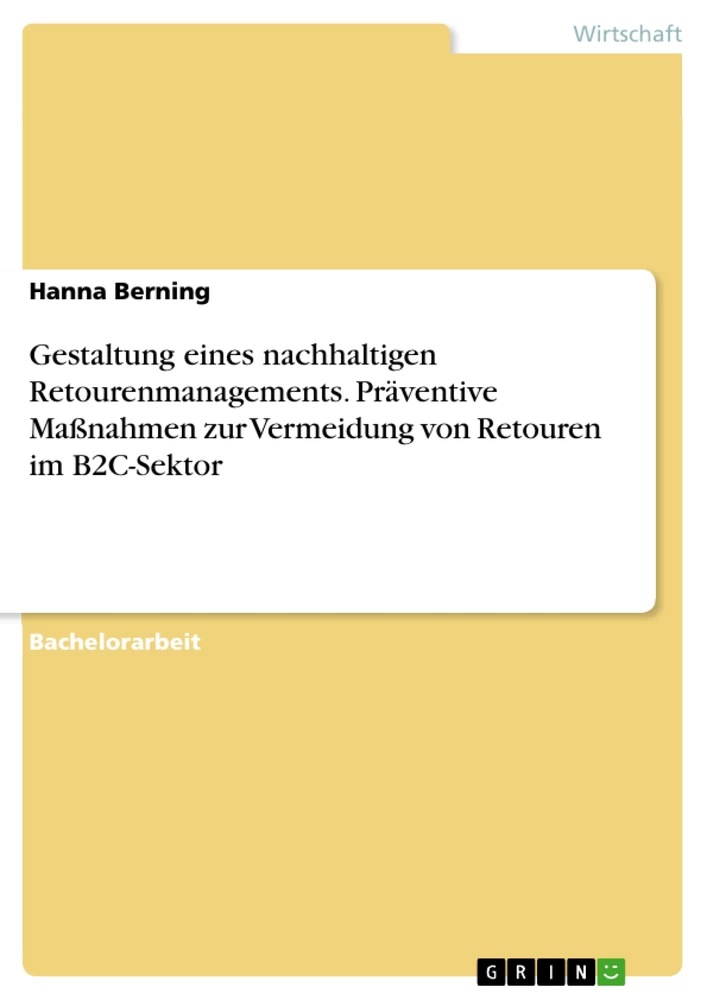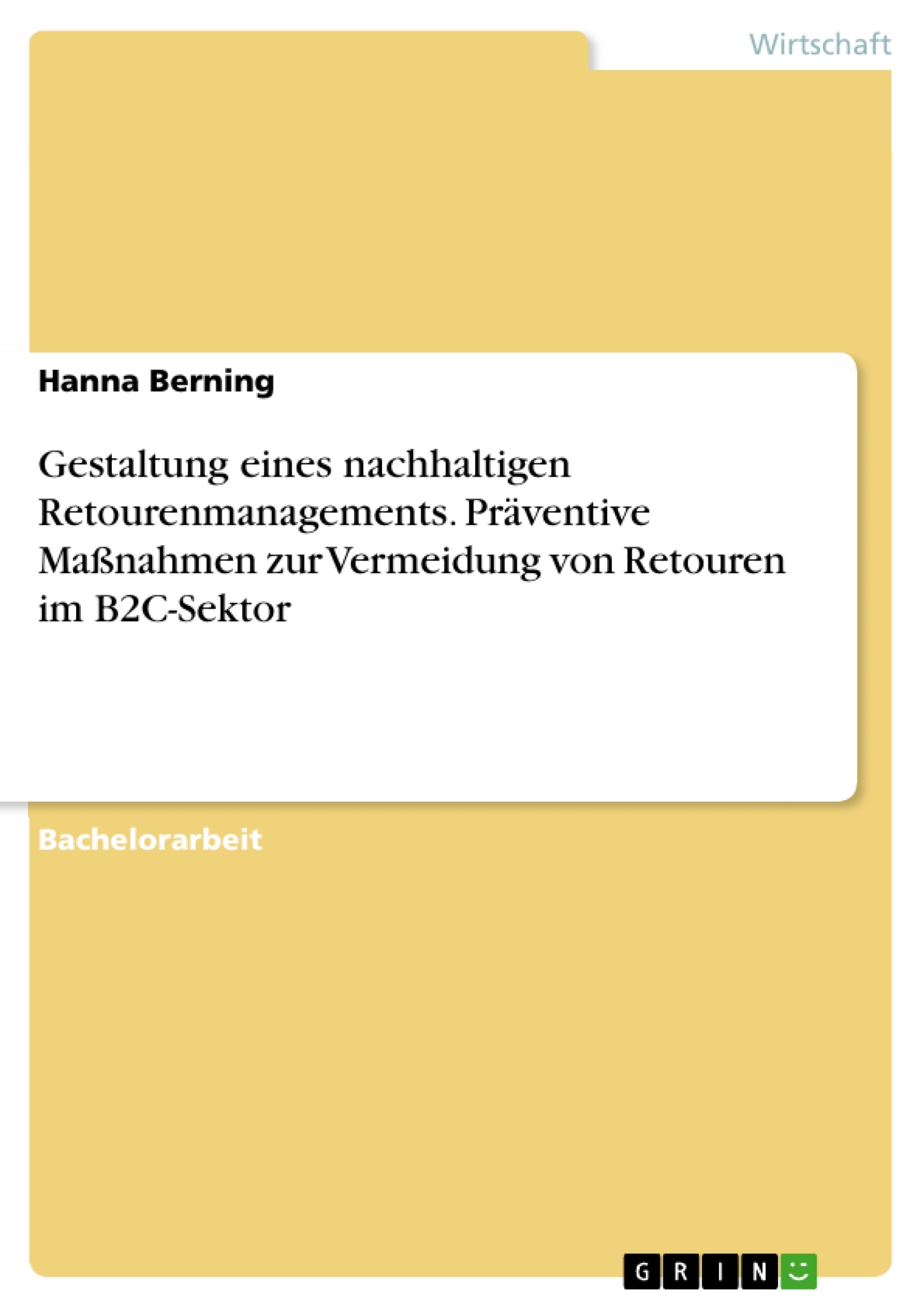In dieser Arbeit geht es um die Beantwortung der Frage, wie es Unternehmen erreichen können, bei steigender Bedeutung des Online-Handels, einhergehend mit erhöhtem Bestellaufkommen, gleichzeitig das Entstehen von Retouren zu vermeiden. Zu diesem Zweck sollen Unternehmen Vorschläge unterbreitet werden, die es ihnen ermöglichen können, bestmöglich auf das gegenwärtig hohe Retourenaufkommen zu reagieren, um ihr Retourenmanagement nachhaltig ausrichten zu können.
Es soll zunächst einmal auf die Wichtigkeit der Senkung der Retourenquote durch die Betrachtung der Auswirkungen auf die Dimensionen der Nachhaltigkeit hingewiesen werden. Anschließend sollen verschiedene präventive Maßnahmen aufgezeigt werden, welche dazu beitragen, das zuvor beschriebene Ziel der langfristigen Minimierung der Retourenzahl bestmöglich zu erreichen. Um passende Maßnahmen unterbreiten zu können, sollen zuvor die Gründe und Ursachen für das Entstehen von Retouren auf Konsumentenseite dargelegt werden.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit liegt außerdem darin, die Schwierigkeiten, denen die Unternehmen im Prozess zur Gestaltung eines nachhaltigen Retourenmanagements gegenüberstehen, aufzuzeigen. Es gilt zu erreichen, dass Unternehmen, die im Hauptteil dieser Arbeit aufgezeigten Maßnahmen mit geringen Hürden in ihr Retourenmanagement integrieren können. Auch wenn Konsumenten heutzutage in den meisten Lebenslagen verstärkt auf ihre Umwelt achten und versuchen nachhaltig zu handeln, steigt die Retourenzahl stetig. Sie verzichten der Umwelt zuliebe auf Fleisch und fahren öfter Bus, obwohl Auto fahren um einiges bequemer ist. Trotzdem schicken sie massenhaft Ware aus dem Netz zurück. Der Trend der Nachhaltigkeit scheint in diesem Bereich noch nicht angekommen zu sein, obwohl eine Umstellung auf ein nachhaltiges Verhalten heutzutage nicht mehr sonderlich schwer ist. Es soll aufgezeigt werden, welche Rolle Verbraucher im Hinblick auf die Zielerreichung spielen und was vor diesem Hintergrund beachtet werden muss, damit das bestmögliche Ergebnis der Senkung der Retourenquote eintreten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Definition der Begrifflichkeiten
- 2.1 Nachhaltigkeit
- 2.2 Retourenmanagement
- 2.3 Nachhaltiges Retourenmanagement
- 3. Die Entwicklung des deutschen Online-Handels
- 4. Relevanz der Retouren als Teil des Online-Handels in der Nachhaltigkeitsbetrachtung
- 4.1 Hintergründe zu Retouren in Deutschland
- 4.2 Auswirkungen des Retourenaufkommens auf die Dimensionen der Nachhaltigkeit
- 4.2.1 Ökonomische Auswirkungen
- 4.2.2 Soziale Auswirkungen
- 4.2.3 Ökologische Auswirkungen
- 4.2.4 Hintergründe zur Retourenentsorgung
- 5. Handlungsvorschläge zur Optimierung des Retourenmanagements
- 5.1 Gründe für Retouren auf Konsumentenseite
- 5.2 Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Retouren
- 5.2.1 Maßnahmen aus Unternehmenssicht
- 5.2.2 Herausforderungen bei der Umsetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gestaltung eines nachhaltigen Retourenmanagements im B2C Sektor. Die Zielsetzung ist es, präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Retouren zu identifizieren und zu analysieren, um die Nachhaltigkeit des Online-Handels zu verbessern.
- Definition und Analyse von Nachhaltigkeit im Kontext des Retourenmanagements
- Entwicklung und Relevanz des Online-Handels in Deutschland
- Auswirkungen von Retouren auf die Nachhaltigkeit im Online-Handel
- Identifizierung von Gründen für Retouren auf Konsumentenseite
- Entwicklung und Analyse von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Retouren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung, die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit dargelegt werden. Anschließend werden die wichtigsten Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit, Retourenmanagement und Nachhaltiges Retourenmanagement definiert. Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung des deutschen Online-Handels und zeigt dessen Relevanz auf. Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen von Retouren auf die Nachhaltigkeit im Online-Handel analysiert, wobei die ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimensionen betrachtet werden. Im fünften Kapitel werden Handlungsvorschläge zur Optimierung des Retourenmanagements präsentiert, die sich sowohl an Unternehmen als auch an Konsumenten richten. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Nachhaltigkeit, Retourenmanagement, Online-Handel, B2C Sektor, präventive Maßnahmen, Vermeidung von Retouren und ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen. Die Arbeit analysiert die Relevanz von Retouren für die Nachhaltigkeit im Online-Handel und entwickelt Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Retourenmanagements.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines nachhaltigen Retourenmanagements?
Ziel ist es, das Retourenaufkommen im Online-Handel langfristig zu minimieren, um negative ökonomische, soziale und ökologische Auswirkungen zu reduzieren.
Welche ökologischen Auswirkungen haben Retouren?
Retouren führen zu zusätzlichen Transportwegen (CO2-Ausstoß), erhöhtem Verpackungsmüll und im schlimmsten Fall zur Entsorgung von eigentlich einwandfreier Neuware.
Warum schicken Konsumenten trotz Nachhaltigkeitsbewusstsein viel Ware zurück?
Oft überwiegt die Bequemlichkeit des Online-Shoppings. Zudem fördern kostenlose Retouren und einfache Prozesse ein Verhalten, bei dem Artikel zur Ansicht in mehreren Varianten bestellt werden.
Welche präventiven Maßnahmen können Unternehmen ergreifen?
Unternehmen können Retouren vermeiden durch detaillierte Produktbeschreibungen, hochwertige Bilder, virtuelle Anproben, Größenberatungen und eine verbesserte Kommunikation.
Welche ökonomischen Folgen haben hohe Retourenquoten für Händler?
Hohe Quoten verursachen enorme Kosten für Logistik, Sichtung der Ware, Neuverpackung und Wertverluste, was die Profitabilität im E-Commerce stark belastet.
- Quote paper
- Hanna Berning (Author), 2020, Gestaltung eines nachhaltigen Retourenmanagements. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Retouren im B2C-Sektor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538854