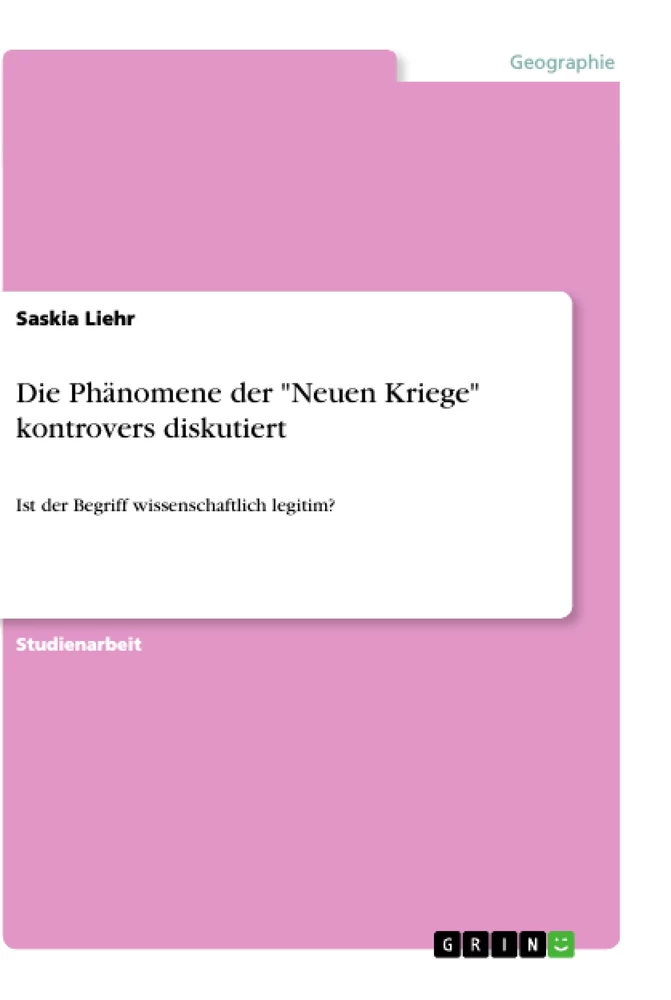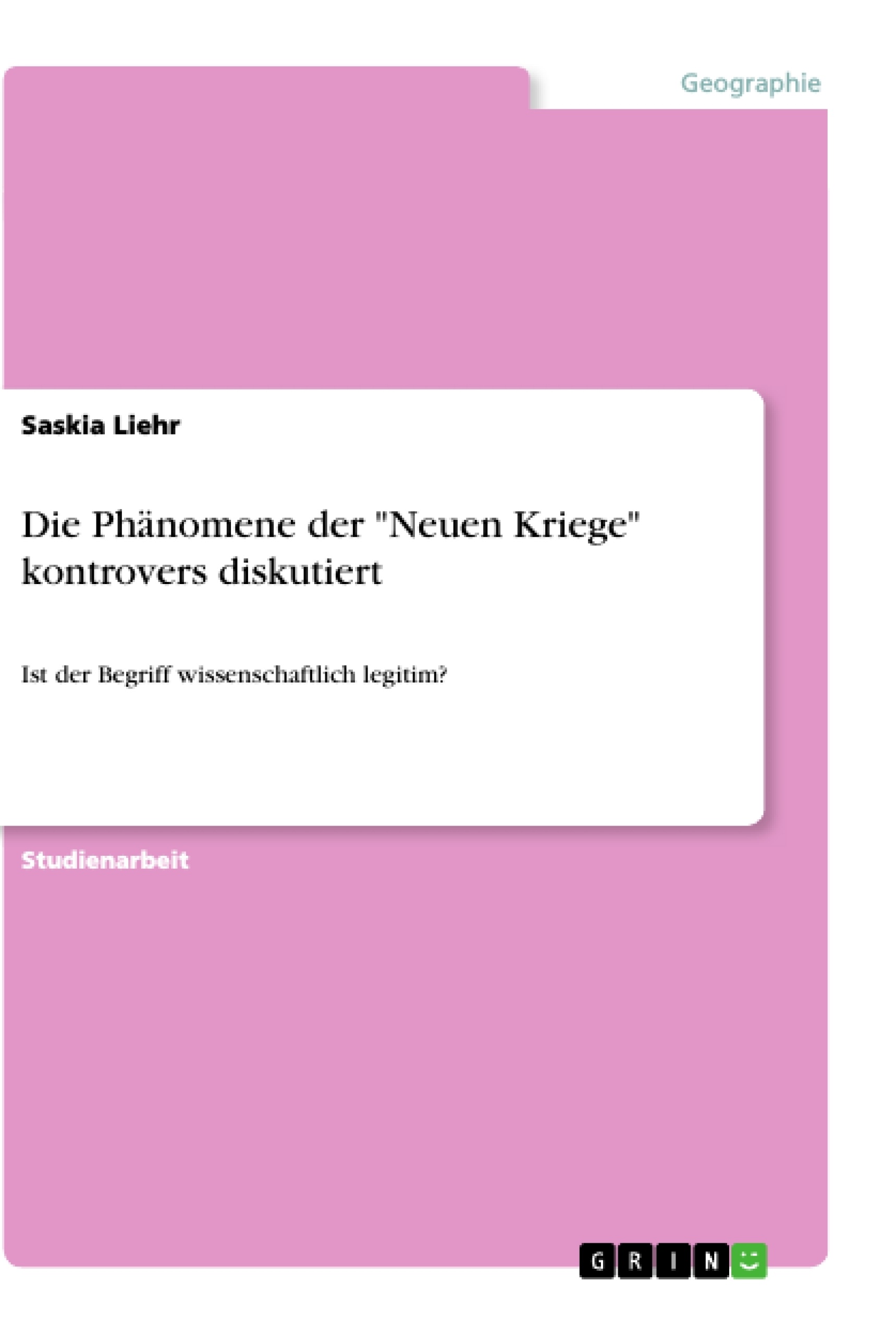Als der Kalte Krieg 1989/1990 endete, verlor die bis zum damaligen Zeitpunkt behandelte These der Stellvertreterkriege in der Konfliktforschung an Bedeutung. Da die Zahl der bewaffneten Konflikte in den 1990er Jahren umgehend anstieg, wurden zahlreiche neue Thesen über Kriege und deren Entstehung entwickelt. In diesem Zusammenhang entstand auch die These der "Neuen Kriege", welche davon ausgeht, dass eine neue Art der Kriegsführung entstanden sei, die so vorher noch nicht existiert habe. Einige Kritiker verweisen darauf, dass der Begriff des "Neuen" grundsätzlich inhaltsleer und zeitlich begrenzt sei. Andere zweifeln die empirische Basis der befürwortenden Behauptungen an.
Diese Arbeit widmet sich daher der übergeordneten Fragestellung, ob der Begriff der "Neuen Kriege" wissenschaftlich legitim ist. Um dies zu beantworten, beschäftigt sie sich ausführlich mit den Fragen, wie sich "Neue Kriege" genau definieren und welche Kritiken es an dieser Bezeichnung gibt. Eine Definition von "alten" Kriegen soll den Unterschied zwischen zu den "Neuen Kriegen" verdeutlichen. Im Anschluss werden die verschiedenen Phänomene der "Neuen Kriege" aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „alten“ Kriege
- 3. Die Phänomene des „Neuen Kriegs“ kontrovers diskutiert
- 3.1 Gewalt
- 3.2 Ethnische Motive
- 3.3 (Gewalt) Ökonomische Motive
- 3.4 Failed states
- 3.5 Kommerzialisierung der Gewalt
- 3.6 Schattenglobalisierung
- 3.7 Gewaltökonomien
- 3.8 Veränderte Wahrnehmung
- 3.9 Der Begriff der Bürgerkriege
- 3.10 Einsatz von Kindersoldaten
- 3.11 Gewalt gegen Zivilisten
- 3.12 Terrorismus
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wissenschaftliche Legitimität des Begriffs „Neue Kriege“. Sie analysiert die Definition von „alten“ Kriegen im Vergleich zu den „Neuen Kriegen“ und beleuchtet die kontroversen Phänomene der „Neuen Kriege“ aus verschiedenen Perspektiven. Die Arbeit evaluiert kritische Stimmen zu verschiedenen Thesen und konzentriert sich auf die Werke von Kaldor, Münkler, Geis und Eppler.
- Definition und Abgrenzung von „alten“ und „Neuen Kriegen“
- Kontroversen um den Begriff „Neue Kriege“ in der wissenschaftlichen Literatur
- Analyse der verschiedenen Phänomene „Neuer Kriege“, wie Gewalt, ethnische und ökonomische Motive
- Die Rolle von Failed States in „Neuen Kriegen“
- Bewertung der wissenschaftlichen Legitimität des Begriffs „Neue Kriege“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der wissenschaftlichen Legitimität des Begriffs „Neue Kriege“ vor. Sie verortet diese Frage im Kontext des Endes des Kalten Krieges und des darauf folgenden Anstiegs bewaffneter Konflikte. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau, der die Definition „alter“ Kriege mit der Analyse der Phänomene „Neuer Kriege“ verbindet, um schließlich die eingangs gestellte Frage zu beantworten. Die Auswahl der relevanten Literatur wird ebenfalls kurz erläutert, mit Fokus auf die Werke von Kaldor, Münkler, Geis und Eppler.
2. Die „alten“ Kriege: Dieses Kapitel definiert das Modell des „alten Krieges“ als zwischenstaatliche Konflikte des 18. und 19. Jahrhunderts, geprägt von einem staatlichen Gewaltmonopol, begrenzten politischen Zielen und klarer Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten. Der Bezug auf Clausewitz' Kriegstheorie wird hergestellt, und die Rolle der Ideologie im Kontext des staatlichen Gewaltmonopols wird im 20. Jahrhundert diskutiert. Es wird auch auf die Prognosen von Münkler und Creveld eingegangen, die bereits ein Abweichen vom Modell des „alten Krieges“ vorhersagten.
3. Die Phänomene des „Neuen Kriegs“ kontrovers diskutiert: Dieses Kapitel analysiert die charakteristischen Merkmale „Neuer Kriege“ im Vergleich zu „alten“ Kriegen. Es werden die verschiedenen Perspektiven und kontroversen Diskussionen in der wissenschaftlichen Literatur dargestellt. Hier werden innerstaatliche Konflikte mit ökonomischen Motiven im Vordergrund betrachtet, die oft von nicht-staatlichen Akteuren ausgetragen werden. Die unterschiedlichen Facetten wie Gewalt, ethnische und ökonomische Motive, sowie das Konzept der „Failed States“ werden detailliert beleuchtet und mit den jeweiligen Kontroversen in der Forschung verknüpft.
Schlüsselwörter
Neue Kriege, Alte Kriege, Konfliktforschung, Gewalt, Ökonomische Motive, Ethnische Konflikte, Failed States, Mary Kaldor, Herfried Münkler, Anna Geis, Erhard Eppler, Staatliches Gewaltmonopol, Nicht-staatliche Akteure, Innerstaatliche Konflikte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der "Neuen Kriege"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Legitimität des Begriffs "Neue Kriege". Sie vergleicht "alte" und "neue" Kriege, analysiert kontroverse Phänomene der "Neuen Kriege" und bewertet kritische Stimmen aus der Forschung, insbesondere von Kaldor, Münkler, Geis und Eppler.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von "alten" und "Neuen Kriegen", die Kontroversen um den Begriff "Neue Kriege", verschiedene Phänomene der "Neuen Kriege" (Gewalt, ethnische und ökonomische Motive), die Rolle von Failed States und die Bewertung der wissenschaftlichen Legitimität des Begriffs "Neue Kriege".
Wie werden "alte" Kriege definiert?
Die Arbeit definiert "alte" Kriege als zwischenstaatliche Konflikte des 18. und 19. Jahrhunderts, charakterisiert durch staatliches Gewaltmonopol, begrenzte politische Ziele und eine klare Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten. Die Rolle von Clausewitz' Kriegstheorie und die Bedeutung der Ideologie im 20. Jahrhundert werden ebenfalls diskutiert.
Welche Phänomene der "Neuen Kriege" werden analysiert?
Das Kapitel zu den "Neuen Kriegen" analysiert verschiedene Phänomene wie Gewalt, ethnische und ökonomische Motive, Failed States, die Kommerzialisierung der Gewalt, Schattenglobalisierung, Gewaltökonomien, veränderte Wahrnehmung, Bürgerkriege, den Einsatz von Kindersoldaten, Gewalt gegen Zivilisten und Terrorismus. Es werden dabei die kontroversen Diskussionen in der wissenschaftlichen Literatur berücksichtigt.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke von Mary Kaldor, Herfried Münkler, Anna Geis und Erhard Eppler, deren Perspektiven und Thesen kritisch evaluiert werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den "alten" Kriegen, ein Kapitel zur kontroversen Diskussion der Phänomene der "Neuen Kriege" und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor und erläutert den Aufbau der Arbeit. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die eingangs gestellte Frage.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neue Kriege, Alte Kriege, Konfliktforschung, Gewalt, Ökonomische Motive, Ethnische Konflikte, Failed States, Mary Kaldor, Herfried Münkler, Anna Geis, Erhard Eppler, Staatliches Gewaltmonopol, Nicht-staatliche Akteure, Innerstaatliche Konflikte.
- Citation du texte
- Saskia Liehr (Auteur), 2020, Die Phänomene der "Neuen Kriege" kontrovers diskutiert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538861