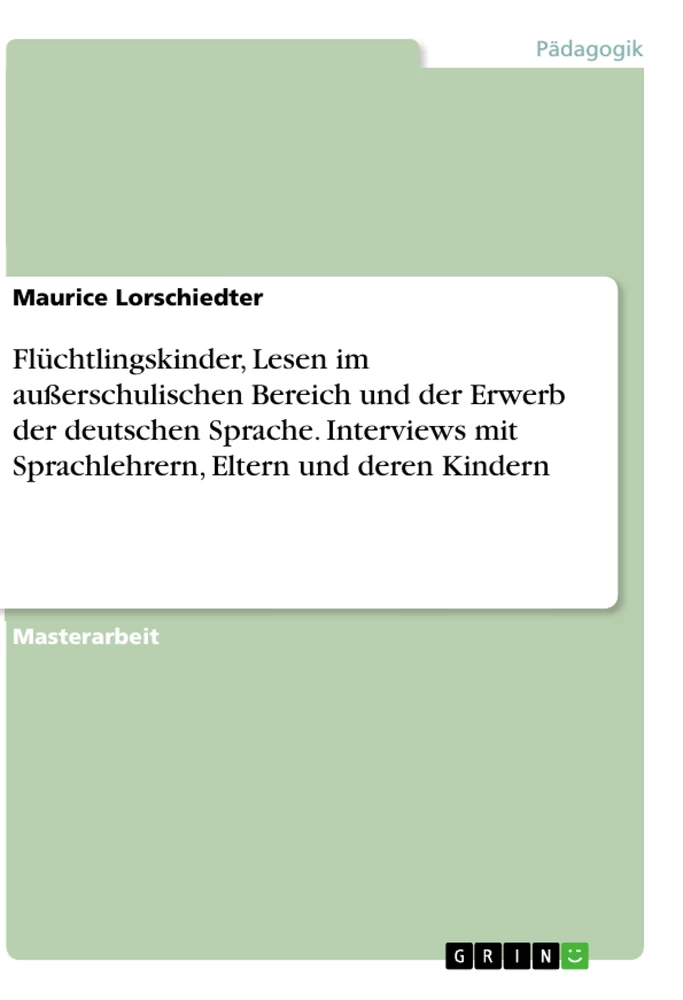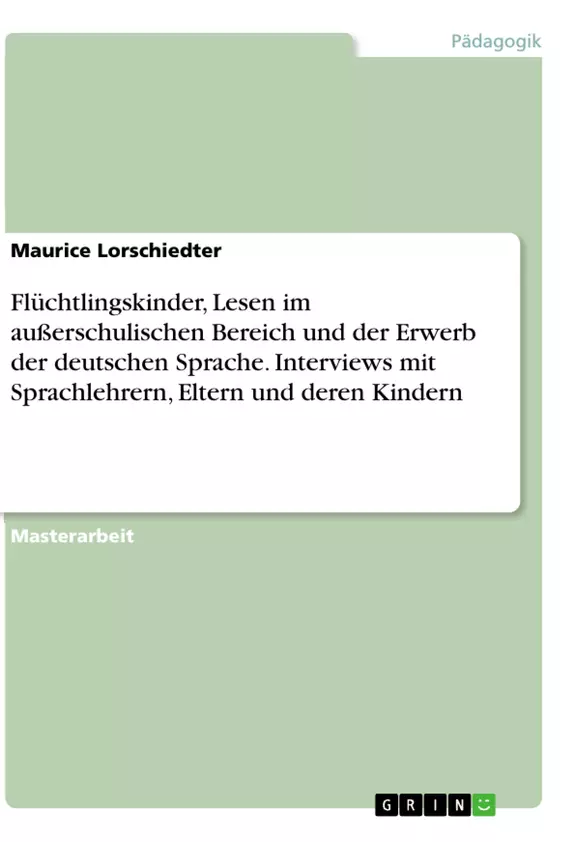In der nachfolgenden Arbeit wird der Erwerb der deutschen Sprache von Flüchtlingskindern im außerschulischen Bereich untersucht.
Hierfür wird eine für diese Arbeit durchgeführte methodische und leitfadengestützte Befragung von betroffenen Kindern, Eltern und Sprachkursleiter*innen analysiert. Es wird angestrebt, die außerschulischen Sprachförderangebote hinsichtlich Organisation, Ablauf, erzielter Effekte und nachhaltiger Wirkung zu untersuchen und daraus resultierend Verbesserungen und Anregungen für die Sprachförderung zu entwickeln. Besondere Berücksichtigung kommt hierbei dem Lesen (Umgang mit Texten und Medien) zu. Hierbei gilt herauszufinden, welchen Stellenwert das Lesen im außerschulischen Bereich findet. Hierzu zählt neben dem Sprachkurs ebenfalls die Lesesozialisation in der Familie mit sogenannten Literacy-Erfahrungen. Im Zeitalter neuer Medien soll ebenfalls festgestellt werden, inwieweit diese in der Sprachförderung genutzt werden und den Spracherwerbsprozess auf familiärer Ebene begleiten.
Aufgeteilt ist diese Arbeit in einen theoretisch orientierten sowie einen empirischen Teil. Im theoretischen Teil der Arbeit werden grundlegende Begriffe erläutert und die aktuelle gesellschaftliche Situation analysiert. Verschiedene Sprachlern- und Erwerbstheorien in der Erst- und Zweitsprache sowie Modelle zur Alphabetisierung werden kurz erläutert, bevor das Lesen besondere Berücksichtigung findet und die außerschulische Sprachförderung konkretisiert wird. Im empirischen Teil erfolgen Interviews mit Sprachlehrer*innen, Eltern und deren Kindern. Zurückgegriffen wird in einem ersten Schritt auf die Erhebungsmethode des problemzentrierten Interviews nach Witzel, bevor in einem zweiten Schritt die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring angewendet wird. Schlussfolgernd werden im Fazit die Ergebnisse dieser Analyse zusammengetragen und dargestellt. Daraus resultierend werden Verbesserungsvorschläge zum Zweitspracherwerb erarbeitet und tabellarisch aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abkürzungsverzeichnis
- III. Theoretischer Teil der Arbeit
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Begriffserläuterungen
- 2.1 Der Flüchtlingsbegriff und einhergehende Nomenklatur
- 2.2 Menschen mit Migrationshintergrund
- 2.3 Integration - eine soziologische Betrachtungsweise
- 2.4 Mehrsprachigkeit
- 2.4.1 Muttersprache
- 2.4.2 Erstsprache
- 2.4.3 Zweitsprache und Fremdsprache
- 3. Analyse der Gesellschaft - Empirische Befunde
- 3.1 Erster Befund: Aktuelle Situation in Deutschland
- 3.2 Zweiter Befund: Soziale Herkunft und Schulische Leistungen
- 3.3 Dritter Befund: Altersgruppen
- 3.4 Vierter Befund: Asylsuchende, Aktuelle Zahlen
- 4. Der Kommunikationsbegriff
- 5. Sprachhandlungskompetenz
- 5.1 Bildungsstandards des Faches Deutsch für den Primarbereich
- 5.2 Kernlehrplan Deutsch im Saarland
- 6. Grundannahmen und Erklärungsversuche des Spracherwerbs
- 6.1 Theorien über das Lernen (von Sprache)
- 6.2 Erstspracherwerb
- 6.2.1 Theorien zum Erstspracherwerb
- 6.2.2 Bedingungen beim Erwerb der Erstsprache
- 6.2.3 Entwicklungsphasen
- 6.3 Zweitspracherwerb
- 6.3.1 Theorien zum Zweitspracherwerb
- 6.3.2 Einflussfaktoren beim Erwerb der Zweitsprache
- 6.3.3 Die Bedeutung der Erstsprache
- 7. Überlegungen zum Schriftspracherwerb und Alphabetisierung
- 7.1 Das Basismodell nach Frith und die Erweiterung durch Günther
- 8. Besondere Berücksichtigung des Lesens
- 8.1 Die IGLU Studie 2016
- 8.2 Lesekompetenz
- 8.2.1 Lesekompetenzstufen
- 8.2.2 Lesen mit Texten und Medien umgehen
- 8.3 Didaktisches Mehrebenenmodell des Lesens
- 8.4 Literacy - Erziehung: Die Rolle von Büchern und Medien
- 10. Deutschförderung der Flüchtlingskinder an Grundschulen
- 10.1 Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Saarland
- 11. Außerschulische Sprachförderung: Förderansätze, Prinzipien und Möglichkeiten für DaZ-Lernende
- 11.1 Förderansätze
- 11.2 Prinzipien der Förderung
- 11.3 Möglichkeiten der außerschulischen Sprachförderung
- 11.3.1 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (GER)
- 11.3.2 Nationale Ebene
- 11.3.3 Regionale Ebene
- 11.3.4 Lokale Ebene
- IV. Empirischer Teil: Interviews mit Sprachlehrern, Eltern und deren Kindern unter besonderer Berücksichtigung des Lesens (Umgang mit Texten und Medien)
- 12. Erhebungsmethode: Das problemzentrierte Interview nach Witzel
- 12.1 Grundpositionen
- 12.2 Instrumente
- 12.3 Gestaltung
- 13. Auswertungsmethode
- 13.1 Transkriptionsregeln nach Kuckartz
- 13.2 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 14. Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews
- 14.1 Teilnehmer
- 14.2 Eindrücke Hospitation Caritas/Campus Lernstudio
- 14.3 Durchführung der Analyse bzw. Strukturierung der Ergebnisse
- 14.3.1 Darstellung & Interpretation der Ergebnisse - Befragte Kinder (BFK)
- 14.3.2 Darstellung & Interpretation der Ergebnisse - Befragte Eltern (GFE)
- 14.3.3 Darstellung & Interpretation der Ergebnisse - Befragte Sprachlehrer (BSL)
- 15. Fazit
- V. Anhang
- Interviewfragen
- Leitfaden und deduktives Kategoriensystem „Geflüchtete Kinder“
- Leitfragen und deduktives Kategoriensystem „Geflüchtete Eltern“
- Leitfaden und deduktives Kategoriensystem „Sprachlehrer“
- Transkription der Interviews – „Flüchtlingskinder“
- Transkription der Interviews - „Sprachlehrer“
- Transkription der Interviews – „Geflüchtete Eltern“
- Tabellen zur induktiven Kategorienbildung
- ,,Geflüchtete Kinder“
- ,,Sprachlehrer“
- ,,Geflüchtete Eltern“
- VI. Literaturverzeichnis
- VII. Abbildungsverzeichnis
- VIII. Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Erwerb der deutschen Sprache von Flüchtlingskindern im außerschulischen Bereich. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Herausforderungen, die mit dem Spracherwerb im außerschulischen Kontext verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf das Lesen und den Umgang mit Texten und Medien. Ziel ist es, anhand von Interviews mit Sprachlehrern, Eltern und Kindern Einblicke in die Prozesse und Herausforderungen des Spracherwerbs zu gewinnen und den Einfluss von außerschulischen Lernumgebungen auf die Sprachentwicklung zu analysieren.
- Spracherwerb von Flüchtlingskindern im außerschulischen Bereich
- Herausforderungen und Chancen des Spracherwerbs
- Rolle des Lesens und Umgangs mit Texten und Medien
- Außerschulische Lernumgebungen und Sprachentwicklung
- Förderansätze und -möglichkeiten im außerschulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beleuchtet die grundlegenden Konzepte und Theorien zum Flüchtlingsbegriff, zur Mehrsprachigkeit, zur Sprachhandlungskompetenz und zum Spracherwerb, insbesondere im Hinblick auf den Zweitspracherwerb. Der empirische Teil fokussiert auf die Durchführung und Auswertung von Interviews mit Sprachlehrern, Eltern und Flüchtlingskindern. Ziel ist es, die subjektiven Erfahrungen und Perspektiven der Beteiligten zum Thema des Spracherwerbs im außerschulischen Bereich zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen: Flüchtlingskinder, Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Deutsch als Fremdsprache (DaZ), außerschulische Sprachförderung, Lesekompetenz, Textverständnis, Medienkompetenz, Interviews, qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie lernen Flüchtlingskinder im außerschulischen Bereich Deutsch?
Der Spracherwerb erfolgt durch Sprachförderangebote, Lesesozialisation in der Familie und den Einsatz neuer Medien zur Unterstützung des Lernprozesses.
Welche Rolle spielt das Lesen beim Spracherwerb?
Lesen und der Umgang mit Texten sind zentral für die Alphabetisierung und den Erwerb von Bildungssprache (Literacy-Erfahrungen).
Was wurde in den Interviews mit Sprachlehrern und Eltern untersucht?
Die Interviews analysierten Organisation, Ablauf und nachhaltige Wirkung der außerschulischen Förderung sowie die häuslichen Lernbedingungen.
Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitsprache?
Die Arbeit erläutert Theorien zum Erstspracherwerb und zeigt auf, wie wichtig die Muttersprache als Basis für das Erlernen der deutschen Zweitsprache ist.
Welche Verbesserungsvorschläge liefert die Arbeit?
Basierend auf der Inhaltsanalyse nach Mayring werden konkrete Anregungen zur Optimierung der Sprachförderung und Lesekompetenz für DaZ-Lernende erarbeitet.
- Citation du texte
- Maurice Lorschiedter (Auteur), 2019, Flüchtlingskinder, Lesen im außerschulischen Bereich und der Erwerb der deutschen Sprache. Interviews mit Sprachlehrern, Eltern und deren Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539237